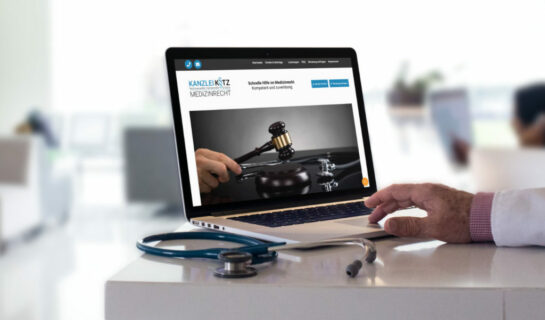LG Bielefeld – Az.: 4 O 49/14 – Urteil vom 09.05.2017
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Parteien streiten um Schadensersatz aufgrund einer vermeintlichen ärztlichen Fehlbehandlung.
Die Klägerin leidet an Sarkoidose, die bei einer Operation im Jahr 2000 festgestellt worden ist. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat sie vier Kinder, die in den Jahren 1993, 1995 und 1998 sowie im Dezember 2012 zur Welt gekommen sind. Das letzte Kind – ihr Sohn N. – war ungewollt.
Die Beklagte zu 1) ist eine von den Beklagten zu 2) und 3) betriebene gynäkologische Gemeinschaftspraxis, bei der die Beklagten zu 4) und 5) angestellt sind.
Die Klägerin erkrankte Mitte 2011 psychisch und litt unter Magenbeschwerden. Ihr Hausarzt äußerte daraufhin den Verdacht, dass auch eine langjährige Einnahme derselben Antibabypille zu derartigen Magenbeschwerden und psychischen Beschwerden führen könne. Zum damaligen Zeitpunkt nahm die Klägerin seit über 10 Jahren eine Antibabypille ein, zuletzt seit März 2011 das Präparat „N.“.
Am 18.10.2011 stellte sich die Klägerin anschließend für eine (regelmäßige) Kontrolluntersuchung in der Praxis der Beklagten vor. Hintergrund dafür war u.a. eine beabsichtigte zytologische Untersuchung bei gesicherter Zyklusstörung.
Etwa vier Monate später – am 23.02.2012 – erfolgte bei der Klägerin eine Blutentnahme zur Bestimmung des AMH-Wertes (Anti-Müller-Hormon-Wertes) durch eine Arzthelferin der Beklagten. Das Ergebnis von 0,37 ng/ml lag danach am 05.03.2012 vor.
Am 16.04.2012 stellte sich die Klägerin anschließend erneut zu einem (regelmäßigen) Kontrolltermin in der Praxis der Beklagten vor. Nochmals etwa vier Monate später – im August 2012 – nahm sie dann erstmals Kindsbewegungen war und suchte deshalb – da sie zunächst eine andere gesundheitliche Ursache vermutete – am 13.08.2012 ihren Hausarzt auf, der sie indes unter dem Verdacht einer ungewollten Schwangerschaft (wiederum) in die Praxis der Beklagten überwies.
Der Beklagte zu 2) stellte bei der Klägerin daraufhin eine Schwangerschaft in der 22. Woche fest. Die Empfängnis selbst datierte er auf Ende März/Anfang April 2012. Für weitere Untersuchungen überwies er die Klägerin anschließend an die gynäkologische Gemeinschaftspraxis Dr. C., E. und N. in N.. Am 14.08.2012 erfolgte dort eine 3D-Ultraschalluntersuchung und am 16.8.2012 eine Fruchtwasserpunktion zur Untersuchung auf mögliche Schädigungen des Kindes.
Am 17.12.2012 stellte sich die Klägerin schließlich im Krankenhaus St. F. gGmbH in F. vor. Um eine Kindsgefährdung auszuschließen, wurde bei ihr dort kurz vor dem errechneten Geburtstermin am 20.12.2012 eine tägliche Kardiotokografie (CTG) notwendig. Nachdem sich im Rahmen dieser Untersuchungen am 22.12.2012 schlechte Werte ergeben hatten, entschlossen sich die behandelnden Ärzte auch wegen des zu diesem Zeitpunkt bereits um zwei Tage überschrittenen (errechneten) Geburtstermins am 22.12.2012, die Geburt nunmehr mittels Cytotec-Tabletten einzuleiten. Die Klägerin gebar ihren Sohn L. daraufhin gegen 19:25 Uhr auf natürlichem Wege.
Nach der Geburt verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Klägerin zunehmend. Sie hatte starke Schmerzen im Unterbauch und noch vor 23:00 Uhr verspürte sie zudem plötzlich ein schwallartiges Entweichen von Flüssigkeit im Genitalbereich, woraufhin sie kurzzeitig ohnmächtig wurde.
Insgesamt litt die Klägerin damit unter starken Nachblutungen. Aufgrund einer postpartalen Atonie hatte sie einen Blutverlust von 1.200 ml, so dass umgehend eine Nach-Curettage durch einen operativen Eingriff erfolgte. Am Folgetag – dem 23.12.2012 – mussten der Klägerin zudem nach gesunkenen Hämoglobinwerten aufgrund des starken Blutverlustes zusammen vier (Fremd-) Blutkonserven verabreicht werden. Aufgrund dieser notwendigen Nachbehandlungen durfte die Klägerin ferner für drei Tage ihr Bett nicht verlassen, so dass ihr auch noch ein Katheter gelegt werden musste.
Am 28.12.2012 konnte die Klägerin schließlich aus der stationären Krankenhausbehandlung entlassen werden.
Die Klägerin wirft den Beklagten Behandlungsfehler vor.

Sie behauptet, im Rahmen ihrer Behandlung in der Praxis der Beklagten habe sie dem Beklagten zu 3) am 18.10.2011 ihre damaligen Beschwerden mitgeteilt und die Vermutung geäußert, dass sie die Antibabypille „N.“ vielleicht nicht mehr vertrage. Gleichzeitig habe sie gegenüber dem Beklagten zu 3) aber auch angegeben, dass sie auf gar keinen Fall mehr schwanger werden wolle. Er – der Beklagte zu 3) – habe mit ihr anschließend über einen Test – den sog. Anti-Müller-Hormontest – gesprochen, mit dem man bestimmen könne, ob die Einnahme einer Antibabypille und damit eine Verhütung noch notwendig sei. Über weitere Möglichkeiten der Schwangerschaftsverhütung habe er mit ihr allerdings nicht (mehr) gesprochen, obwohl sie ihn damals noch ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass ihre Mutter bei ihrer Geburt über 40 Jahre alt gewesen sei.
Der Beklagte zu 3) habe sie somit am 18.10.2011 (nur) über die Funktion und Vorgehensweise des AMH-Testes informiert. Über die Risiken und die Sicherheit dieses Tests habe er demgegenüber nichts gesagt.
Am 09.03.2012 habe sie telefonisch Kontakt mit der Praxis der Beklagten aufgenommen, um ein neues Rezept für die Antibabypille „N.“ zur Abholung vorzubestellen. Sie habe diese Gelegenheit dabei auch dazu genutzt, um das Ergebnis des AMH-Tests zu erfragen. Eine Fachangestellte der Beklagten habe ihr daraufhin den Wert von 0,37 ng/ml mitgeteilt und ihr ergänzend dazu erläutert, dass dieser Wert unter 1,0 ng/ml und damit unterhalb der Norm liege. Sie – die Klägerin – brauche daher zukünftig nichts mehr zu machen.
Aufgrund dieser Mitteilung habe sie damals dann von der Bitte abgesehen, ihr ein neues Rezept für die Antibabypille auszustellen. In dem Glauben, in Zukunft nicht mehr schwanger werden zu können, habe sie zudem von nun an die weitere Einnahme einer Antibabypille unterlassen, was allein auf die Falschberatung der Mitarbeiterin der Beklagten zurückgehe.
Bei dem Kontrolltermin vom 16.04.2012 habe sie dem Beklagten zu 3) anschließend sowohl von dem am 09.03.2012 geführten Telefongespräch mit seiner Mitarbeiterin als auch davon berichtet, dass sie die Antibabypille bereits abgesetzt, jedoch Anfang April erwartungswidrig keine Regelblutung bekommen habe. Sie habe dem Beklagten zu 3) auch ihre daraus gezogene Schlussfolgerung mitgeteilt, dass sie sich nunmehr in den Wechseljahren befinde.
Der Beklagte zu 3) sei damals jedoch weder darauf eingegangen, dass sie die Antibabypille abgesetzt habe, noch auf eine mögliche Schwangerschaft. Da die Konzeption bei ihr indes Ende März 2014 – genauer am 26.03.2014 – stattgefunden habe, hätte ihre Schwangerschaft schon am 16.04.2012 eindeutig festgestellt werden können und müssen.
Tatsächlich aber habe der Beklagte zu 3) auch keine Nachfrage bezüglich des Gespräches vom 09.03.2012 gestellt oder selbst mit ihr ein Gespräch bezüglich des durchgeführten AMH-Testes vorgenommen. Er habe vielmehr nur eine Beratung hinsichtlich des Eintritts der Wechseljahre vorgenommen. Damit aber habe er weder eine Beratung, Untersuchung oder Behandlung dahingehend vorgenommen, eine etwaig bei ihr bestehende Schwangerschaft festzustellen, noch hinsichtlich eines ggfls. vorzunehmenden legalen Schwangerschaftsabbruches. Auch habe kein Gespräch zur weiteren Empfängnisverhütung, Pillenverordnung und/oder Konzeption stattgefunden.
Die später in der Gemeinschaftspraxis Dr. C., E. und N. durchgeführte Fruchtwasserpunktion sei dann aufgrund ihres – der Klägerin – Alters von 45 Jahren indiziert gewesen.
Bis zur Geburt ihres Sohnes habe sie anschließend psychisch stark unter der ungewollten und für sie überraschenden Schwangerschaft gelitten. Sie habe erhebliche Angst vor dem Verlust ihres neuen beruflichen Aufgabengebietes sowie davor gehabt, sich alleine nicht genügend um ihren Haushalt und die Kinder kümmern zu können. Tagsüber habe sie (deshalb) an Unkonzentriertheit und nachts an Schlafstörungen gelitten.
Nach der Geburt ihres Sohnes habe sie schließlich trotz der weiteren Behandlungen unter erheblichen Schmerzen im Unterbauchbereich gelitten und sich wegen des erheblichen Blutverlustes schwach und erschöpft gefühlt. Auch noch zu Hause habe sie sich in den nachfolgenden Tagen von den Komplikationen bei der Geburt und der sich anschließenden Operation erholen müssen. Neben den noch weiter vorhandenen Schmerzen im Unterbauchbereich habe sie sich dabei aufgrund des Blutverlustes aber auch dann noch unwohl und kraftlos gefühlt. Erst nach sieben Tagen Erholung zu Hause und der Einnahme des Medikamentes „Floradix“ sei sie anschließend langsam wieder zu Kräften gekommen.
Ihre Behandlung durch die Beklagten sei vor diesem Hintergrund insgesamt fehlerhaft gewesen. Ihr kämen daher Schadensersatzansprüche sowohl aus eigenem als auch aus abgetretenem Recht ihres Ehemannes zu.
Der mit den Beklagten abgeschlossene Behandlungsvertrag, in den auch ihr Ehemann einbezogen gewesen sei, habe u.a. auch die Verhütung von Schwangerschaften zum Gegenstand gehabt. Den Beklagten sei dabei positiv bekannt gewesen, dass sie und ihr Ehemann ihre Familienplanung zum damaligen Zeitpunkt definitiv abgeschlossen hätten.
Sie – die Klägerin – sei nicht ordnungsgemäß über die Bedeutung und die Risiken des Ergebnisses des AMH-Tests – den Wert von 0,37 ng/ml – aufgeklärt worden. Die Beklagten selbst hätten mit ihr zu keinem Zeitpunkt über das Ergebnis gesprochen, so dass sie über die Bedeutung des Wertes von 0,37 ng/ml bei dem AMH-Test letztlich falsch beraten bzw. aufgeklärt worden sei. Die Mitarbeiterin der Beklagten, an deren Namen sie sich nicht mehr erinnere, habe ihr vielmehr eindeutig zu verstehen gegeben, dass sie bei dem ermittelten Wert die Antibabypille nicht mehr einzunehmen brauche. Zum damaligen Zeitpunkt sei sie auch zu Recht davon ausgegangen, dass eine Weitergabe solcher Hinweise durch eine Mitarbeiterin der Beklagten in Ordnung (gewesen) sei, da sie zuvor auch schon Informationen von den Mitarbeiterinnen erhalten habe.
Der Beklagte zu 3) selbst habe sie zudem im Termin vom 16.04.2012 falsch behandelt. Obwohl sie ihn zu Beginn der Behandlung darüber informiert habe, dass sie die Antibabypille seit längerem nicht mehr einnehme und seit Ende März keine Regelblutung mehr gehabt habe, also eindeutige Anhaltspunkte für eine mögliche Schwangerschaft vorgelegen hätten, habe es der Beklagte zu 3) dennoch unterlassen, einen Schwangerschaftstest bei ihr durchzuführen. Wäre aber bereits zu diesem Zeitpunkt die Schwangerschaft bei ihr festgestellt worden, hätte sie sich noch für eine legale Abtreibung entscheiden können. Dies sei ihr hier jedoch aufgrund des Fehlverhaltens des Beklagten zu 3) verwehrt geblieben.
Unter den Folgen der demnach insgesamt fehlerhaften Behandlung durch die Beklagten habe sie schließlich erheblich zu leiden (gehabt).
Sie sei aufgrund ihres Alters mit dem Austragen und der Geburt mehr als üblich belastet gewesen. Es seien deshalb auch oft ärztliche Untersuchungen notwendig gewesen.
Die Einleitung der Geburt zu dem gewählten Zeitpunkt sei hier zudem durch ihr Alter bedingt worden und wäre bei einer normal verlaufenden Schwangerschaft zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig gewesen. Gleiches gelte für die folgende Operation, die allein auf der vorhergehenden Geburt beruhe.
Insgesamt sei sie damit Gesundheitsgefahren und Schmerzen ausgesetzt gewesen, die über die bei einer normalen Geburt weit hinausgegangen seien.
Die Beklagten seien ihr somit sowohl zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von mindestens 50.000,00 EUR sowie zum Ersatz des Unterhalts für ihren Sohn N. bis zum Ende der Volljährigkeit verpflichtet, der sich zunächst für die Zeit von Januar 2013 bis Februar 2014 mit zusammen 8.972,60 EUR beziffern lasse.
Die Klägerin beantragt, die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie
1. einen Betrag in Höhe von 8.972,60 EUR für den zurückliegenden Zeitraum Januar 2013 bis einschließlich Februar 2014 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit,
2. weiterhin bis zum Eintritt der Volljährigkeit ihres Sohnes im Dezember 2030 monatlich im Voraus einen Betrag in Höhe von 270% des Mindestunterhaltes für minderjährige Kinder gemäß § 1612a BGB i.V.m. § 32 Abs. 6 EStG der ersten Altersstufe für den Zeitraum März 2014 bis November 2018, der zweiten Altersstufe für den Zeitraum Dezember 2018 bis November 2024 und der dritten Altersstufe ab Dezember 2024 jeweils abzüglich des gezahlten Kindergeldes für den Sohn N. als Viertgeborenen, derzeit 215,00 EUR, sowie
3. ein angemessenes Schmerzensgeld, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, jedoch 50.000,00 EUR nicht unterschreiten sollte, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 11.05.2013
zu zahlen.
Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen.
Sie behaupten, die Beklagten zu 4) und 5) hätten die Klägerin zu keinem Zeitpunkt behandelt. Mit ihnen sei daher auch kein Behandlungsvertrag zustande gekommen, so dass sie schon nicht passivlegitimiert seien. Eine Haftung nach den Grundsätzen der Rechtsscheinshaftung einer Gemeinschaftspraxis komme dabei schon deshalb nicht in Betracht, weil sie zum Zeitpunkt der behaupteten Fehlbehandlung auch in der Außendarstellung der Gemeinschaftspraxis (noch) nicht als Gesellschafterinnen ausgewiesen gewesen seien.
In der Sache habe die Klägerin erstmals am 23.02.2012 ein Gespräch mit dem Beklagten zu 3) über den sog. Anti-Müller-Hormontest geführt. Sie sei dabei über diesen Test und über die Grenzen der Verhütung mit dieser Methode, d.h. insbesondere darüber aufgeklärt worden, dass der Eintritt einer Schwangerschaft auch bei einem niedrigen AMH-Wert nicht sicher ausgeschlossen werden könne. Ihr sei daher auch mitgeteilt worden, dass sie altersgemäß noch verhüten müsse. Die Klägerin habe anschließend gleichwohl eine entsprechende Untersuchung gewünscht.
Am 16.04.2012 sei danach der AMH-Wert von 0,37 ng/ml mit der Klägerin besprochen worden. Der Beklagte zu 3) habe ihr mitgeteilt, dass der Wert eine bei ihr nachlassende ovarielle Reserve zeige, diese jedoch noch nicht signifikant sei und zur Verhütung einer Schwangerschaft eine weitere Verhütung z.B. mit oralen Kontrazeptiva notwendig sei. Da die Verordnung einer Antibabypille zuvor letztmalig am 23.02.2012 erfolgt sei, sei die Klägerin zudem auch deshalb darüber aufgeklärt worden, dass eine weitere Verhütung nach wie vor erforderlich sei.
Sie – die Klägerin – habe anschließend erneut (nur) auf die bereits am 18.10.2011 gesicherte Zyklusstörung hingewiesen. Die folgende Routine-Krebsvorsorge und Ultraschalluntersuchung sei dann ohne Auffälligkeiten, insbesondere ohne Hinweise auf das Bestehen einer Schwangerschaft, geblieben.
Die nach Feststellung der Schwangerschaft noch durchgeführte Fruchtwasserpunktion sei ferner nicht zwingend indiziert gewesen, sondern habe vielmehr eine reine Wunschleistung der Klägerin dargestellt.
Die Klägerin sei vor diesem Hintergrund insgesamt nach dem fachärztlichen Standard behandelt worden.
Die Familienplanung der Klägerin sei zunächst zu keinem Zeitpunkt Gegenstand innerhalb der Sprechstunde gewesen. Die Klägerin sei zudem fachgerecht über den Anti-Müller-Hormontest und dessen Grenzen aufgeklärt und dabei insbesondere darauf hingewiesen worden, dass sie noch weiterhin verhüten müsse. Auskünfte u.a. zu dieser Frage seien dann jedenfalls seit Einführung des Qualitätsmanagements im Jahr 2010 auch nicht (mehr) von Mitarbeiterinnen erteilt worden.
Bei dieser Sachlage habe die Klägerin die Pille demnach eigenmächtig und ohne ärztlichen Rat abgesetzt, was jedenfalls ein erhebliches Mitverschulden an dem Eintritt der Schwangerschaft begründe. Ihr als Mutter und langjähriger Nutzerin einer Antibabypille sei auch bekannt gewesen, dass es eine hundertprozentige Sicherheit innerhalb einer Verhütung nicht gebe. Sie habe die Entnahme des AMH daher auch nur zur Abschätzung des weiteren Konzeptionsrisikos bzw. als Entscheidungshilfe gewünscht, so dass es sich bei der Bestimmung des AMH gerade nicht um eine Verhütungsmethode gehandelt habe.
Ansprüche auf Schadensersatz kämen der Klägerin mithin insgesamt nicht zu, zumal die Abtretungserklärung ihres Ehemannes auch noch zu unbestimmt sei.
Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des Sachverständigen Prof. Dr. U.. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Gutachten vom 19.08.2016 (Bl. 123ff d.A.) Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die Klage ist unbegründet.
Die Klägerin hat gegen die Beklagten keinen Anspruch auf Schadensersatz aus den §§ 280 I, 253 II, 421, 398 BGB oder den §§ 823 I, 31, 840, 253 II, 398 BGB. Den ihr obliegenden Beweis, in der Praxis der Beklagten zu 1) und/oder von den Beklagten zu 2) bis 5) fehlerhaft behandelt worden zu sein, hat sie nicht geführt.
Schadensersatz wegen eines Behandlungsfehlers kann von einem Arzt nur verlangt werden, wenn bei der Behandlung des Patienten gegen den im konkreten Einzelfall anzuwendenden medizinischen Standard verstoßen worden ist. An dieser Voraussetzung aber fehlt es hier.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme und dem Gesamtbild des Parteivorbringens kann die Kammer keine Fehler der Beklagten feststellen.
Der Sachverständige hat dargelegt, dass die Klägerin als seinerzeit 45-jährige IV-Gravida, Ill-Para am Termin von einem 3.860 g schweren Knaben entbunden worden sei.
Die Klägerin sei Patientin in der Gemeinschaftspraxis der Beklagten gewesen. Ihr behandelnder Frauenarzt sei der Beklagte zu 3) gewesen. Der Ausdruck der digitalen Krankenakte belege, dass die Klägerin seit dem 30.03.2006 regelmäßig die Praxis der Beklagten zu 1) aufgesucht habe, überwiegend zur Kontrazeptionsbehandlung und Krebsfrüherkennungsuntersuchung. Verordnet worden sei zunächst das Präparat Microgynon 21, ab September 2010 Minisiston 6 x 21 und ab März 2011 N. 3 x 21.
Am 23.02.2012 sei vermerkt, dass die Klägerin eine Laboruntersuchung zur Bestimmung des Spiegels des sogenannten Anti-Müller-Hormons zur Abschätzung des weiteren Konzeptionsrisikos gewünscht habe bzw., so heiße es weiter, zur Entscheidungshilfe. Am 05.03.2012 habe der Befund aus dem Labor Krone einen Anti-Müller-Hormonspiegel von 0,37 ng/ml ergeben.
Die nächste Konsultation habe am 16.04.2012 stattgefunden. Es sei eine Krebsfrüherkennungsuntersuchung durchgeführt worden sowie eine Sonographie. Es habe sich um eine Routinevorsorge gehandelt, Beschwerden seien nicht berichtet worden. Weiterhin sei dokumentiert:
„Zyklus unregelmäßig. Gespräch wg. AMH-Bestimmung. Nachlassende ovarielle Reserve, jedoch noch nicht signifikant“ Gespräch weitere Verhütung. S. Pillenverordnung im Febr., weitere Konzeption z.B. mit OC notwendig. Laborchem. nachlassende ovarielle Reserve, aber noch Kontra notwendig.“
Es liege eine Sonographie vom 16.04.2012 vor, welche, mit dem Namen der Klägerin versehen, einen Längs- und einen Querschnitt durch den Uterus zeige. Hinweise auf eine Schwangerschaft fänden sich auf diesen Bildern nicht. Die Schleimhaut sei mäßig proliferiert.
Vier Monate später habe sich die Klägerin am 13.08.2012 erneut bei dem Beklagten zu 2) vorgestellt. Dieser habe notiert:
„Hatte im März die letzte Regelblutung. Spürt evtl. Kindsbewegungen.“
Eine Ultraschalluntersuchung habe eine intakte Einlingsschwangerschaft nach Fetometrie entsprechend einem Schwangerschaftsalter von 21 Wochen und 4 Tagen ergeben.
Nach im wesentlichen unauffälligem Schwangerschaftsverlauf sei es schließlich am 22.12.2012 zur Spontangeburt eines Knaben gekommen.
Die Behandlung der Klägerin durch die Beklagten sei vor diesem Hintergrund wie folgt zu beurteilen:
Die Klägerin habe sich über Jahre verschiedener hormonaler Kontrazeptiva bedient, die sie sich in der Einrichtung der Beklagten zu 1) bis 5) habe verschreiben lassen. Die letzte Verschreibung habe am 23.02.2012 in Gestalt einer Packung Maxime N1 für einen Zyklus stattgefunden. Am selben Tage habe sie im Sinne einer individuellen Gesundheitsleistung die Bestimmung des Spiegels des Anti-Müller-Hormons zur Abschätzung des weiteren Konzeptionsrisikos erbeten. Die Untersuchung habe dann im Ergebnis von 0,37 ng/ml keineswegs angezeigt, dass die Klägerin nunmehr mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht mehr schwanger werden könne.
Über dieses Ergebnis, welches am 05.03.2012 vorgelegen habe, sei die Klägerin laut Dokumentation am 16.04.2012 aufgeklärt worden. Ihr sei mitgeteilt worden, dass es sich um eine nachlassende ovarielle Reserve handele, dieser Befund jedoch nicht signifikant sei und eine weitere Verhütung für erforderlich gehalten werde.
Hinsichtlich der Zyklusanamnese sei zu diesem Termin, an dem eine Krebsvorsorgeuntersuchung durchgeführt worden sei, lediglich vermerkt, dass der Zyklus unregelmäßig sei, die Klägerin keine Beschwerden habe, und es sich um eine Routinevorsorge handele, in deren Rahmen auch eine Sonographie vorgenommen worden sei. Die sonographischen Querschnittsbilder des Uterus ließen keinen Hinweis auf eine Schwangerschaft erkennen.
Gleichwohl sei am 13.08.2012 aufgrund des Eindruckes von Kindsbewegungen eine Schwangerschaft entsprechend einem Alter von 21 + 4 Wochen festgestellt worden. Die letzte Regelblutung habe aufgrund der an diesem Tage erhobenen Anamnese am 15.03.2012 stattgefunden, so dass errechnet werden könne, dass sich die Klägerin am 16.04.2012 in einem Schwangerschaftsalter von 4 Wochen und 5 Tagen befunden haben müsse. Sie habe mithin – einen streng 28-tägigen Zyklus unterstellt – den Tag der zu erwartenden nächsten Regelblutung gerade um 5 Tage überschritten.
Damit habe sich die Klägerin zu diesem Zeitpunkt in einem Schwangerschaftsalter befunden, in dem die einzig sichere Nachweismethode ein HCG-Bluttest gewesen wäre, den durchzuführen allerdings einer Indikation bedurft hätte. Andere Hinweise auf eine Schwangerschaft außer einer 5-tägigen Überschreitung eines 28-tägigen Zyklus, der im übrigen nach der Anamnese gar nicht bestanden habe, es habe sich um unregelmäßige Blutungen gehandelt, hätten sich weder aus der Vorgeschichte, noch aus dem erhobenen Befund ergeben.
Eine Veranlassung, einen Schwangerschaftstest durchzuführen, hätte (nur) der Wunsch der Klägerin dargestellt, trotz der genannten Unsicherheiten zu diesem Zeitpunkt definitiv wissen zu wollen, ob sie denn schwanger wäre. Für den Beklagten zu 3) habe sich aus der in dem Krankenblatt notierten Befundkonstellation die Notwendigkeit weiterer Befunderhebungen jedoch nicht ergeben. Auch sei es für ihn nicht geboten gewesen, ohne entsprechenden Auftrag der Klägerin etwa einen Kontrolltermin zum Ausschluss einer Schwangerschaft, an deren Möglichkeit nicht einmal in erster Linie zu denken gewesen sei, zu vereinbaren. Es wäre Sache der Klägerin gewesen, bei fortbestehender Amenorrhoe diese Überprüfung im Rahmen einer erneuten Vorstellung zu veranlassen. Nur der Klägerin habe bekannt sein können, dass sie das Kontrazeptivum abgesetzt habe, und im übrigen auch die Möglichkeit des Entstehens einer Schwangerschaft zu berücksichtigen gewesen sei. Ohne dass diese Informationen dem Beklagten zu 3) zuteil geworden wären, sei dieser nicht ausreichend informiert gewesen, um von sich aus insbesondere nach der Möglichkeit einer Schwangerschaft zu fragen und entsprechende Befunde zu erheben. Dies gelte umso mehr, als ein Blick in seine eigenen Aufzeichnungen geeignet gewesen sei festzustellen, dass am 23.02.2012 er noch eine ganze Monatspackung eines Kontrazeptivums verordnet habe, von deren ordnungsgemäßer Einnahme er ohne entsprechenden Hinweis durch die Klägerin habe ausgehen dürfen. Hätte die Klägerin nämlich, wie dies sich dem Beklagten zu 3) habe darstellen müssen, das Kontrazeptivum am oder kurz nach dem 23.02.2012 ordnungsgemäß eingenommen, so wäre sie über den 20.03.2012 hinaus noch ausreichend kontrazeptiv geschützt gewesen. In jedem Falle hätte dann, eine ordnungsgemäße Einnahme vorausgesetzt, am 28./30.03.2012 eine Schwangerschaft eintreten können, wobei es als wahrscheinlich angesehen werden müsse, dass nach Absetzen des hormonellen Kontrazeptivums es zu einer Eireifung und Ovulation vor Ablauf von 12 bis 14 Tagen komme.
Damit sei nicht erkennbar, dass, den Inhalt der ärztlichen Aufzeichnungen als Tatsache vorausgesetzt, einer der Beklagten seine ärztlichen Pflichten gegenüber der Klägerin in dem streitgegenständlichen Behandlungszeitraum verletzt hätte.
Ginge man entgegen dem Inhalt der Dokumentation allerdings davon aus, dass die Klägerin den Beklagten zu 3) am 16.04.2012 expressis verbis darauf aufmerksam gemacht hätte, dass sie die verordnete Medikation nicht mehr eingenommen habe und befürchte schwanger zu sein, und hätte der Beklagte zu 3) im Wissen um diese Umstände keine entsprechenden weiteren Untersuchungen oder Kontrolltermine veranlasst, wäre er den Pflichten eines sorgfältig arbeitenden niedergelassenen Frauenarztes nicht ausreichend nachgekommen.
Die durch die Behandlung der Klägerin aufgeworfenen Fragen seien demnach wie folgt zu beantworten:
Die Klägerin habe den Beklagten zu 3) am 16.04.2012 zur Krebsfrüherkennungsuntersuchung aufgesucht. Zugleich habe der Beklagte zu 3) die Klägerin über das Ergebnis und die Bedeutung, sowie auch über die aus dem ermittelten Serumspiegel des Anti-Müller- Hormons zu ziehenden Konsequenzen informiert. Im Rahmen der allgemeinen Anamnese sei er von einem unregelmäßigen Zyklus ausgegangen. Aufgrund eigener Eintragungen und der rezenten Verordnung einer Monatspackung eines hormonalen Kontrazeptivums habe er, soweit er nicht ausdrücklich von der Klägerin anders unterrichtet worden sei, davon ausgehen können, dass diese bis etwa zum 16.03. ein Kontrazeptivum eingenommen habe. Weder die vollständig und ausreichend erhobenen Befunde, insbesondere die Sonographie, noch die Anamnese hätten daher einen Hinweis auf eine Schwangerschaft ergeben, dem durch weitere Befunderhebungen nachzugehen gewesen sei.
Allenfalls dann wären solche weiteren Untersuchungen, etwa die Bestimmung der HCG-Konzentration im Blut oder die Vereinbarung eines kurzfristigen Kontrolltermins geboten gewesen, wenn dem Beklagten zu 3) durch die Klägerin zur Kenntnis gebracht worden wäre, dass diese das verordnete Kontrazeptivum gar nicht angewendet habe bzw. dass auch eine entsprechende Exposition, die zu einer Schwangerschaft hätte führen können, ungeachtet des in dieser Hinsicht ungeschützten Zyklus stattgefunden habe. In diesem Fall hätte der Beklagte zu 3) sie beraten und ggf. einen Kontrolltermin nach einer Woche vereinbaren müssen.
In der Tat habe am 16.04.2012 mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit bereits die klagegegenständliche Schwangerschaft bestanden, diese dürfte rechnerisch um den 29.03. entstanden sein und habe am 16.04.2012 mit 2 Wochen und 4 Tagen post conceptionem bzw. 4 Wochen und 4 Tagen post menstruationem datiert. Da der Beginn der Einnahme von N., wie auch die Einnahme selbst, nicht bekannt seien, müsse gefolgert werden, dass die Klägerin das ihr verordnete Präparat möglicherweise nicht eingenommen oder nach dem 16.03. keine Empfängnisverhütung betrieben habe.
Ein Behandlungsfehler werde schließlich nicht erkannt.
Die Kammer folgt den überzeugenden Feststellungen des Sachverständigen, an dessen Sachkunde nicht zu zweifeln ist. Prof. Dr. U. hat seinem Gutachten alle vorhandenen Krankenunterlagen einschließlich der Ergebnisse bildgebender Untersuchungsverfahren zugrunde gelegt. Aus den damit vollständig ermittelten Befund- und Anknüpfungstatsachen hat er unter verständiger Darlegung der medizinisch-gynäkologischen Vorgaben in jeder Hinsicht nachvollziehbare und widerspruchsfreie Schlussfolgerungen gezogen.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme war die Behandlung der Klägerin in der Praxis der Beklagten mithin nur dann fehlerhaft, wenn die Klägerin den Beklagten zu 3) am 16.04.2012 expressis verbis auf die Möglichkeit einer Schwangerschaft aufmerksam gemacht hätte. Zu eigenständigen Nachfragen war der Beklagte zu 3) demgegenüber mangels jeden Hinweises auf eine Schwangerschaft nicht verpflichtet.
Die Kammer vermag indes nicht festzustellen, dass die Klägerin dem Beklagten zu 3) einen entsprechenden Hinweis erteilt hätte. Die Klägerin hat im Rahmen ihrer Anhörung (lediglich) angegeben, dem Arzt am 16.04.2012 gesagt zu haben, dass sie das Ergebnis des AMH-Testes bereits erhalten und seitdem nichts mehr gemacht habe. Diese Angabe aber steht sowohl im Gegensatz zu der Dokumentation der Beklagten als auch zu der Darlegung des Beklagten zu 3), dass am 16.04.2012 jeder Hinweis auf eine Schwangerschaft der Klägerin gefehlt habe. Bei dieser Sachlage kann die Kammer schon deshalb nicht die ausreichend sichere Überzeugung einer entsprechenden Erklärung der Klägerin gewinnen, weil jeder Anhaltspunkt dafür fehlt, dass die Angaben und die Dokumentation des Beklagten zu 3) falsch sein könnten.
Die von der auch insoweit beweisbelasteten Klägerin weiter behauptete – und nach den Feststellungen des Sachverständigen sicher fehlerhafte – Erklärung einer Mitarbeiterin der Beklagten vom 09.03.2012, eine weitere Verhütung sei aufgrund des geringen AMH-Wertes nicht (mehr) notwendig, hat die Klägerin schließlich ebenfalls nicht zur Überzeugung der Kammer darlegen können.
Ihre Angabe, eine ihr namentlich nicht mehr erinnerliche Mitarbeiterin der Beklagten habe ihr am 09.03.2012 am Telefon mitgeteilt, dass sie aufgrund des Ergebnisses des AMH-Testes nichts mehr zu machen brauche, steht wiederum in Widerspruch zur Dokumentation der Beklagten als auch zu den Erläuterungen des Beklagten zu 3). Dass in diesem Punkt allein die Erklärung der Klägerin richtig ist, vermag die Kammer angesichts der nachvollziehbaren und plausiblen Erklärungen des Beklagten zu 3), dass die Befragung aller in Frage kommenden Mitarbeiterinnen keinen Anhalt für ein solches Telefonat ergeben habe, dass auch jede Dokumentation darüber fehle und die Bekanntgabe von Testergebnissen ohnehin den Ärzten vorbehalten sei, erneut nicht festzustellen.
Die Beklagten waren schließlich nicht verpflichtet, der Klägerin für ihre Beweisführung eine vollständige Liste aller in der Praxis der Beklagten beschäftigten Personen auszuhändigen.
Die – von der Klägerin allein verlangte – Auflage an die Beklagten war schon deshalb nicht geboten, weil für die vorgetragene Fallkonstellation prozessual die Regelung des § 286 ZPO und die Regeln der Beweisvereitelung einschlägig sind.
Nach § 286 ZPO hat als Grundlage der Beweiswürdigung der gesamte Inhalt der Verhandlung zu dienen. Das Gericht hat daher auch die Handlungen, Erklärungen und Unterlassungen einer Partei nach seiner freien Überzeugung zu würdigen, namentlich auch die Verweigerung einer Antwort oder Auskunft sowie die Vorenthaltung von Beweismitteln. Entsprechend diesen Grundsätzen kann der Richter aus der Weigerung der nicht beweispflichtigen Partei, den nur ihr, nicht aber dem Beweisführer bekannten Namen eines Zeugen mitzuteilen, in freier Würdigung Schlüsse zum Nachteil der Partei ziehen, auch wenn diese zur Vorlage gesetzlich nicht verpflichtet ist (vgl. BGH, NJW 1960, 821; NJW 2008, 982, 984).
Eine Beweisvereitelung setzt allerdings weiter voraus, dass die Partei ihrem beweispflichtigen Gegner die Beweisführung schuldhaft erschwert oder unmöglich macht. Das Verschulden muss sich dabei sowohl auf die Zerstörung oder Entziehung des Beweisobjektes als auch auf die Beseitigung seiner Beweisfunktion beziehen, also darauf, die Beweislage des Gegners in einem gegenwärtigen oder künftigen Prozess nachteilig zu beeinflussen (vgl. BGH, NJW 2008, 982, 985).
Nach diesen Maßstäben kann hier von einer den Beklagten vorwerfbaren Beweisvereitelung nicht die Rede sein. Zum einen ist den Beklagten der Name der vermeintlichen Mitarbeiterin, die das Telefonat am 09.03.2012 geführt haben soll, selbst nicht bekannt. Zum anderen ist die Klägerin hier nur deshalb in (scheinbarer) Beweisnot, weil sie sich damals den Namen ihrer Gesprächspartnerin nicht notiert hat. Diese eigene Nachlässigkeit kann sie indes nicht über die Regeln der – insoweit nicht einschlägigen – Beweisvereitelung korrigieren.
Es kommt hinzu, dass auch durchgreifende Zweifel an dem notwendigen Verschulden der Beklagten bestehen. Sie wollen immerhin sämtliche Mitarbeiterinnen (wenn auch ergebnislos) nach dem behaupteten Telefonat befragt haben. Die dabei gewählte Vorgehensweise hat der Beklagte zu 3) bei seiner persönlichen Anhörung anschaulich geschildert. Selbst die Klägerin geht im übrigen davon aus, dass sich die betreffende Mitarbeiterin an das (behauptete) Telefonat nicht mehr wird erinnern können, so dass die Beklagten ihr hier schließlich allenfalls ein unergiebiges Beweismittel vorenthalten haben. Einen der Klägerin möglichen Beweis haben sie damit jedoch keinesfalls vereitelt, was hier eine Umkehr der Beweislast ausschließt.
Die Klage hatte nach all dem unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt Erfolg.
Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 91 I, 709 ZPO.