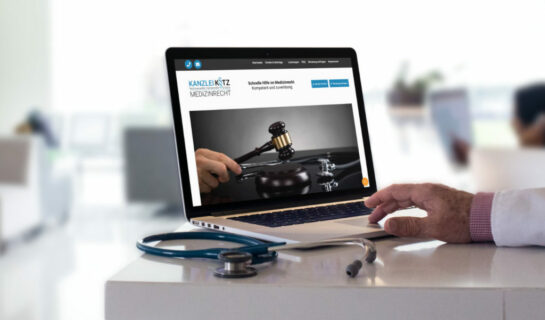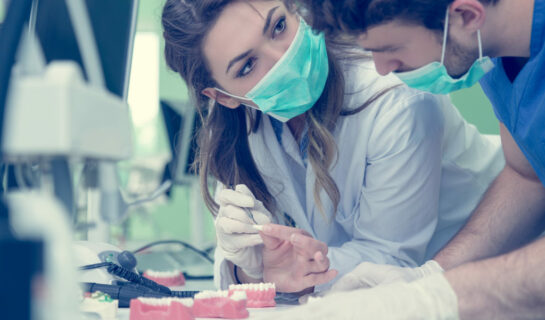LG Nürnberg-Fürth – Az.: 4 O 11065/06 – Urteil vom 07.04.2011
I. Der Beklagte zu 2) wird verurteilt, an die Klägerin ein Schmerzensgeld in Höhe von 500 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 08.08.2005 sowie 157,68 € vorgerichtliche, nicht anrechenbare Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 12.07.2007 zu zahlen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Beklagten zu 1) und 2) jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
Der Beklagte zu 2) kann die Vollstreckung durch die Klägerin durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Tatbestand
Die Klägerin begehrt Schadensersatz und Schmerzensgeld unter Geltendmachung ärztlicher Behandlungsfehler.
Die am 30.12.1978 geborene Klägerin litt unter einer tiefen asymmetrischen Trichterbrust rechtsseitig und einer Torsionsskoliose. Im Alter von 17 Jahren hatte die Klägerin bereits ein Mammaimplantat über dem Brustmuskel der rechten Brust erhalten. Sie begab sich zur Behandlung der Trichterbrust in die Kinderchirurgie der Beklagten zu 1) als Rechtsnachfolgerin des F B, deren Chefarzt der Beklagte zu 2) war.
Die Klägerin schloss am 10.03.2003 und 05.08.2003 jeweils einen sogenannten gespaltenen Krankenhausaufnahmevertrag mit der Beklagten zu 1) ab. In diesem wird unter der Überschrift „Wahlärztliche Leistungen/Haftungsausschluss“ bestimmt:
„Bei Inanspruchnahme wahlärztlicher Leistungen (…) sind die ärztlichen Leistungen nicht Gegenstand des Vertrages mit dem Träger der Klinik.
Der F B als Träger der Klinik ist lediglich Vertragspartner für die Unterbringung, Verpflegung und pflegerische Betreuung. Vertragspartner für ärztliche Leistungen sind nur die liquidationsberechtigten Ärzte. Der F B haftet daher nicht für Fehler des privatliquidierenden Arztes (weder vertraglich noch deliktisch). Für Fehler der von diesem persönlich geschuldeten ärztlichen Leistungen haftet allein der liquidationsberechtigte Arzt. Dies gilt auch für Fehler von Hilfspersonen (beispielsweise nachgeordneter oder konsiliarisch hinzugezogener Ärzte), derer er sich zur Erfüllung seiner persönlich geschuldeten ärztlichen Leistungen bedient.“
Am 11.03.2003 erfolgte die Operation der Klägerin nach der sogenannten „Erlanger Methode“ durch den Beklagten zu 2).
Nach der Operation wurde die Klägerin auf die Normalstation zur weiteren Behandlung verlegt.
Am 25.03.2003 erfolgte aufgrund starker Schmerzen der Klägerin eine Kürzung des bei der Operation am 11.03.2003 eingebrachten Bügels.
Am 16.03.2003 wurde zur Behandlung eines Pleuraergusses eine Bülau-Drainage eingebracht.
Auf Anraten des Beklagten zu 2) erfolgte durch einen Anästhesisten der Beklagten zu 1) am 27.03.2003 ein schmerztherapeutischer Eingriff, bei welchem ein Neuralanästhetikum durch die Brust eingebracht wurde.
Die Klägerin wurde am 28.03.2003 aus der stationären Behandlung entlassen.
Am 20.05.2003 suchte die Klägerin konsiliarisch Prof. Di der Thoraxklinik H auf, welcher neben der Steigerung der Schmerzmedikation die Entfernung des Bügels in drei Monaten empfahl.
Der von der Klägerin am 16.07.2003 aufgesuchte Prof. S, Universitätsklinikum M, riet zu einer vorzeitigen Entfernung des Bügels.
Am 06.08.2003 erfolgte auch auf Drängen der Klägerin aufgrund der vorgenannten Konsultationen bei der Beklagten zu 1) durch den Beklagten zu 2) die operative Entfernung des eingebrachten Bügels wegen der anhaltenden Schmerzen der Klägerin.
Die Klägerin behauptet folgende Behandlungs- und Aufklärungsfehler (Beklagtenvorbringen und Entscheidungsgründe orientieren sich an nachfolgender Gliederung):
1. Die Anwendung der „Erlanger Methode“ sei fehlerhaft gewesen, da diese nicht zur Behandlung der bei der Klägerin vorhandenen extrem asymmetrischen Trichterbrust geeignet gewesen sei. Der Fehler wäre bei sorgfältiger Anamnese zu verhindern gewesen. Durch die falsche Operationsmethode hätten sich nach Entfernung des Bügels schließlich Pseudarthrosen gebildet.
Der kleine „Erlanger Bügel“ sei bei der asymmetrischen Trichterbrust der Klägerin nicht geeignet gewesen. Insbesondere sei er zu schwach, um dem großen Druck und der starken Beanspruchung standzuhalten. Ein zweiter Bügel wäre daher erforderlich gewesen.
Ein grober Behandlungsfehler liege vor.
2. Die Klägerin sei vorher nicht über geeignetere Methoden aufgeklärt worden, ebenso nicht über die Gefahr einer Pseudarthrosebildung.
Wäre die Klägerin vorher über die Vor- und Nachteile verschiedener Methoden, insbesondere der nach Nuss informiert worden, so hätte sie sich nicht für das Erlanger Verfahren entschieden.
3. Der im Rahmen der „Erlanger Methode“ am 11.03.2003 eingebrachte Metallbügel sei zu lang gewesen. Der Bügel sei in der Länge nicht auf die Klägerin abgestimmt gewesen. Bei richtiger Wahl hätten die diversen Folgeoperationen und -behandlungen sowie die Schmerzen verhindert werden können.
4. Bei der Operation am 11.03.2003 sei die rechte Lunge behandlungsfehlerhaft verletzt worden. Es habe sich ein Pneumothorax und ein Pleuraerguss gebildet. Unmittelbar nach der Operation seien dunkelblaue Flecken zwischen Schulter und Brust sichtbar geworden. Die Klägerin habe nach dem Erwachen aus der Narkose stärkste Schmerzen und Atembeschwerden gehabt.
5. Trotz der starken Schmerzen sei die Klägerin auf die Kindernormalstation verlegt worden. Die Schwestern hätten sich deshalb nicht wie erforderlich um die Klägerin kümmern können. Nachts hätte es lange gedauert, bis Hilfe kam, da die eine diensthabende Schwester jeweils Hilfe auf der Nachbarstation anfordern musste. So hätte die Klägerin einmal fast Erbrochenes eingeatmet. Sie habe Ängste erlitten.
6. Die Überwachung des eingetretenen Pneumothorax/Pleuraerguss sei fehlerhaft erfolgt. Röntgenkontrollen seien verspätet und nicht in geeigneter Weise, nämlich an der liegenden Patientin erfolgt. Auch sei der Pneumothorax/Pleuraerguss z.B. durch Abhören der Lunge nicht ausreichend überwacht worden. Am 12. und 13.03.2003 sei die Klägerin trotz zunehmender Schmerzen nicht geröntgt worden.
Der Vater der Klägerin – selbst Allgemeinarzt – habe dann am 14.03.2003 mit einem geliehenen Stethoskop die unterlassene Untersuchung selbst durchgeführt. Er sei aber darüber aufgeklärt worden, dass die Rückbildung des Ergusses bei intakter Atemfunktion abgewartet werden sollte. Fehlerhaft sei dabei aber nicht berücksichtigt worden, dass eine ausreichende Atemfunktion wegen fehlerhafter PDA (unten Ziff. 7) nicht vorlag.
Am 16.03.2003 sei es dann zu einer Einlage einer Bülau-Drainage gekommen. Dieser Eingriff hätte bei einer rechtzeitigen medikamentösen Behandlung verhindert werden können.
Durch die aufgrund der verzögerten Behandlung ermöglichte größere Flüssigkeitsansammlung sei es durch den Eiweißanteil des Ergusses zu Verklebungen der Lunge gekommen, welche das Dehnpotential der Lunge nachhaltig eingeschränkt hätten.
7. Der für die Operation am 11.03.2003 angelegte Katheder der Peridural-Anästhesie (PDA) sei an der falschen Stelle gesetzt worden. Nach dem Erwachen aus der Narkose und dem Nachlassen der operationsbedingten Schmerzmittel habe die Klägerin daher unter sehr starken Schmerzen gelitten, die nur eine flache Atmung ermöglicht hätten. Dies habe auch Folgen für die Ergussbildung gehabt.
Nach dem fehlgeschlagenen Versuch einer Korrektur der Kathederlage habe die Klägerin am 14.03.2003 eine PCA-Pumpe (Schmerzmittelpumpe) erhalten. Sie habe hierdurch unter Übelkeit, Kopfschmerzen, aber keiner wesentlichen Schmerzlinderung gelitten, worauf die Ärzte der Beklagten auch hingewiesen wurden.
8. Vor Anlage der Bülau-Drainage am 16.03.2003 sei die PCA-Pumpe bei Abholung auf der Kinderstation abgestellt und während der Wartezeit auf der Kinderintensivstation nicht wieder angestellt worden. Die Batterien der Schmerzpumpe seien nicht geladen gewesen. Es sei hierdurch zu unerträglichen Schmerzen gekommen.
9. Bei der Bügelkürzung am 25.03.2003 sei es durch das Absägen des als zu lang vermuteten Bügels zu scharfen Kanten gekommen, welche noch schlimmere Probleme und Schmerzen an der Rippenhaut verursacht hätten. Die Kürzung sei daher fehlerhaft erfolgt. Das scharfkantige Ende hätte abgefeilt werden müssen.
Folge hiervon sei neben der späteren Bügelentfernungsoperation auch die Erhöhung der Morphindosis gewesen, welche eine lange schmerztherapeutische Betreuung erforderlich machte, jedoch ohne nennenswerten Erfolg.
Der Beklagte habe die Klägerin auch nicht über die Risiken der Bügelkürzung aufgeklärt.
10. Bei dem schmerztherapeutischen Eingriff am 27.03.2003 sei der Anästhesist zwar auf das Mammaimplantat der rechten Brust ausdrücklich durch die Klägerin hingewiesen und zu besonders vorsichtigem Vorgehen ermahnt worden. Eine Aufklärung über das Risiko des Eingriffs sei aber nicht erfolgt. Der Anästhesist habe dennoch mit der Kanüle auch in die rechte Brust gestochen und das Implantat verletzt. Die Klägerin habe sogleich ein Spannungsgefühl und starke Schmerzen erlitten. Der Brustbereich sei angeschwollen und Taubheitsgefühle seien aufgetreten. Der Eingriff habe keine schmerzstillende Wirkung gebracht.
Das Implantat sei dann schließlich am 04.04.2003 ausgelaufen, indem sich massiv Flüssigkeit aus der Narbe entleert habe. Die rechte Brust der Klägerin habe sich daraufhin deutlich verkleinert.
Das leere Implantat habe Falten mit Kanten gebildet, wodurch die Klägerin schließlich weitere Schmerzen erlitten habe.
Am 23.02.2004 habe das Implantat als Folge operativ entfernt werden müssen.
11. Am 28.03.2003 sei die Klägerin dann ohne Abschlussuntersuchung entlassen worden. Auf die den Ärzten bekannten Beschwerden sei nicht eingegangen worden. Der vorhandene massive Erguss sei daher unentdeckt geblieben. Der Zustand der Klägerin zu Hause habe sich verschlechtert. Auf der Heimfahrt habe der Klägerin mehrmals Sauerstoff verabreicht werden müssen.
Am 05.04.2003 habe sich die Klägerin im Krankenhaus M H in D vorgestellt, wo ein massiver Erguss sowie ein Pneumothorax rechts festgestellt worden sei. Am 05.04.2003 und 07.04.2003 wurden Bülau- und Redon-Drainagen eingelegt.
Nach Entlassung aus der stationären Behandlung am 11.04.2003 sei es zu einer leichten Besserung der Beschwerden gekommen, wobei weiterhin stärkste Schmerzen an der rechten Rippe, an welcher der Metallbügel auflag, bestanden hätten.
Am 22.05.2003 sei im B krankenhaus K eine CT-gesteuerte Ergusspunktion vorgenommen worden.
Die Schmerzsymptomatik habe sich an der Stelle verstärkt, an welcher der Bügel am 25.03.2003 gekürzt wurde. Schmerzmittel in großen Mengen und eine Schmerztherapie hätten nicht geholfen. Morphinpflaster kamen dann zum Einsatz.
1. Vor Entfernung des Bügels am 06.08.2003 hätte der Beklagte zu 2) alles versuchen müssen, um den Therapieerfolg herbeizuführen oder zu retten. Wenn der Beklagte zu 2 nun meine, die Schmerzen beruhten nicht auf dem Bügel, insbesondere da sie nicht am Ort des Bügels lokalisiert gewesen seien, sei die Entfernung falsch gewesen.
Die Entfernung des Bügels habe sich zudem verschlimmernd auf die Stabilitätsverhältnisse im Brustkorb ausgewirkt. Bei der Entfernung des Bügels habe sich intraoperativ eine deutliche Eindellung der Rippe an der Auflagestelle des gekürzten Bügels gezeigt.
Es sei schließlich zwar zu einer Besserung der Schmerzsymptomatik gekommen, jedoch auch zu einem kontinuierlichen Einsinken der rechten Brustkorbhälfte. Einfachste Bewegungen hätten der Klägerin Schmerzen verursacht; spürbar sei auch ein Reiben an den operierten Stellen der Rippen am Brustbein geworden, verursacht durch später festgestellte Pseudarthrosen. In diese Pseudarthrosen seien Bindegewebe und Nervengewebe eingewachsen und hätten stärkste Schmerzen verursacht.
Der Beklagte habe mit der Klägerin die Notwendigkeit und Folgen der Bügelentfernung auch nicht besprochen. Die Klägerin sei über die Risiken einer vorzeitigen Bügelentfernung nicht aufgeklärt worden.
Die Klägerin habe sich wegen der Schmerzen, des instabilen Brustkorbes verbunden mit Atemproblematik und Herz-Tachykardien im Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde und Thoraxchirurgie (FLT) in B vorgestellt und sei am 11.08.2004 erneut operiert worden. Dabei sei festgestellt worden, dass die Voroperation keine Korrektur der Trichterbrust habe bewirken können. Bei der schwierigen Operation seien zwei Metallbügel eingesetzt worden. Die Klägerin habe anschließend unter sehr starken Schmerzen gelitten.
Auch habe sich schließlich beim Abbau der Morphinmedikation eine massive Entzugssymptomatik eingestellt.
Die Klägerin habe vermeidbar unerträgliche Schmerzen erlitten, die aufgrund des sog. Schmerzgedächtnisses starke chronische Schmerzen zur Folge gehabt hätten.
Es sei aufgrund der zahlreichen Operationen und der Pseudarthrosen zu einer bleibenden Instabilität des gesamten Thorax gekommen, die Schmerzen hätten sich hierdurch verstärkt. Die Klägerin sei nur eingeschränkt belastungsfähig. Rücken- und Kopfschmerzen bis hin zu Übelkeit hätten sich verschlimmert. Das tägliche Leben sei durch die Schmerzen erheblich eingeschränkt. Es sei unter diesen Umständen auch unmöglich, Kinder zu gebären.
Die Klägerin könne eine Partnerschaft nicht eingehen. Auch ihren ursprünglichen Berufswunsch als Ärztin habe sie aufgeben müssen. Auch im nunmehr aufgenommenen Journalistikstudium habe sie Einschränkungen hinzunehmen. Durch die herabgesetzte Mobilität aufgrund der verursachten Instabilität sei ihr ein freiberufliches Tätigwerden als Journalistin nicht mehr möglich.
Durch die zahlreichen Operationen und Narkosen leide die Klägerin an Müdigkeit, Mattigkeit und Konzentrationsproblemen. Die Herztachykardien nähmen zu, das Lungenvolumen sei eingeschränkt. Weitere Folgeoperationen seien notwendig.
eine 70%ige Behinderung attestiert.
Dies rechtfertige ein Schmerzensgeld in Höhe von 150.000 €, den Ersatz von Arztkosten in Höhe von 4.582,91 €, einen Fahrtkostenersatz von 1.749,50 €, einen Haushaltsführungsschaden in Höhe von 319,98 € monatlich, eine monatliche Rente in Höhe von 12.000 € abzüglich des tatsächlich erzielten Arbeitsentgeltes aufgrund des entgangenen Berufszieles als Ärztin zu sowie den Ersatz der vorgerichtlich entstandenen Rechtsanwaltskosten, wobei eine 2,5-Gebühr angemessen sei.
Die Klägerin ist weiter der Auffassung, dass die Beklagte zu 1) passivlegitimiert ist, da die wahlärztlichen Vereinbarungen unwirksam seien. Vor Vertragsschluss seien keine Informationen über die Kosten solcher Wahlleistungen erteilt worden. Der Bezug in den Vereinbarungen auf die Gebührenordnungen sei nicht ausreichend. Ein Haftungsausschluss sei daher nicht vereinbart worden. Die Unwirksamkeit erfasse auch den Arztzusatzvertrag gemäß § 139 BGB.
Im Übrigen habe die Klägerin den Haftungsausschluss im Vertrag vom 10.03.2003 nicht zur Kenntnis nehmen können. Sie habe das Formular nur auf der zweiten Seite unterschrieben, ausgefüllt habe es die Beklagte zu 1). Von einem Haftungsausschluss sei nicht die Rede gewesen. Die Klägerin sei als gesetzlich Versicherte davon ausgegangen, alle Leistungen aus der Sphäre der Klinik zu erhalten. Sie habe lediglich eine private Zusatzversicherung gehabt. Entsprechend sei der Vertrag am 05.08.2003 geschlossen worden.
Die Klägerin beantragt
I. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin Schmerzensgeld, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, jedoch mindestens einen Betrag von 150.000 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 08.08.2005 zu zahlen.
II. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin Schadensersatz in Höhe von 6.332,41 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
III. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin ab 01.04.2003 eine vierteljährlich vorauszahlbare monatliche Rente in Höhe von 319,98 € jeweils im Voraus zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines Jahres zu bezahlen.
IV. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin den ihr ab 01.01.2014 monatlich entstehenden Schaden in Höhe von 12.000 € netto abzüglich eines von der Klägerin erzielten monatlichen Nettoverdienstes aus eigenem Arbeitseinkommen zu ersetzen.
V. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin sämtliche materiellen Schäden, die aus den Behandlungsfehlern künftig entstehen, zu ersetzen, soweit sie nicht auf Sozialversicherungsträger oder andere Dritte übergehen.
VI. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 9.146,60 € vorgerichtliche Kosten nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.
Die Beklagten beantragen, Klageabweisung.
Die Beklagte zu 1) meint, sie sei nicht passivlegitimiert. Sie hafte weder vertraglich noch deliktisch. Die Klägerin habe als Privatpatientin wahlärztliche Leistungen in Anspruch genommen. Soweit gesetzlich versicherte Personen Leistungen in Anspruch nehmen – wie die Klägerin -, die nicht Gegenstand der gesetzlichen Krankenversicherung sind, handele es sich auch um sog. „Privatpatienten“. Der in den gespaltenen Krankenhausaufnahmeverträgen enthaltene Haftungsausschluss sei formell und inhaltlich wirksam.
Hierdurch seien vertragliche und deliktische Ansprüche gegen den Klinikträger ausgeschlossen. Der Klinikdirektor sowie die Ärzte hafteten für sich alleine.
Selbst im Falle eines Verstoßes gegen die wirtschaftliche Aufklärungspflicht des § 22 BPflV werde der Wahlarzt nicht aus der Haftung entlassen. § 22 BPflV diene dem Schutz, den Patienten vor unerwarteten Risiken zu schützen. Würde der Arzt im Falle eines Verstoßes aus der vertraglichen Haftung entlassen, verkehre sich der Schutzzweck des § 22 BPflV in sein Gegenteil. § 22 BPflV sei im Ergebnis eine preisrechtliche Regelung und breche das Haftungsgefüge nicht auf.
Die Beklagte könne nicht beurteilen, ob die Voraussetzungen des § 22 BPflV eingehalten sind, da deren Einhaltung dem selbstliquidierenden Chefarzt oblägen.
Im Übrigen habe die Klägerin vom Haftungsausschluss Kenntnis nehmen können. Das Vertragsformular bestehe aus einem beidseitig bedruckten Blatt. Es werde die Gelegenheit eingeräumt, den Vertrag zu lesen und die einzelnen Punkte würden erläutert.

Darüber hinaus schließt sich die Beklagte zu 1) dem Vortrag des Beklagten zu 2) an.
Der Beklagte zu 2) behauptet, dass ein behandlungsfehlerhaftes Vorgehen nicht vorliege. Hierzu wird im Einzelnen vorgetragen:
1. Das von dem Beklagten zu 2) angewandte Verfahren der „Erlanger Methode“ sei auch bei asymmetrischer Trichterbrust geeignet gewesen. Die Klägerin gehe zu Unrecht davon aus, dass der Beklagte die Methode nach Ravitch angewendet habe Vielmehr habe er das in Erlangen entwickelte Erlanger Korrekturverfahren mit einer intrasternalen Metallbügelstabilisierung angewendet. Die Rezidivrate liege hier bei 2%, bei anderen Verfahren in Höhe von 20%.
Insbesondere die Methode nach Nuss habe im Falle der Klägerin keine Alternative dargestellt.
2. Die Klägerin sei auch über grundsätzlich in Betracht kommende andere Methoden der Korrekturoperation aufgeklärt worden. Es habe aber keine bessere Alternative zur Erlanger Methode gegeben.
Auch sei die Klägerin über die möglichen Risiken aufgeklärt gewesen.
3. Der der Klägerin eingesetzte Metallbügel sei nicht zu lang gewesen, sondern intraoperativ auf die schlanke Klägerin abgestimmt worden. Im Übrigen seien die bei anderen Methoden verwendeten Bügel, so z. B. nach Nuss, länger und stärker.
Auch sei ein Rippen-Metall-Kontakt Bestandteil der Methode und damit üblich.
4. Die Lunge der Klägerin sei bei der Operation am 11.03.2003 nicht verletzt worden. Pneumothorax und Pleuraerguss seien davon zu unterscheiden und stellten keine Verletzung der Lunge dar.
Bei dem aufgetretenen Pleuraerguss handele es sich um eine nicht seltene und banale Komplikation. Er sei medikamentös nicht zu behandeln, vielmehr werde – je nach Ausmaß – eine Spontanrückbildung abgewartet, oder er müsse, wie im Fall der Klägerin, drainiert werden. Zu Verklebungen der Lunge und einer Beeinträchtigung der Dehnungsfähigkeit sei es nicht gekommen.
Auch der aufgetretene Pneumothorax stelle keine Verletzung der Lunge dar und bedürfe keiner Therapie. Pneumothorax und Pleuraerguss stünden auch nicht in einem ursächlichen Zusammenhang miteinander.
Wegen des bei der Klägerin aufgetretenen Mantel-Pneumothorax und des Pleuraergusses sei eine Bülaudrainage gelegt worden. Die Atmungsmöglichkeit sei schon aufgrund der eingebrachten Drainage nicht eingeschränkt gewesen.
5. Die Verlegung der Klägerin von der Aufwach- auf die Normalstation sei nicht vom Beklagten zu 2), sondern von den Anästhesisten veranlasst worden. Eine Behandlung auf der Intensivstation sei medizinisch nicht veranlasst gewesen.
Soweit Probleme bei der Pflege gerügt werden, betreffe dies nicht den Beklagten zu 2). Notsituationen seien im Übrigen nicht aufgetreten. Lange Wartezeiten seien nicht objektivierbar.
Die Klägerin habe auch nicht über Luftnot und Herzschmerzen geklagt und es sei nicht zu einer Verschlimmerung des Krankheitszustandes gekommen.
6. Die Durchführung der Röntgen- und Ultraschalldiagnostik treffe nicht den Beklagten zu 2). Im Übrigen sei diese Diagnostik jedoch korrekt und zeitgerecht durchgeführt worden. Thoraxröntgenaufnahmen seien am 10., 11., 14., 15., 16., 20., 21. und 23.03.2003 durchgeführt worden. Pneumothorax und Pleuraerguss seien letztlich nicht mehr vorhanden bzw. rückläufig gewesen. Auch wurden am 16., 17., 18., 19. und 22.03.2003 Ultraschalluntersuchungen gefertigt.
Die konkrete Anfertigung der Röntgenaufnahmen entziehe sich der Kenntnis des Beklagten zu 2), sei aber nach seiner Kenntnis auch im Liegen möglich. Insbesondere müsse hierbei der frisch operierte Zustand der Klägerin berücksichtigt werden.
7. Die PDA sei durch die Anästhesisten erfolgt.
9. Die Kürzung des Bügels sei nicht wegen einer primär zu großen Länge, sondern wegen einer möglichen Reizung der Knochenhaut oder eines Interkostalnerves erfolgt. Der Versuch sei indiziert gewesen, da sich in der Vergangenheit die Möglichkeit des Eindringens des eingebogenen Endes des Metallbügels in den Zwischenrippenraum mit der Verursachung von Schmerzen oder einer Nervenreizung gezeigt habe.
Ein Abfeilen des abgezwickten Endes zu einer Rundung sei nicht möglich. Routinemäßig würden nach dem Abzwicken winzige Metallteilchen abgefeilt, um Weichteilreaktionen zu vermeiden. Der Versuch einer Glättung wäre aber eine unsinnige Maßnahme.
An anderer Stelle behauptet der Beklagte dagegen, dass ein Abfeilen immer nach dem Abzwicken mittels Diamantfeile durchgeführt werde.
Zu einer Verschlimmerung der Schmerzen sei es jedoch nicht gekommen, lediglich zu einer Persistenz. Zu einer scharfen Kante sei es nicht gekommen. Der ausbleibende Effekt spreche auch gegen eine Verursachung der Schmerzen durch den Bügel.
Die Klägerin sei mit verminderter Schmerzmedikation entlassen worden.
10. In den schmerztherapeutischen Eingriff vom 27.03.2003 sei der Beklagte nicht einbezogen gewesen. Nicht er, sondern die Schmerzambulanz habe ihn empfohlen. Im Übrigen tritt der Beklagte zu 2) den Behauptungen der Klägerin entgegen.
CT-Aufnahmen vom 10.03.2003 zeigten darüber hinaus, dass das Mammaimplantat schon zu diesem Zeitpunkt Falten aufgewiesen habe, also nicht mehr prall gefüllt gewesen sei. Der Zeitpunkt einer Schädigung des Implantates stehe gerade nicht fest. Gegebenfalls erfolgte die Ruptur des Implantates auch aufgrund Materialermüdung.
11. Die Klägerin sei bis zur Entlassung durchgehend untersucht worden. Akute Atembeschwerden und starke Schmerzen hätten bei der Entlassung nicht bestanden. Eine Flüssigkeitsansammlung habe bei der Klägerin nicht mehr punktionswürdig bestanden. Die diversen Ultraschalluntersuchungen hätten eine solche nicht gezeigt.
12. Die Bügelentfernung sei erfolgt, da aus präoperativer Sicht nicht auszuschließen war, dass ein Teil der rezidivierenden Schmerzen und Weichteilergüsse auf den Metallbügel zurückzuführen waren. Die Klägerin habe auf die vorzeitige Entfernung selbst gedrängt. Die Möglichkeit weiterführender Diagnostik hätte an der Entscheidung nichts geändert.
Es habe sich intraoperativ gezeigt, dass das rechte Metallbügelende gut unter Weichteilen versteckt gelegen habe; es sei nicht in die Interkostalmuskulatur oder den Thoraxraum eingedrungen gewesen. Er habe daher keine Beschwerden im Bereich des Rippenfells und der Lunge verursachen können. Er sei korrekt außen an der Rippe gelegen und habe dort nur eine Knochenkante verursacht. Es habe sich hierbei nur um einen bindegewebigen Abbau gehandelt. Es habe sich dadurch gezeigt, dass die Schmerzen nicht durch den Metallbügel verursacht worden seien. Darüber hinaus stehe die von der Klägerin angegebene Schmerzlokalisation an der 3. und 4. Rippe rechts nicht im Einklang mit der Lage des Bügels in Höhe der 5. und 6. Rippe.
Das Rezidivrisiko der vorzeitigen Bügelentfernung sei auch ausführlich mit der Klägerin und ihrem Vater besprochen worden. Das Risiko habe aber aufgrund der unerträglich angegebenen Schmerzsituation eingegangen werden müssen. Die Klägerin habe für die Abwägung ausreichend Zeit und Gelegenheit gehabt.
Die Bildung von Pseudarthrosen in Form eine straffen bindegewebigen Verbindung zweier Knorpelsegmente sei grundsätzlich immer möglich. Sie seien funktionell unerheblich und spielten für die Atmung nur äußert selten eine Rolle.
Bei der Klägerin sei durch die Behandlung bei dem Beklagten zu 2) kein chronisches Schmerzsyndrom entstanden. Die Klägerin habe schon vor der Operation unter Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen, wie auch depressiven Verstimmungen gelitten. Sie habe auch eine mehrjährige präoperative Schmerztherapie ohne Zusammenhang mit der Trichterbrust durchgeführt.
Der hohe Schmerzmittelbedarf der Klägerin resultiere aus einer Gewöhnung an diese.
Im Übrigen verweist der Beklagte zu 2) darauf, dass sich die im Krankenhaus M H eingelegte Drainage nach einem dort gefertigten CT vom 05.04.2003 intrapulmonal, d.h. in der Lunge befindlich, gezeigt habe.
Zur Ergänzung des Tatbestandes wird Bezug genommen auf das wechselseitige schriftsätzliche Vorbringen der Parteien samt Anlagen.
Es ist Beweis erhoben worden aufgrund Beweisbeschlusses vom 04.01.2008 (Bl. 205 ff d. A.) durch Erholung eines Sachverständigengutachtens des Sachverständigen Prof. Dr. R . Zum Ergebnis der Beweisaufnahme wird Bezug genommen auf dessen schriftliches Gutachten vom 11.05.2009 (Bl. 227 ff d. A.) sowie dessen mündliche Anhörung im Termin vom 21.01.2010 (Bl. 330 ff d. A.). Es ist weiter Beweis erhoben worden durch Erholung eines ergänzenden Gutachtens aufgrund Beweisbeschlusses vom 25.03.2010 (Bl. 391 ff d. A.). Diesbezüglich wird Bezug genommen auf das schriftliche Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. D vom 13.08.2010 (Bl. 409 ff d. A.) sowie dessen mündliche Anhörung im Termin vom 27.01.2011 (Bl. 435 ff d. A.).
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist gegen die Beklagte zu 1) unbegründet. Gegen den Beklagten zu 2) ist die Klage nur zu einem geringen Teil begründet; im Übrigen konnte die Klägerin trotz der zahlreich erhobenen Vorwürfe nicht durchdringen.
I. Keine Haftung der Beklagten zu 1) für ärztliche Behandlungsfehler
Die Klage gegen die Beklagte zu 1) ist hinsichtlich ärztlicher Behandlungsfehler unbegründet. In Betracht käme allenfalls eine Haftung der Beklagten zu 1) für gerügte pflegerische Versäumnisse (hierzu unten Ziff. II. 5).
1. Zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1) wurde ein gespaltener Krankenhausaufnahmevertrag und zwischen der Klägerin und dem Beklagten zu 2) ein ärztlicher Wahlleistungsvertrag geschlossen.
Aufgrund der eindeutig geschlossenen Verträge kommt es nicht darauf an, dass die Klägerin tatsächlich gesetzlich versichert war und (lediglich) über eine private Zusatzversicherung verfügte. Sie kontrahierte mit den Beklagten insgesamt als sogenannte Privatpatientin. Die abgeschlossenen Verträge stellen nach ihrem eindeutigen Inhalt einen sogenannten gespaltenen Krankenhausaufnahmevertrag mit gesondertem ärztlichem Wahlleistungsvertrag dar.
2. Bei einem gespaltenen Krankenhausaufnahmevertrag schuldet der Krankenhausträger dem Patienten die Krankenhausversorgung, also Unterbringung, Verpflegung, die Bereitstellung der erforderlichen technisch-apparativen Ausrüstung und die Organisation, deren Benutzung, den Einsatz des nichtärztlichen Hilfspersonals, die organisatorische Sicherstellung ausreichender Anweisungen an den Pflegedienst und ggf. des Einsatzes nachgeordneter Ärzte im Krankenhaus sowie die Weiterbehandlung des Patienten außerhalb des Fachbereiches des selbst liquidierenden Arztes (Martis/Winkhart, Arzthaftungsrecht, 3. Auflage 2010, K177 m.w.N.). Der genaue Leistungsumfang des Krankenhausträges bestimmt sich individuell nach der jeweiligen Vertragsausgestaltung. Die vom Krankenhausträger geschuldeten Leistungen umfassen im vorliegenden Fall nicht die vom selbstliquidierenden Arzt in dessen Fachbereich zu erbringenden ärztlichen Leistungen. Dies folgt ausdrücklich aus Ziffer B. des zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1) geschlossenen Vertrages vom 10.03.2003 (Anlage B1).
3. Bei Inanspruchnahme gesondert zu liquidierender ärztlicher Leistungen als Wahlleistungen wird der Krankenhausträger im Regelfall nicht aus seiner vertraglichen Verpflichtung betreffend die ärztliche Versorgung entlassen, vielmehr soll ein zu dem Krankenhausvertrag hinzutretender Arztvertrag (wahlärztliche Leistungsvereinbarung) zwischen dem Patienten und dem liquidationsberechtigten Arzt geschlossen werden (BGH NJW 1985, 2189, 2190; BGH NJW 1993, 779). Ohne eine abweichende Klarstellung durch den Krankenhausträger wird der Patient schwerlich erwarten, dass die Annahme der Wahlleistung „gesondert berechenbare ärztliche Leistung“, d.h. die persönliche Betreuung durch den liquidationsberechtigten Arzt ihm zwar einen zusätzlichen Schuldner für bestimmte ärztliche Leistungen verschafft, dass er aber gleichzeitig insoweit den Krankenhausträger aus seiner Haftung für ärztliche Fehlleistungen der Chefärzte entlässt. Ohne besonderen Hinweis im Krankenhausaufnahmevertrag, bei dessen Abschluss ihm nur der Krankenhausträger gegenübersteht, kann er aber nicht erkennen, dass dieser einen Teil der angebotenen Leistungen nicht auch als eigene, sondern nur im Namen der liquidationsberechtigten Ärzte als deren Verpflichtung übernehmen will. Im Normalfall will der Patient gesonderte wahlärztliche Leistungen „hinzukaufen“ und nicht den Krankenhausträger aus seiner Verpflichtung entlassen (BGH NJW-RR 2006, 811; BGH NJW 1985, 2189).
Sollen die ärztlichen Leistungen jedoch im Einzelfall aus dem Vertrag mit dem Krankenhausträger völlig herausgenommen werden, so muss dem Patienten bei Vertragsschluss hinreichend verdeutlicht werden, dass abweichend vom Regelfall Schuldner dieser Leistungen auch im Fall einer Haftung für ärztliche Fehler nicht der Krankenhausträger ist, sondern der Patient sich insoweit an die liquidationsberechtigten Ärzte halten kann und muss (BGH NJW 1993, 779, 780). Allerdings muss wegen § 305c Abs. 1 BGB bei der Verwendung vorformulierter Vertragsklauseln diese für den Patienten einschneidende Konsequenz hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht werden, so dass es dem Patienten ermöglicht wird, seine Aufmerksamkeit auf diesen Punkt zu richten (BGH a.a.O.). Diese Klarstellung muss noch innerhalb des durch die Unterschrift des Patienten gedeckten Vertragstextes vorgenommen und deutlich drucktechnisch hervorgehoben werden (BGH a.a.O.).
Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Der am 10.03.2003 zwischen der Klägerin und dem beklagten Klinikum geschlossene Vertrag enthält bereits auf der Vorderseite unter der groß und in Fettschrift gedruckten Überschrift „B. (…)/Haftungsausschluss“ den ausdrücklichen, inhaltlich klaren und durch Fettdruck hervorgehobenen Hinweis, dass die Beklagte zu 1) als Trägerin der Klinik Vertragspartner lediglich für die Unterbringung, Verpflegung und pflegerische Betreuung ist und Vertragspartner für ärztliche Leistungen nur die liquidationsberechtigten Ärzte sind. Ebenso deutlich ist auf die Haftungskonsequenz hingewiesen, dass das beklagte Klinikum nicht für Fehler des privat liquidierenden Arztes haftet und die Haftung allein den liquidationsberechtigten Arzt trifft, ebenso, dass dies auch für Fehler der Hilfsperson gilt. Die Worte „nicht“ (bezogen auf die Haftung des Krankenhausträgers) und „allein“ (bezogen auf die Haftung des liquidationsberechtigten Arztes“) sind noch besonders durch stärkeren Fettdruck und Unterstreichung hervorgehoben. Der gesamte Passus fällt durch seine drucktechnische Gestaltung auch bei flüchtigem Lesen des Formblattes derart ins Auge, dass von einem Überraschungscharakter nicht gesprochen werden kann.
Auch liegt darin keine unangemessene Benachteiligung des Patienten im Sinne des § 307 Abs. 1 BGB. Steht, wie hier, ein ärztlicher Behandlungsfehler in Frage, so verfügt der Geschädigte mit dem behandelnden Arzt über einen haftpflichtversicherten Schuldner, in dessen Behandlung er sich freiwillig begeben hat. Es ist daher nicht erforderlich, diesem den Krankenhausträger zusätzlich als Schuldner zur Seite zu stellen (OLG Koblenz NJW 1998, 3425, 3426).
Auch das Schriftformerfordernis nach § 22 Abs. 2 S. 1 HS1 BPflV (i.d. für den 10.03.2003 gültigen Fassung vom 23.06.1997) für die Wahlleistungsvereinbarung ist gewahrt. Der Vertrag vom 10.03.2003 (hier Krankenhausaufnahmevertrag und zugleich auch Wahlleistungsvereinbarung über Krankenhausleistungen) ist sowohl von der Klägerin als auch von einem Abschlussberechtigten der Beklagten zu 1) unterzeichnet worden.
4. Die Wahlleistungsvereinbarung kommt nur zum tragen, wenn auch ein Vertrag über wahlärztliche Leistungen (wahlärztliche Leistungsvereinbarung) abgeschlossen wird. Dabei ist es eine Frage der Vertragsgestaltung im Einzelfall, ob dieser (zusätzliche) Vertrag bereits – im Wege eines Vertretergeschäftes – unmittelbar Gegenstand der zwischen dem Krankenhaus und dem Patienten abgeschlossenen Wahlleistungsvereinbarung ist oder ob es hierzu einer weiteren Abrede zwischen Arzt und Patienten bedarf (BGH NJW 1998, 1778, 1779). Im vorliegenden Fall enthält der Krankenhausaufnahmevertrag mit Wahlleistungsvereinbarung zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1) den Abschluss einer wahlärztlichen Leistungsvereinbarung offensichtlich nicht. Vielmehr wird im Anschluss an die fettgedruckte Passage ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die ärztlichen Leistungen ein gesonderter Vertrag mit dem liquidationsberechtigten Arzt erforderlich sei, wobei durch Ankreuzen erklärt wurde, dass dieser Vertrag noch abgeschlossen werde. Der Hinweis auf die Notwendigkeit eines gesonderten Vertrages schließt einen Vertreterwillen des Krankenhauses bei Abschluss der wahlärztlichen Leistungsvereinbarung aus.
Für den Abschluss der wahlärztlichen Leistungsvereinbarung gilt § 22 Abs. 2 BPflV nicht, da § 22 Abs. 2 BPflV nur im Verhältnis Krankenhausträger-Patient Anwendung findet (BGH NJW 1998, 1778, 1779f). Der erforderliche Arztvertrag kann daher auch mündlich oder durch konkludentes Handeln geschlossen werden.
5. Die am 10.03.2003 geschlossene Wahlleistungsvereinbarung ist jedoch grundsätzlich unwirksam, denn sie genügt nicht den Anforderungen des § 22 Abs. 2 S. 1 HS. 2 BPflV. Danach ist der Patient vor Abschluss der Vereinbarung über die Entgelte der Wahlleistungsvereinbarung und deren Inhalt im Einzelnen zu unterrichten. Hierbei reicht es einerseits nicht aus, wenn der Patient lediglich darauf hingewiesen wird, dass die Abrechnung des selbstliquidierenden Arztes nach der Gebührenordnung für Ärzte erfolgt; andererseits ist es nicht erforderlich, dass dem Patienten unter Hinweis auf die mutmaßlich in Ansatz zu bringenden Nummern des Gebührenverzeichnisses der Gebührenordnung für Ärzte detailliert und auf den Einzelfall abgestellt die Höhe der voraussichtlich entstehenden Arztkosten – in Form eines im Wesentlichen zutreffenden Kostenanschlags – mitgeteilt wird. Vielmehr ist nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung (BGH Urteil vom 01.02.2007, Az. III ZR 126/06 = NSW BGB § 134; NJW-RR 2005, 419; NJW-RR 04, 1428, NJW 04, 684, 686), der sich die Kammer anschließt, ausreichend:
(1) eine kurze Charakterisierung der Inhalts wahlärztlicher Leistungen, wobei zum Ausdruck kommt, dass hierdurch ohne Rücksicht auf Art und Schwere der Erkrankung die persönliche Behandlung durch die liquidationsberechtigten Ärzte sichergestellt werden soll, verbunden mit dem Hinweis darauf, dass der Patient auch ohne Abschluss einer Wahlleistungsvereinbarung die medizinisch notwendige Versorgung durch hinreichend qualifizierte Ärzte erhält;
(2) eine kurze Erläuterung der Preisermittlung für ärztliche Leistungen nach der Gebührenordnung für Ärzte bzw. für Zahnärzte (Leistungsbeschreibung anhand der Nummern des Gebührenverzeichnisses; Bedeutung von Punktzahl und Punktwert; Möglichkeit, den Gebührensatz je nach Schwierigkeit und Zeitaufwand zu erhöhen); Hinweis auf Gebührenminderung nach § 6a der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ);
(3) ein Hinweis darauf, dass die Vereinbarung wahlärztlicher Leistungen eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung zur Folge haben kann;
(4) ein Hinweis darauf, dass sich bei der Inanspruchnahme wahlärztlicher Leistungen die Vereinbarung zwingend auf alle an der Behandlung des Patienten beteiligten liquidationsberechtigten Ärzte erstreckt (vgl. § 22 Abs. 3 Satz 1 BPflV );
(5) und ein Hinweis darauf, dass die Gebührenordnung für Ärzte/Gebührenordnung für Zahnärzte auf Wunsch eingesehen werden kann; die ungefragte Vorlage dieser Gesetzestexte erscheint demgegenüber entbehrlich, da diesen für sich genommen kein besonderer Informationswert zukommt. Der durchschnittliche Wahlleistungspatient ist auch nicht annähernd in der Lage, sich selbst anhand des Studiums dieser umfänglichen komplizierten Regelungswerke einen Überblick über die Höhe der auf ihn zukommenden Arztkosten zu verschaffen.
Jedenfalls zu den genannten Punkten 1, 2, 3 und 5 findet sich in dem Vertrag vom 10.03.2003 kein Hinweis.
Soweit die Beklagte zu 1) vorträgt, sie selbst führe die erforderliche Belehrung nicht durch, diese habe vielmehr durch den selbstliquidierenden Arzt zu erfolgen, ist dies unbehelflich. § 22 Abs. 2 S.1 HS 2 BPflV verpflichtet den Krankenhausträger, nicht jedoch den selbstliquidierenden Arzt (s.o.).
Damit ist aber die geschlossene Wahlleistungsvereinbarung jedenfalls preisrechtlich unwirksam.
6. Die Unwirksamkeit der mit dem Krankenhausträger geschlossenen Wahlleistungsvereinbarung erstreckt sich jedoch – jedenfalls im konkreten vorliegenden Fall – insoweit nicht auf die wahlärztliche Leistungsvereinbarung, als dass der selbstliquidierende Arzt aus seiner vertraglichen Haftung entlassen wird und dafür eine vertragliche und deliktische Haftung des Krankenhauses für Behandlungsfehler der Arztes eintritt.
a. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 19.02.1998 (NJW 1998, 1778, 1780) entschieden, dass die wegen Verstoßes gegen § 22 Abs. 2 BPflV eintretende Unwirksamkeit der Wahlleistungsvereinbarung gemäß § 139 BGB auch den sie vervollständigenden Arztvertrag erfasst. Auch zwei rechtlich selbständige Vereinbarungen können nämlich eine rechtliche Einheit i. S. d. § 139 BGB bilden, und zwar selbst dann, wenn an ihnen – wie hier – zum Teil verschiedene Personen beteiligt sind. Voraussetzung hierfür ist allerdings im allgemeinen, dass diese Vereinbarungen nach den Vorstellungen der Parteien miteinander „stehen und fallen“ sollen; der maßgebliche Verknüpfungswille ist dabei aufgrund der Erklärungen und der Interessenlage der Vertragsschließenden mit Rücksicht auf die Verkehrssitte zu ermitteln (BGH a.a.O. m.w.N.). Dem stimmt für die Vergütungsfrage grundsätzlich auch die Beklagte zu 1) zu (Schriftsatz vom 07.05.2007, dort Bl. 5 = Bl. 76 d. A.).
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes befasst sich jedoch mit den Folgen des Vergütungsanspruches des selbstliquidierenden Arztes im Falle einer unwirksamen Wahlleistungsabrede mit dem Krankenhausträger. Nicht entschieden wurde aber, ob sich hierdurch auch das Haftungsgefüge ändert, mithin die vertragliche Haftung des Arztes auf der einen Seite und der „faktische Haftungsausschluss“ („faktisch“, da eine vertragliche Vereinbarung mit dem Klinikum über ärztliche Leistungen im Rahmen des gespaltenen Krankenhausvertrages gerade nicht begründet wurde) des Krankenhausträgers für vertragliche und deliktische Arztfehler auf der anderen Seite.
b. Die zur Vergütungsfrage angestrengten Überlegungen des Bundesgerichtshofes (a.a.O., vgl. auch BGH NJW 2002, 3772) erscheinen auch auf den hier zu erörternden Fall des „Haftungsausschlusses“ übertragbar.
Darüber hinaus verliert der selbstliquidierende Arzt als Folge der zitierten Rechtsprechung bei einer Unwirksamkeit der Wahlleistungsvereinbarung seinen Vergütungsanspruch (so ausdrücklich BGH NJW 1996, 1778). Bei Berücksichtigung dessen kann nicht unterstellt werden, dass der verbleibende „Rest“ des Arztvertrages bestehen bleiben soll: weder will der Arzt kostenlos behandeln, noch ohne das Korrelat eines Geldeinganges eine vertragliche Haftung übernehmen.
Der Patient wiederum stünde bei verbleibender Wirksamkeit des „Haftungsausschlusses“ ohne vertragliche Haftungsansprüche da; er wäre vielmehr lediglich auf deliktische Ansprüche zu verweisen. Dies kann wiederum nicht dem Willen des Patienten entsprechen.
Damit der Patient nicht in einem solchen Fall der umfassenden Unwirksamkeit der abgeschlossenen Verträge über § 139 BGB in einen „vertragsleeren Raum“ fällt, wie dies die Beklagte zu 1) befürchtet, soll – letztlich dogmatisch ungeklärt – der mit dem Krankenhausträger geschlossene, an sich unwirksame Krankenhausaufnahmevertrag zu einem totalen Krankenhausaufnahme- bzw. -behandlungsvertrages erstarken (so BGH NJW 2002, 3772 wiederum für den Fall des Vergütungsanspruches; OLG München, Urteil vom 07.08.2008, Az. 1 U 4979/07, zitiert nach juris Rn. 52 ausdrücklich auch für die Haftungsfrage). Dies erscheint insoweit auch nachvollziehbar, da der Krankenhausträger zur Einhaltung der Formvorschrift des § 22 Abs. 2 S. 1 HS. 2 BPflV selbst verpflichtet ist und es damit in der Hand hat, die für ihn nachteiligen Folgen abzuwenden.
c. Dem kann jedoch im Ergebnis jedenfalls für den vorliegenden Fall nicht gefolgt werden:
Der Bundesgerichtshof begründet die Verknüpfung der unwirksamen Wahlleistungsvereinbarung mit dem wahlärztlichen Vertrag nach § 139 BGB damit, dass die Vereinbarungen nach den Vorstellungen der Parteien miteinander „stehen und fallen“ sollen. Vor dem Hintergrund der Haftungs- und Leistungsfrage kann jedoch nicht unterstellt werden, dass es im Interesse des Patienten liegt, aufgrund einer letztlich fingierten gesetzlichen Verknüpfung mit der Unwirksamkeit des Arztvertrages einen Leistungsschuldner und Haftungsschuldner zu verlieren, welchen er sich vorher ausdrücklich selbst ausgesucht hat. Eine solche Vorstellung kann einem Patienten nur schwerlich unterstellt werden.
§ 22 Abs. 2 BPflV stellt weiter eine zunächst preisrechtliche Regelung dar (so auch BGH VersR 2003, 52): sie bezweckt den Schutz des Privatpatienten vor finanzieller Überforderung und Überraschung. Wird dem Patienten als Folge eines Verstoßes gegen die seinem Schutz dienende Vorschrift des § 22 Abs. 2 BPflV zugleich der selbstliquidierende Arzt als Haftungsschuldner entzogen, würde sich der durch die Norm intendierte Zweck in sein Gegenteil verkehren.
Schloßer (MedR 2009, 313, 318) plädiert dafür, es bei fehlerhafter Unterrichtung daher grundsätzlich bei der Wirksamkeit der Vertragsverhältnisse zu belassen und stattdessen dem Patienten einen aufrechenbaren Schadensersatzanspruch zuzugestehen. Schloßer zitiert auch „Diskussionen“ des LG Hamburg (unter Verweis auf Urt. vom 11.03.1999 – 323 O 49/96) und des OLG München (unter Verweis auf Urt. vom 25.08.2004 – 9 O 2445/01), wonach die Unwirksamkeit auf die Vergütungsfrage beschränkt und die Haftungsschuld mit Verweis auf § 242 BGB bestehen bleiben solle.
d. Die Kammer neigt zu der Ansicht, dass das Haftungsgefüge entgegen der zitierten Rechtsprechung durch die Unwirksamkeit des Krankenhausaufnahmevertrages nicht geändert und eine Haftung der Beklagten zu 1) nicht begründet wird.
Dies kann jedoch letztlich im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben, da sämtliche Beteiligte ihre jeweiligen Leistungen im Vertrauen auf die Wirksamkeit der zugrunde liegenden Verträge bereits vollständig erbracht haben.
Das OLG München (a.a.O.; auch Urt. vom 25.08.2004, Az. 9 O 2445/01 zitiert nach Schloßer) ließ dies in der bereits zitierten Entscheidung offen für den Fall, dass alle Beteiligten im Vertrauen auf die Wirksamkeit der Vereinbarungen gehandelt haben, insbesondere Behandlungen, Abrechnung und Bezahlung auf Grundlage der unwirksamen Vereinbarung erfolgt sind.
In einem solchen wie auch im hier streitgegenständlichen Fall besteht für eine (nachträgliche) Auflösung der Vertragsverhältnisse mit Begründung eines neuen, anderen Vertragsverhältnisses kein Bedarf. Sämtliche Vertragsparteien haben die ihnen obliegenden Leistungen erbracht; die Behandlungen der Klägerin sind abgerechnet und bezahlt. Eine Rückabwicklung im Einzelnen wäre praktisch nur schwer durchzuführen. Aufgrund der auch vollständigen Abrechnung und Bezahlung liefe eine Durchsetzung des von § 22 Abs. 2 S. 1 HS. 2 BPflV intendierten Schutzzweckes ins Leere. Der Patient wurde und ist nicht benachteiligt. Er behält mit dem versicherten Arzt auch einen solventen Haftungsschuldner. Die durch § 139 BGB letztlich ausgelöste Folge ist in einem solchen Fall nach § 242 BGB zu korrigieren.
Auch Frahm/Nixdorf (Arzthaftungsrecht, 4. Auflage 2009, Rn 29) gehen davon aus, dass man bei unwirksamer Wahlleistungsklausel den insoweit selbstliquidationsberechtigten Arzt aus tatsächlicher Übernahme der Behandlungsaufgabe auf vertragsähnlicher Grundlage als für die Haftung passivlegitimiert ansehen müsse.
Es ist daher jedenfalls in einem Fall wie dem vorliegenden, in welchem alle Beteiligten im Vertrauen auf die Wirksamkeit der Vereinbarungen gehandelt haben, insbesondere Behandlung, Abrechnung und Bezahlung auf der Grundlage der unwirksamen Vereinbarungen erfolgt ist, nicht von einer Veränderung des Haftungsgefüges bei einer formnichtigen Wahlleistungsabrede zu Lasten des Patienten auszugehen. Die Haftung des Chefarztes bleibt bestehen, eine Haftung des Krankenhausträgers für Fehler des selbstliquidierenden Arztes entsteht nicht.
7. Die Klägerin hat die den „Haftungsausschluss“ enthaltene Vertragsurkunde unterzeichnet und hatte somit grundsätzlich Gelegenheit, diesen zur Kenntnis zu nehmen. Eine zusätzliche mündliche Aufklärung wird nicht verlangt.
Unterzeichnet die Klägerin gleichsam „blind“ ihr vorgelegte Urkunden, ohne diese vor der Unterschriftsleistung zu lesen, verwirklicht sich das von ihr selbst zu tragende Lebensrisiko nicht zur Kenntnis genommener Klauseln. War die Klägerin nicht am Inhalt von ihr unterzeichneter Urkunden interessiert – nicht einmal an deutlich hervorgehobenen Bestimmungen – so kann sie sich nicht auf deren fehlende Kenntnis berufen. Das Risiko, den Vertragsinhalt vor Unterzeichnung nicht zu lesen, obliegt der jeweiligen Vertragspartei und berechtigt nicht einmal zur Anfechtung wegen Irrtums (BGH NJW 1968, 2102).
II. Die einzelnen Behandlungsfehler- und Aufklärungsfehlerrügen, insbesondere Haftung des Beklagten zu 2)
Die Klägerin hat gegen den Beklagten zu 2) einen Anspruch auf Schmerzensgeld in Höhe von 500 € wegen einer behandlungsfehlerhaften Verzögerung der Drainage des aufgetretenen Pleuraergusses und der hierdurch im Zeitraum vom 15.03.2003 bis 16.03.2003 erlittenen Beeinträchtigungen. Weitere Ansprüche stehen der Klägerin mangels Behandlungs- und Aufklärungsfehlern nicht zu.
1. Zulässigkeit des Erlanger Verfahrens
Der Beklagte zu 2) führte vor der Durchführung der Operation vom 11.03.2003 die notwendigen Untersuchungen durch. Die präoperative Anamnese- und Befunderhebung war daher auch für die Entscheidung der Operationsmethode nicht fehlerhaft (a.). Ein Vorgehen nach der Erlanger Methode entsprach darüber hinaus dem anerkannten und gesicherten Stand der ärztlichen Wissenschaft (b). Insbesondere war das von der Klägerin geforderte Einbringen eines zweiten Bügels nicht erforderlich.
a. Der Sachverständige Prof. Dr. R führte hinsichtlich der Anamneseerhebung sowie der präoperativen Untersuchungen durch den Beklagten zu 2) aus, dass dieser „eher mehr“ Untersuchungen durchgeführt habe als allgemein üblich, wobei ein Großteil der apparativen Untersuchungen für Entscheidungsfindung und Methodenwahl nichts Wesentliches beisteuerte.
Danach steht für die Kammer fest, dass die präoperative Anamnese und die präoperativen Befunderhebungen ausreichend waren. Behandlungsfehler insbesondere durch die Wahl der Methode ergeben sich hieraus nicht.
b. Die durchgeführte Beweisaufnahme hat ergeben, dass die bei der Klägerin durchgeführte Erlanger Methode dem ärztlichen Standard entsprach, deren Anwendung war mithin nicht behandlungsfehlerhaft.
Der Sachverständige Prof. Dr. R führte zur sogenannten Erlanger Methode aus, dass es sich um eine durchaus anerkannte und übliche Methode zur Behandlung einer Trichterbrust handele, wenngleich die Kammer nicht verkennt, dass sie nur in wenigen Kliniken Anwendung findet. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse zur Erlanger Methode sowie dem postoperativen plastischen Ergebnis sei diese Operationsmethode für die Klägerin nicht ungeeignet gewesen. Auch habe es sich bei der Klägerin nicht um einen außergewöhnlichen Fall gehandelt, der die Anwendung der gängigen Methoden unzulässig gemacht hätte. Insbesondere sei im Fall der Klägerin das Einbringen eines zweiten Bügels nicht erforderlich gewesen.
Auch der Sachverständige Prof. Dr. D bestätigte, dass die bei der Klägerin durchgeführte Erlanger Methode als Operationsverfahren nicht zu beanstanden ist.
Die Kammer schließt sich hier den übereinstimmenden und überzeugenden Ausführungen der beiden gerichtlich bestellten Sachverständigen an. Es bestehen auf Grundlage deren Gutachten keine Zweifel, dass es sich bei der „Erlanger Methode“ um eine zwar weniger verbreitete, jedoch trotzdem standardmäßige Operationsmethode handelte. Deren Anwendung stellt daher keinen Behandlungsfehler dar.
An dieser Stelle kann dahingestellt bleiben, ob die Methode nach Nuss eine echte Alternative dargestellt hätte, da sich hieraus Konsequenzen für die Frage der Aufklärung ergeben würden (hierzu unten 2.).
2. Aufklärung der Klägerin über Alternativen vor dem Eingriff am 11.03.2003 sowie die Möglichkeit der Entstehung von „Pseudarthrosen“ bei der Erlanger Methode
Die Klägerin war über die Methode nach Nuss als Behandlungsalternative nicht aufzuklären. Folgen möglicherweise entstandener „Pseudarthrosen“ konnte die Klägerin nicht zur Überzeugung der Kammer nachweisen; über diese war auch nicht aufzuklären.
a. Aufgrund des Ergebnisses der durchgeführten Beweisaufnahme steht für die Kammer fest, dass es sich bei der Methode nach Nuss jedenfalls im Jahr 2003 nicht um eine aufklärungspflichtige echte Behandlungsalternative im Fall der Klägerin gehandelt hätte. Über die Methode nach Nuss war daher nicht aufzuklären.
Der Sachverständige Prof. Dr. R führte hierzu allerdings aus, dass er den schriftsätzlichen Erläuterungen des Beklagten zu 2) nicht zustimmen könne, dass es keine bessere Methode als das „Erlanger Verfahren“ gebe, andere Methoden ein immenses Risiko aufwiesen und die „Erlanger Methode“ das Verfahren mit der niedrigsten Komplikationsrate sei. Die Nuss-Methode sei vielmehr überlegen, da die Patienten bei anfangs hoch dosierter Schmerzmedikation am ersten Tag nach der Operation aus dem Bett aufstehen könnten, Pseudarthrosen vermieden würden und Thoraxdrainagen nur in Ausnahmefällen erforderlich seien.
Der Sachverständige Prof. Dr. D führte dem entgegen nach nochmals grundsätzlicher Darstellung der Methode nach Nuss sowie der „Erlanger Methode“ aus, dass bis zum Operationszeitpunkt der Klägerin im Jahr 2003 weniger als 20 Publikationen zu der Technik nach Nuss erschienen waren. Es habe sich bei der erstmals 1998 publizierten Methode um eine „absolut neue Methode in Europa“ gehandelt. Die bis zum Jahr 2003 nach der Methode nach Nuss operierten und publizierten Patienten seien wesentlich jünger (alle unter 15 (!) Jahren) als die zum Operationszeitpunkt 25jährige Klägerin gewesen. Im Jahr 2003 habe die asymmetrische Trichterbrust mit bereits eingebrachtem Mammaimplantat eine Kontraindikation für die Nusstechnik dargestellt. Zum Zeitpunkt der Operation der Klägerin im Jahr 2003 sei die Methode nach Nuss daher für die Klägerin keine alternative Technik gewesen. Sie war nicht das Mittel der Wahl und habe sich sogar wegen des Brustimplantates bei der Klägerin verboten.
Die Kammer schließt sich den Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. D an und macht sich diese nach kritischer Wertung zu eigen.
Die Kammer hat den Sachverständigen Prof. Dr. D nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens des Prof. Dr. R zusätzlich für eine Gegenüberstellung der beiden in Frage kommenden Methoden beauftragt, nachdem der Sachverständige Prof. Dr. R ausschließlich eigene Erkenntnisse mit der Methode nach Nuss hat, der Sachverständige Prof. Dr. D hingegen beide Operationsmethoden selbst anwendete und daher praktische Erfahrung mit beiden Methoden hat. Der Sachverständige Prof. Dr. D hat darüber hinaus im Gegensatz zur Auffassung Klagepartei seine Darstellung für die Kammer nachvollziehbar mit der von ihm durchgeführten Literaturrecherche begründet. Er hat seinen Ausführungen das bis 2003 publizierte Fallmaterial zugrunde gelegt, wonach die ältesten bis dahin nach Nuss operierten Patienten zehn Jahre (!) jünger waren als die Klägerin.
Der Sachverständige Prof. Dr. R hat sich dagegen über die Erkenntnisse zur Methode nach Nuss für den Fall der Klägerin vor dem Hintergrund des Wissensstandes des Jahres 2003 nicht geäußert. Er hat seine diesbezüglichen Ausführungen weder in den Kontext der Erfahrungen im Jahr 2003 gestellt noch seine Äußerungen etwa anhand Literatur belegt. Da er auch darüber hinaus selbst keine Erfahrung mit der „Erlanger Methode“ hat, konnte sich die Kammer auf Grundlage seiner Ausführungen zur Frage des Methodenvergleiches keine Überzeugung bilden.
Die Erholung eines weiteren Sachverständigengutachtens zu dieser Frage war nicht veranlasst. Es ist nicht ersichtlich, dass andere Gutachter, insbesondere solche, die beide Operationsmethoden beherrschen, über überlegeneres Fachwissen oder bessere Forschungsmethoden verfügten.
Die Methode nach Nuss stellte sich daher zum einen aufgrund sogar bestehender Kontraindikation sowie ihrer Durchführung bei bis zum Operationszeitpunkt erheblich jüngeren Patientinnen nicht als eine echte Behandlungsalternative für die Klägerin dar. Eine Aufklärung hierüber war daher nicht veranlasst.
Selbst wenn eine Operation nach Nuss im Falle der Klägerin in Betracht gekommen wäre, hätte es sich zum Zeitpunkt des Jahres 2003 um eine Neulandmethode gehandelt. Dies sowohl in allgemeiner Hinsicht, da für die erstmals 1998 publizierte Methode noch wenig Forschungsmaterial und damit ein geringer Erkenntnisstand vorlag; als auch speziell im Hinblick auf das Alter der Klägerin, welches zehn Jahre über den bis dahin publizierten Fällen lag. Zwar muss eine Aufklärung über Behandlungsalternativen dann erfolgen, wenn es mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Behandlungsmethoden gibt, die wesentlich unterschiedliche Risiken und Erfolgschancen aufweisen, mithin eine echte Wahlmöglichkeit für den Patienten besteht (BGH NJW 2005, 1718 m.w.N.). Über therapeutische Verfahren, die sich erst in der Erprobung befinden und damit noch nicht zum medizinischen Standard rechnen, muss ungefragt nicht aufgeklärt werden, selbst wenn sie an sich als Behandlungsalternative in Frage kämen, vom Arzt aber nicht gewählt werden (Geiß/Greiner, Arzthaftpflichtrecht, 6. Auflage 2009, C., Rn. 23). So liegt der Fall hier.
b. Die Klägerin vermochte keine Folgen der entstandenen „Pseudarthrosen“ zur Überzeugung der Kammer nachzuweisen.
(1) Hinsichtlich der von der Klägerin behaupteten Pseudarthrosen wiesen sowohl der Sachverständige Prof. Dr. R als auch der Sachverständige Prof. Dr. D darauf hin, dass es sich nicht um Pseudarthrosen im medizinischen Sinne handeln kann, da diese ausschließlich zwischen Knochengewebe entstehen. Vielmehr handelt es sich im – wie hier – Knorpelgewebebereich um „weniger straffe Narbenverbindungen“. Soweit im Folgenden von Pseudarthrosen gesprochen wird, sind solche Verbindungen gemeint.
(2) Der Sachverständige Prof. Dr. R führt aus, dass selbst das Vorliegen der Pseudarthrosen nicht die von der Klägerin geschilderten auf diese zurückgeführten stärksten Schmerzen erkläre. Das Einwachsen von Nervengewebe in die Pseudarthrosen sei auch unter Auswertung des Operationsberichtes vom 11.08.2004 nicht nachgewiesen und äußerst unwahrscheinlich.
Es sei, wie der Gutachter in seiner mündlichen Anhörung ergänzend ausführte, zwar grundsätzlich möglich, das Nervengewebe in Muskeln und diese wiederum in die Pseudarthrosen eingewachsen sind, was Schmerzen verursachen könne. Der Sachverständige Prof. Dr. D erläuterte hierzu in seiner mündlichen Anhörung vertiefend, dass ein Nerv oder Muskel nicht von selbst in einen Raum zwischen Rippe und Brustbein hineinwachse. Er folge vielmehr einer vorgegeben Fixierung.
Auch der Sachverständige Prof. Dr. D führte in seiner mündlichen Anhörung aus, dass er nicht beurteilen könne, ob die von der Klägerin geklagten Schmerzen von den Pseudarthrosen stammten. Diese hätten aus seiner Sicht keine Konsequenzen bei der Klägerin gehabt. Bei einer anderen Technik würden sogar vom Brustbein abgetrennte Rippen nicht wieder befestigt, ohne dass es zu einer Instabilität oder Beschwerden komme.
Der Sachverständige Prof. Dr. R kam weiter zu dem Ergebnis, dass eine Beeinträchtigung der Atemmechanik durch die Pseudarthrosen mit hoher Wahrscheinlichkeit fraglich sei. Ein instabiler Thorax und schon gar eine Instabilität des ganzen Körpers liege nicht vor.
(3) Die Kammer schließt sich den überzeugenden und im Wesentlichen übereinstimmenden Beurteilungen der beiden Sachverständigen Prof. Dr. R und Prof. Dr. D an. Selbst bei Vorliegen von Pseudarthrosen (hier: weniger straffe Narbenverbindungen im Knorpelgewebe) kann die Kammer keine Überzeugung erlangen, dass diese zu den von der Klägerin beklagten Schmerzen, Beeinträchtigungen und Instabilitäten geführt haben.
(4) Soweit die Klägerin, wie von dieser behauptet, über die Möglichkeit einer Pseudarthrosebildung vor der Operation vom 11.03.2003 nicht aufgeklärt worden ist, führt dies mangels verwirklichtem Schaden nicht zu einer Haftung des Beklagten zu 2). Eine ärztliche Heilbehandlung ohne rechtfertigende Einwilligung, aber ohne einen vom Arzt verursachten Gesundheitsschaden führt nicht zu einer Haftung des Arztes, etwa wegen einer Verletzung des Persönlichkeitsrechtes. Die Auffassung, die eine Haftung bereits aus der bloßen Verletzung der Aufklärungspflicht herleitet, auch wenn kein Gesundheitsschaden eintritt, würde zu einer uferlosen Haftung der Ärzte führen, die auch bei der gebotenen Berücksichtigung der Interessen des Arztes nicht vertretbar wäre (BGH NJW 2008, 2344, 2345).
c. Eine Aufklärung über die Möglichkeit einer Pseudarthrosebildung war auch deshalb nicht veranlasst, da die Bildung einer Pseudarthrose, so der Sachverständige Prof. Dr. D, „definitiv“ keine bekannte Komplikation der „Erlanger Methode“ darstelle.
3. Länge des Metallbügels
Die Rüge der Klägerin, der am 11.03.2003 implantierte Bügel sei zu lang gewesen, kann der Klage mangels Behandlungsfehlers nicht zum Erfolg verhelfen.
Es sei unwahrscheinlich, so der gerichtlich bestellte Sachverständige Prof. Dr. R, dass der bei der Klägerin gewählte Bügel zu lang war. Ein Bügel sei aufgrund der Biomechanik sogar eher länger zu wählen.
Ein Behandlungsfehler liegt daher in der gewählten Bügellänge nicht vor.
Hierfür spricht auch nicht die am 25.03.2003 durchgeführte Bügelkürzungsoperation. Denn diese war veranlasst durch die erheblichen Schmerzen der Klägerin und den Versuch, deren Ursache zu finden und diese zu beheben. Aus der Durchführung der Kürzungsoperation kann nicht geschlossen werden, dass der zunächst eingebrachte Bügel eine falsche Länge aufgewiesen hätte (hierzu auch unten 9.).
4. Verletzung der Lunge, Auftreten eines Pneumothorax und eines Pleuraergusses
Die zunächst standhaft von der Klagepartei behauptete, auf einem Behandlungsfehler beruhende Verletzung der Lunge, wurde im Verlauf des Rechtsstreits nicht aufrechterhalten. Der Sachverständige Prof. Dr. R führte in seinem schriftlichen Gutachten auch ausführlich aus, dass bei der Klägerin kein Hinweis auf eine intraoperative Verletzung der Lunge vorliege. Auf eine solche könne insbesondere nicht aufgrund des aufgetretenen Pneumothorax und des Pleuraergusses geschlossen werden.
Auch die bei der Klägerin aufgetretenen blauen Flecke ließen einen Hinweis auf eine Lungenverletzung nicht zu. Diese als Zeichen einer Lungenverletzung zu deuten, sei wegen der Dicke der Brustwand „völlig unmöglich“.
Der Pneumothorax beruhe nicht auf einem Behandlungsfehler; er sei vielmehr Folge der nicht fehlerhaften Eröffnung des Rippenfells.
Der Pleuraerguss sei Folge der Operationswunde an der Wundfläche der Brustwand.
Pneumothorax und Pleuraerguss seien unabhängig voneinander.
Die Kammer schließt sich auch hier den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. R an, welche insbesondere hinsichtlich der allgemeinen Natur von Pneumothorax und Pleuraerguss mit den Erkenntnissen der Kammer aus anderen Verfahren mit anderen Sachverständigen übereinstimmen.
Das Auftreten eines Pneumothorax und eines Pleuraergusses sind daher nicht auf einen Behandlungsfehler zurückzuführen.
5. Verlegung auf Normalstation
Die Klägerin hat weder gegen den Beklagten zu 2) noch gegen die Beklagte zu 1) – die krankenhauspflegerischen Leistungen obliegen im Rahmen des gespaltenen Krankenhausaufnahmevertrage dieser – einen Schadensersatzanspruch für pflegerische Versäumnisse nach einer behaupteten zu frühen Verlegung auf die Normalstation.
Zwar führte der Sachverständige Prof. Dr. R hierzu in seinem Gutachten aus, dass die Verlegung von der Intensiv- auf die Normalstation grundsätzlich zulässig sei, wenn dort eine ausreichende Versorgung der Patientin mit Überwachung der Vitalfunktionen, Schmerztherapie, Erreichbarkeit eines kompetenten Arztes im Nachtdienst, einer raschen Betreuung durch die Schwester gerade in der Nacht und die Erreichbarkeit eines anästhesiologischen Schmerzdienstes gewährleistet ist.
In seinen zusammenfassenden Darlegungen führt der Sachverständige Prof. Dr. R weiter aus, dass eine Überwachung auf der Intensivstation in der ersten Nacht nach der Operation „ohne Frage besser gewesen“ wäre. Einen Nachteil sehe der Sachverständige, so in seiner mündlichen Anhörung präzisierend, aber nicht.
Die Klägerin macht geltend, dass sich die Schwestern der Normalstation nicht wie erforderlich um sie kümmern konnten. So habe es nachts lange gedauert, bis Hilfe gekommen sei, da die diensthabende Schwester jeweils erst Hilfe auf der Nachbarstation habe holen müssen. So habe die Klägerin einmal fast Erbrochenes eingeatmet und dadurch Ängste erlitten.
Die hier von der Klägerin beklagten, zweifelsohne belastenden Zustände, rechtfertigen jedoch nicht die Zubilligung eines Schmerzensgeldes. Wartezeiten bei der Pflege sind einem Krankenhausbetrieb immanent. Ein Patient muss sich hierauf grundsätzlich – im Rahmen des Normalen – einstellen. Die Kammer verkennt nicht, dass dergleichen insbesondere bei Schmerzen lästig und auch belastend ist. Die von der Klägerin vorgetragenen Übel überschreiten jedoch unter Berücksichtigung ihrer zeitlichen Begrenzung von nur relativ kurzer Zeit die sogenannte Geringfügigkeitsgrenze nicht (hierzu Palandt-Grüneberg, BGB 70. Auflage 2011, § 253 Rn. 14 m.w.N.). Dies gilt auch für die von der Klägerin erlittene Angst, Erbrochenes einzuatmen, wozu es glücklicherweise nicht kam.
6. Überwachung des Pneumothorax und Pleuraergusses
Der Beklagte zu 2) haftet der Klägerin gemäß § 280 Abs. 1 BGB i. V. m. dem Behandlungsvertrag wegen verspäteter Anlage einer Thoraxdrainage zur Drainierung des Pleuraergusses am 16.03.2003 anstatt spätestens am Morgen des 15.03.2003.
a. Die Drainierung des bei der Klägerin aufgetretenen Pleuraergusses hätte bereits am Morgen des 15.03.2003 erfolgen müssen. Die Anlage der Bülau-Drainage erst am 16.03.2003 verstieß gegen den anerkannten und gesicherten Stand der ärztlichen Wissenschaft und war mithin behandlungsfehlerhaft.
Der Gutachter Prof. Dr. R erläuterte, dass ein Pleuraerguss ähnlich wie ein Pneumothorax in den meisten Fällen von selbst gut resorbierbar sei. Inwieweit ein Pleuraerguss zu einer nicht tolerierbaren Einschränkung für den Patienten führe, hänge von seinem Volumen, dem Zustand der Lunge und dem Gesamtbefinden des Patienten ab. Entgegen dem Vortrag der Klägerin habe es keine Möglichkeit einer medikamentösen Behandlung des Pleuraergusses gegeben.
Im Falle der Klägerin mit einem wohl ungeschädigten Lungengewebe sei ein Pleuraerguss bis zu einem halben Liter tolerierbar. Bei der Klägerin habe jedoch ein Erguss von 1.350 ml vorgelegen, welcher eine Drainage als geboten erscheinen lasse. Eine spontane Resorption sei bei diesem Volumen wenig wahrscheinlich und daher nicht abzuwarten gewesen.
Am 14.03.2003, so der Sachverständige Prof. Dr. R, sei eine ausgedehnte Ergussbildung rechts mit einer Kompression des Lungenunterlappens mit ungenügender Luftfüllung nachgewiesen worden. Die Anlage der Thoraxdrainage könne im Falle des Entdeckens eines wie hier drainagewürdigen Ergusses am Abend oder bei einer personell ungünstigen Situation auch noch am nächsten Tag erfolgen, wenn sich der Patient in einem unbeeinträchtigten Zustand befindet. Die zeitliche Verzögerung der Anlage der Bülau-Drainage bis 16.03.2003 sei nicht begründet und nicht nachvollziehbar. Die Maßnahme sei am 14.03.2003 oder spätestens am 15.03.2003 sinnvoll gewesen, während am 12.03.2003 und 13.03.2003 eine drainagepflichtige Ergussmenge noch nicht feststellbar gewesen sei.
Zur Überwachung des Pleuraergusses führt der Sachverständige Prof. Dr. R aus, dass der Effekt einer gelegten Drainage jeden Tag zu kontrollieren sei. Dabei lasse die Röntgenuntersuchung am liegenden Patienten in der Regel keine Aussage über die Menge des Ergusses zu, im Gegensatz zur Untersuchung am stehenden Patienten. Der Beklagte zu 2) habe acht Röntgenaufnahmen am liegenden Patienten anfertigen lassen (nur zwei davon in den Tagen nach der Operation bis 16.03.2003, nämlich am 14. und 15.03.2003). Methodisch besser als eine Röntgenuntersuchung sei aber die Sonografie, welche eine annäherungsweise Berechnung des Volumens zulasse. Ultraschalluntersuchungen hinsichtlich des Pleuraergusses wurden vor dem 16.03.2003 nicht durchgeführt.
Der Sachverständige Prof. Dr. D führte hingegen in seiner mündlichen Anhörung aus, dass er es im Gegensatz zu dem Sachverständigen Prof. Dr. R nicht für fehlerhaft halte, dass eine Drainage nicht bereits vor dem 16.03.2003 gelegt wurde. Die Entscheidung zu einer solchen sei immer individuell vom behandelnden Arzt unter Abwägung der Risiken mit der Klinik der Patientin zu stellen. Zur Handlung verpflichtende Grenzwerte gebe es nicht.
Ab 16.03.2003, so der Gutachter Prof. Dr. D, sei die Drainierung ordnungsgemäß erfolgt.
Die Kammer schließt sich den gut begründeten Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. R an, wonach spätestens am Morgen des 15.03.2003 eine Drainage des Pleuraergusses vorzunehmen gewesen wäre. Zwar ist die Überwachung des Ergusses bis zu diesem Zeitpunkt durch Röntgenaufnahmen im Liegen ebenfalls insgesamt nicht sachgerecht erfolgt; aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ist – so der Sachverständige Prof. Dr. R – ein vor dem 14.03.2003 bestehender behandlungsbedürftiger Erguss jedoch auszuschließen.
Die Kammer folgt hinsichtlich der Einschätzung bis zum 16.03.2003 dagegen nicht dem Sachverständigen Prof. Dr. D . Dieser war bis zu seiner mündlichen Anhörung lediglich mit einer Begutachtung der Drainierung des Ergusses ab 16.03.2003, mithin ab Anlage der Drainage, beauftragt. Seine Äußerungen zur Zeit bis 16.03.2003 erfolgten unter summarischer Prüfung der bis dahin vorliegenden Befunde erstmals in der mündlichen Anhörung. Sie konnten die eindeutigen Ausführungen des Sachverständige Prof. Dr. R nicht in Frage stellen. Die Kammer verkennt aber auch hier nicht, dass es eindeutige Grenzwerte, welche ein Einschreiten erforderlich machen, nicht gibt.
Es ist daher von einer behandlungsfehlerhaften Verzögerung der Bülau-Drainage vom 15.03.2003 bis 16.03.2003 auszugehen.
Das Drainagemanagement ab Anlage der Bülau-Drainage ist dagegen nicht zu beanstanden.
b. Der Behandlungsfehler ist dem Beklagten zu 2) zuzurechnen, da die Versorgung des aufgrund der Operation vom 11.03.2003 aufgetretenen Pleuraergusses jedenfalls auch in den Verantwortungsbereich des Chirurgen fällt (OLG Saarbrücken AHRS Nr. 2430/302).
c. Der Behandlungsfehler ist verschuldet.
Der Beklagte hat den ihm gemäß § 280 Abs. 1 S. 2 BGB obliegenden Entlastungsbeweis nicht geführt. Darlegungen hierzu erfolgten nicht.
Im Übrigen hätte der Beklagte zu 2) bei Aufwendung der erforderlichen Sorgfalt die Drainagepflichtigkeit des Ergusses erkennen können und müssen.
d. Kausale Folge der behandlungsfehlerhaften Verzögerung im Sinne eines Primärschadens ist die Ausweitung des Volumens des Ergusses bis zur Drainage am 16.03.2003.
e. Zurechenbare Folge im Sinne eines Sekundärschadens ist das von der Klägerin beklagte Druckgefühl, eine Behinderung der Atmung und dadurch bedingtes Unwohlsein.
Von den weiteren von der Klägerin behaupteten Folgen konnte sich die Kammer nicht mit der notwendigen Sicherheit überzeugen.
Der Sachverständige Prof. Dr. R erläuterte hierzu, dass mögliche Folge der verzögerten Behandlung eines Pleuraergusses der Eintritt von Verklebungen zwischen den beiden Pleurablättern (pleura visceralis und pleura parietalis) sei, was zu einer Verringerung der Gleitfähigkeit und damit der Entfaltbarkeit der Lunge führen könne. Da bei der Klägerin mit hoher Wahrscheinlichkeit ein eiweißarmer Erguss über nur wenige Tage – vorwerfbar nur vom Morgen des 15.03. bis 16.03.2003 – bestanden habe, könne mit gutem Grund davon ausgegangen werden, dass solche Verklebungen nicht entstanden seien. Eine Quantifizierung sei nicht möglich. Dies sei nur durch eine erneute Öffnung des Bauchraumes oder Spiegelung feststellbar. Auch dann sei aber – wie der Sachverständige Prof. Dr. R in seiner mündlichen Anhörung präzisierte, nicht differenzierbar, ob die Verklebungen zu einem späteren Zeitpunkt, etwa im Krankenhaus M H entstanden sind. Ein Pleuraerguss verursache jedoch keine Schmerzen. Solche seien der Operation und der Umformung des Brustkorbes zuzurechnen, nicht aber dem Erguss.
Es kommt für die hier relevante Frage der haftungsausfüllenden Kausalität nicht darauf an, ob es sich um einen groben Behandlungsfehler handelt, da ein solcher nur zu einer Beweislastumkehr für die Kausalität zwischen Behandlungsfehler und Primärschaden führt (Geiß/Greiner, a.a.O., B. Rn. 262). Von einem groben Behandlungsfehler könnte darüber hinaus auch nicht ausgegangen werden. Zwar sprach der Sachverständige Prof. Dr. R in seinem schriftlichen Gutachten zunächst von einer nicht nachvollziehbaren Verzögerung. Im Weiteren, insbesondere auch in seiner Anhörung, ging der Sachverständige jedoch davon aus, dass eine frühere Drainierung sinnvoll gewesen wäre; einen schlechterdings nicht nachvollziehbaren Fehler verneinte der Sachverständige. Dies bestätigen insoweit auch die allgemeineren Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. D, wonach eine gewisse Einschätzungsprärogative für den entscheidenden Arzt besteht. Ein Vorgehen, welches schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar ist und einen elementaren Verstoß gegen die Regeln der ärztlichen Kunst darstellt, kann daher insgesamt nicht festgestellt werden (BGH r+s 2007, 339, 340; BGH NJW 2002, 2944, 2945 m.w.N.; Geiß/Greiner, B. V, Rn. 252; Müller, „Beweislast und Beweisführung im Arzthaftungsprozess“ NJW 1997, 3049, 3052 m.w.N.).
Soweit von einer behandlungsfehlerhaft um einen Tag (15.03. aus 16.03.2003) verspäteten Anlage der Bülaudrainage auszugehen ist, vermochte die Klägerin den ihr obliegenden Nachweis dauerhafter Beeinträchtigungen nicht zu führen. Der Sachverständige Prof. Dr. R führte in seinem schriftlichen und mündlichen Gutachten aus, dass aus einer Verzögerung folgende – hier eher unwahrscheinliche – Verklebungen nicht nachweisbar seien, und selbst wenn, diese nicht mit der erforderlichen Sicherheit der streitgegenständlichen Verzögerung zuzuordnen seien. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Sachverständige die Verletzung der Lunge im Krankenhaus Maria Hilf als mögliches Indiz für eine Verklebung ansah – es handelte sich dennoch um eine reine Mutmaßung – und dass die Klägerin darüber klagt, nun leicht aus der Puste zu kommen – das Lungenvolumen war jedoch schon vor der Operation nicht unerheblich eingeschränkt – kann die Kammer aufgrund der mannigfaltigen Unsicherheiten auch unter Berücksichtigung des Beweismaßstabes des § 287 ZPO keine ausreichende Überzeugung von Langzeitbeeinträchtigungen erlangen.
Da eine medikamentöse Behandlung eines Pleuraergusses nicht möglich ist, war die Anlage der Bülau-Drainage am 16.03.2003 nicht vermeidbar.
Haftungsauslösende Folge der behandlungsfehlerhaften Verzögerung sind daher die Beeinträchtigungen der Klägerin im Zeitraum vom Morgen des 15.03.2003 bis zur Anlage der Bülau-Drainage am 16.03.2003. Weitere, insbesondere Folge- Beeinträchtigungen konnte die Klägerin nicht nachweisen.
f. Dies rechtfertigt ein Schmerzensgeld gemäß § 253 Abs. 2 BGB in Höhe von 500 €.
Die Höhe des immateriellen Schadens ist durch das Gericht gemäß § 287 ZPO zu schätzen. Für die konkrete Bemessung des Schmerzensgeldes ist zum einen die Ausgleichsfunktion zu bewerten. Der Geschädigte soll in die Lage versetzt werden, die erlittenen immateriellen Nachteile, d.h. vor allem die Einbuße im körperlichen und seelischen Wohlbefinden, durch Vorteile auszugleichen, die sein Wohlbefinden erhöhen (Münchener Kommentar zum BGB, 4. Aufl., 2003, § 253, Rn. 10, Palandt-Grüneberg, BGB, 70. Auflage, 2011, § 253, RdNr. 11). Darüber hinaus soll die Entschädigung dem Verletzten auch eine Genugtuung dafür verschaffen, dass er durch einen Dritten in einem seiner in § 253 Abs. 2 BGB aufgezählten Rechtsgüter verletzt wurde, so genannte Genugtuungsfunktion (Münchener Kommentar, a.a.O., RdNr. 11). Der Genugtuungsfunktion kommt dabei bei Vorsatztaten besonderes Gewicht zu (Palandt, a.a.O.). Für die konkrete Bemessung der als angemessen erachteten Entschädigung sind insbesondere Art, Intensität und Dauer der erlittenen Rechtsgutverletzung in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Hier sind auf der einen Seite auch die besonderen Auswirkungen für die Folgen des Geschädigten zu berücksichtigen, wenn die Beeinträchtigung bei dem Geschädigten aufgrund seiner körperlichen Konstitution besonders ins Gewicht fällt. Auf der anderen Seite ist aber auch der Verschuldensgrad des Schädigers zu berücksichtigen, der bei ganz leichten Sorgfaltsverletzungen ein im Vergleich zum Regelfall niedrigeres Schmerzensgeld auslöst.
Zu berücksichtigen ist hierbei insbesondere, dass sich aufgrund der – bei der Klägerin bedauerlicherweise nicht unerheblichen – Operationsfolgen eine weitere Beeinträchtigung auch über die relativ kurze Dauer belastender auswirkte, als bei einem ansonsten gesunden Menschen.
Auf der anderen Seite ist zu sehen, dass der Fehler des Beklagten zu 2) auf der untersten Verschuldensebene mit einem sehr leichten Grad der Fahrlässigkeit anzusetzen ist.
Ein Schmerzensgeld in Höhe von 500 € erscheint der Kammer hierfür angemessen, aber auch ausreichend.
g. Anhaltspunkte für einen sich aus der Verzögerung ergebenden materiellen Schaden bestehen nicht, da die Klägerin – wie dargelegt – weitere Folgen nicht nachweisen konnte.
h. Der ebenfalls aufgetretene Pneumothorax war nach dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. R zwar überwachungsbedürftig, im konkreten Fall der Klägerin aber nicht behandlungsbedürftig. Behandlungsfehler ergeben sich hierbei daher nicht.
7. Anlage der PDA am 11.03.2003
Weder der Beklagte zu 2) noch die Beklagte zu 1) haften für eine fehlerhafte Katheteranlage durch die Anästhesie im Rahmen der Operation am 11.03.2003.
Im Rahmen des gespaltenen Krankenhausvertrages und der gesondert vereinbarten ärztlichen Wahlleistung schließt die Klägerin mit dem Anästhesisten einen gesonderten ärztlichen Wahlleistungsvertrag ab (§ 22 Abs. 3 S. 1 BPflV).
Eine Haftung der Beklagten zu 1) entfällt daher entsprechend der oben erfolgten Darlegungen.
Der Beklagte zu 2) haftet ebenfalls weder vertraglich noch deliktisch für Fehler des Anästhesisten, da dieser weder Erfüllungsgehilfe im Sinne des § 278 BGB noch Verrichtungsgehilfe im Sinne des § 831 BGB ist.
Der Anästhesist ist aufgrund seiner eigenen vertraglichen Beziehung zur Klägerin weder angestellter noch hinzugezogener Arzt des Beklagten zu 2). Der von der Klägerin behauptete Fehler wurde auch nicht durch den Beklagten zu 2) mitveranlasst – hierfür sind Anhaltspunkte weder vorgetragen noch ersichtlich. Die Leistungen der Anästhesie obliegen alleine dem damit beauftragten Anästhesisten.
Anspruchsgegner für eventuelle Fehlleistungen der Anästhesie ist daher nicht der Beklagte zu 2), sondern der Vertragspartner der Anästhesie (hierzu OLG Düsseldorf, MedR 2009, 285 für den Belegarzt; Martis/Winkhart, Arzthaftungsrecht, 3. Auflage 2010, Rn. K 200 ff; Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des Arztrechts, 3. Auflage 2002, § 98 Rn. 19).
8. PCA-Pumpe
Soweit die Klägerin den Beklagten vorwirft, im Rahmen der Anlage der Bülau-Drainage sei die PCA-Pumpe abgestellt worden und hierdurch der Schmerzmittelwirkstoffpegel abgesunken, folgt hieraus nicht eine Haftung der Beklagten.
Der Sachverständige Prof. Dr. R führte in seinem schriftlichen Gutachten aus, dass es aufgrund der langen Halbwertszeit der Schmerzpräparate während einer mindestens zweistündigen Unterbrechung der Schmerzmittelzufuhr nicht zu einem relevanten Absinken des Wirkstoffpegels komme.
Die Kammer schließt sich auch hier den nachvollziehbaren und überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. R an.
Darüber hinaus kann die Kammer – den Vortrag der Klägerin unterstellt – keine Überzeugung erlangen, dass Schmerzen der Klägerin unter Berücksichtigung des erst langsam absinkenden Wirkstoffpegels auf einen Bedienungsfehler bei der PCA-Pumpe zurückzuführen sind. Die Klägerin trägt vor, kontinuierlich seit Erwachen aus der Operationsnarkose unter erheblichen Schmerzen gelitten zu haben.
9. Bügelkürzungsoperation am 25.03.2003
Die Klägerin vermochte nicht, einen Behandlungsfehler des Beklagten zu 2) bei der Operation am 25.03.2003 nachzuweisen.
Nach dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. R ist die die Indikation für die Bügelkürzung bildende Überlegung nachvollziehbar. Die Kürzung durfte erfolgen und stellt daher keinen Behandlungsfehler dar.
Es bedarf keiner Entscheidung, ob nach der Bügelkürzung eine Glättung der Kanten verfahrensimmanent nicht möglich ist, wie der Beklagte zu 2) zunächst behauptete und der Sachverständige Prof. Dr. R bestätigte, oder dass eine Kantenglättung grundsätzlich durchführbar ist, wie der Beklagte zu 2) später behauptete („Diamantfeile“) und der die „Erlanger Methode“ kennende Sachverständige Prof. Dr. D bestätigte.
Nach den Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. R ist nicht feststellbar, ob es durch eventuell vermeidbar scharfe Kanten zu einer Reizung und Verursachung von Schmerzen gekommen ist.
Die Kammer folgt auch hierbei der Einschätzung des Prof. Dr. R . Zur Überzeugungsbildung der Kammer ausreichend sichere Anhaltspunkte für eine Schmerzverursachung durch eine eventuell vorhandene Kante sind nicht vorhanden, zumal vor und nach der Kürzung erheblichste Schmerzen durch die Klägerin behauptet werden. Schon dies lässt an einem Einfluss einer bei der Kürzung möglicherweise entstandenen scharfen Kante Zweifel aufkommen. Nachdem die Verursachung von Beschwerden nach beiden Sachverständigen Prof. Dr. R und Prof. Dr. D auch „nur“ möglich ist, keineswegs aber eine normale oder wahrscheinliche Folge darstellt, kommen der Klägerin auch keine Beweiserleichterungen etwa nach den Grundätzen des Anscheinsbeweises zugute.
Die Klägerin vermochte den ihr obliegenden Beweis einer Reizung, Irritation und/oder Schmerzverursachung durch die Schnittstelle des Bügels nicht zu führen.
Mangels Nachweises dieses Schadens führt eine – unterstellt – unterbliebene Aufklärung über möglicherweise verbleibende scharfe Kanten nicht zu einer Haftung des Beklagten zu 2) (vgl. oben Ziff 2. b. (4)).
10. Schmerztherapeutischer Eingriff am 27.03.2003
Auch hinsichtlich des schmerztherapeutischen Eingriffes am 27.03.2003 liegt im Falle eines behandlungsfehlerhaften Vorgehens keine Haftung der Beklagten vor.
Die Kammer nimmt Bezug auf die Ausführungen oben Ziff. 7. Es käme insoweit allenfalls eine Haftung des Anästhesisten in Betracht.
11. Entlassung ohne Abschlussuntersuchung
Die von der Klägerin als fehlend geschilderte Abschlussuntersuchung habe so der Sachverständige Prof. Dr. R, in ausreichendem Maße stattgefunden.
Die Kammer konnte keine Überzeugung eines behandlungsfehlerhaften Vorgehens erlangen. Die Klägerin verkennt, dass auch die in den Tagen vor Entlassung durchgeführten Untersuchungen und der sich daraus ergebende Befundverlauf im Rahmen einer Abschlussbeurteilung einzubeziehen sind.
12. Bügel-Entfernungsoperation am 06.08.2003
Der Beklagte zu 2) haftet nicht aufgrund eines Aufklärungs- oder Behandlungsfehlers hinsichtlich der Operation zur vorzeitigen Entfernung des Bügels am 06.08.2003.
a. Ein Aufklärungsfehler hinsichtlich der Möglichkeit eines Rezidives hätte sich – sein Vorliegen unterstellt – nicht ausgewirkt, da die Klägerin über die Möglichkeit eines Rezidivs, d.h. eines Einsinkens der operierten Trichterbrust bereits aufgeklärt und informiert war.
Wie sich aus dem von der Klägerin vorgelegten Schreiben des Prof. Dr. S (Anlage K16) vom 17.07.2003 ergibt, ging es bei dessen Konsultation durch die Klägerin und ihren Vater um das nun beste zu wählende Verfahren. Es bestehe „noch eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trichter wieder verstärkt. Um das zu verhindern, muß überlegt werden, ob in gleicher Narkose der Ravitch-Bügel entfernt und durch einen Nuss-Bügel ersetzt werden kann. (…) Alle genannten Möglichkeiten haben wir in einem langen Gespräch durchgesprochen“. Die Klägerin werde sich das in den nächsten Tagen überlegen müssen.
Hieraus folgt für die Kammer, dass die Klägerin über die Möglichkeit eines Rezidivs bei vorzeitiger Bügelentfernung entgegen ihrer Behauptung – diese erscheint der Kammer im Hinblick auf § 138 Abs. 1 ZPO höchst bedenklich – gründlich informiert war.
Gegenstand der Risikoaufklärung ist, dem Patienten in einer seinem Verständnis als medizinischem Laien zugänglichen Weise eine allgemeine Vorstellung zu vermitteln, von der Art und dem Schweregrad der in Betracht stehenden ärztlichen Behandlung, von den Belastungen und von den wesentlichen Risiken, denen er sich in der Behandlung ausgesetzt sieht. Nur wenn eine solche hinreichende Selbstbestimmungsaufklärung vorliegt, liegt eine wirksame Zustimmung des Patienten zum Eingriff vor, die diesen zu einem rechtmäßigen bzw. gerechtfertigten Eingriff ohne Haftungsfolgen macht (BGH VersR 1993, 102).
Da die Klägerin das Risiko eines Rezidivs kannte, konnte sie es in die Entscheidung für oder gegen die Operation am 06.08.2003 einbeziehen. Selbst wenn über ein tatsächlich bestehendes Risiko nicht aufgeklärt wurde, führt dies nicht zu einer Haftung des Beklagten zu 2), wenn die Klägerin – wie hier – das Risiko kannte. Denn die Aufklärung erfolgt nicht um ihrer Selbstwillen, sie soll dem Patienten vielmehr die für die Operationsentscheidung erforderlichen Informationen im Großen und Ganzen vermitteln. Ein dem Patienten bekanntes Risiko kann dieser – auch ohne dass der Arzt (nochmals) darüber aufklärt – in seine Entscheidung einbeziehen, so dass eine wirksame Einwilligung vorliegt.
Es kann daher dahinstehen, ob die Klägerin über diesen Punkt durch den Beklagten zu 2) aufgeklärt worden war.
b. Die Indikationsstellung zur Entfernung des Bügels war nicht fehlerhaft.
Der Sachverständige Prof. Dr. R bezeichnet auch die Überlegung, dass die von der Klägerin geklagten erheblichen Schmerzen ihre Ursache in dem eingesetzten Bügel fänden, als nachvollziehbar.
Die Kammer vermag in der Entfernung des Bügels keinen Behandlungsfehler zu erkennen. Die Überlegung einer Entfernung des Bügels ist sowohl nach dem Sachverständigen Prof. Dr. R nachvollziehbar, als auch von den von der Klägerin konsultierten Prof. Di (Anlage K15) und Prof. S (Anlage K16) angedacht bzw. empfohlen worden. Einen Verstoß gegen den anerkannten und gesicherten Stand der ärztlichen Wissenschaft stellt sie daher nicht dar.
Die Klägerin verkennt, dass es in der medizinischen Wissenschaft aufgrund der Physiologie des menschlichen Körpers nicht in allen Fällen nur eine einzige Behandlung geben kann. Insbesondere im streitgegenständlichen Fall war die Entstehung der Schmerzen der Klägerin gerade unklar, wobei neben dem Beklagten zu 2) auch die konsultierten Ärzte den Bügel als mögliche Ursache ansahen. Diese Unsicherheit begründet sich im menschlichen Körper, dessen gezeigte Symptome nicht immer eindeutig auf eine Ursache zurückzuführen sind. Entsprechend wird von der Rechtssprechung ein Diagnosefehler nur in groben Fällen als vorwerfbar angenommen (vgl. nur OLG Frankfurt, Urteil vom 23.12.2008, Az. 8 U 146/06). Aus der schlicht nicht zu vermeidenden Unsicherheit über die Ursachen für bestimmte Beschwerden folgt aber, dass – sofern wie hier eine weitere Abklärung nicht möglich ist – in Absprache mit dem Patienten die möglicherweise einschlägige Ursache behandelt werden darf. Es ist auch ein Ausfluss dieser nicht vorwerfbaren Unsicherheit, dass die Behandlung einer nachvollziehbar möglichen, aber letztlich nicht zutreffenden vermuteten Ursache keinen Behandlungsfehler darstellt.
Dass die Klägerin über diese Unsicherheit bzw. den „Versuchscharakter“ der Bügelentfernung nicht informiert war, behauptet sie selbst nicht dezidiert. Anderes ergibt sich darüber hinaus auch aus dem von ihr vorgelegten Arztbrief des Prof. Dr. S .
13. Schmerzen
Die Kammer verkennt nicht, dass bei der Klägerin bedauerlicherweise ein äußerst ungünstiger Verlauf mit wohl außergewöhnlicher Schmerzentwicklung vorliegt. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme und der hierdurch erlangten Überzeugung der Kammer kann dieser Verlauf, insbesondere die außergewöhnliche Schmerzentwicklung jedoch nicht auf ein behandlungsfehlerhaftes Vorgehen der Beklagten zurückgeführt werden.
Das Ausmaß der von der Klägerin beschriebenen Schmerzen könne, so Prof. Dr. R, nicht der Operation vom 11.03.2003 zugeschrieben werden. Da die Klägerin schon vor der Operation wegen chronischer Schmerzen in vielfältiger ärztlicher Behandlung einschließlich einer Schmerztherapie gewesen sei, sei es auch möglich, dass die Schmerzen ohne Neigung zur Aggravation individuell als wesentlich stärker und psychisch belastender erlebt werden.
Auch in seiner mündlichen Anhörung hielt es Prof. Dr. R für wahrscheinlich, dass die Beschwerden der Klägerin nicht auf die streitgegenständliche Operation, sondern z.B. auf eine Wirbelsäulenerkrankung und/oder eine neurologische Vorerkrankung zurückzuführen seien.
III. Nebenentscheidungen
1. Der Klägerin steht gemäß §§ 280 Abs. 1, 249 BGB auch der Ersatz der vorgerichtlich entstandenen Rechtsanwaltskosten zu, wobei hier ein Gegenstandswert von 500 € zugrunde zu legen ist.
Die Klägerin kann hierbei auch eine 2,5-Geschäftsgebühr ansetzen aufgrund der selbst für Arzthaftungsfälle überaus umfangreichen und komplizierten Sach- und Rechtslage.
Die Klägerin hat daher einen Anspruch in Höhe von 157,68 €.
2,5-Gebühr §§ 2, 13 RVG, Nr. 2400 VV 112,50 €
Post- und Telekommunikationspauschale 20,00 €
19 % Umsatzsteuer 25,18 €
Gesamt 157,68 €
2. Die Zinsentscheidung folgt aus §§ 286, 288 BGB i. V. m. dem Schreiben vom 05.08.2005 hinsichtlich des geltend gemachten Schmerzensgeldes sowie aus § 291 BGB hinsichtlich der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten.
3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 709 ZPO.
Beschluss: Der Streitwert wird auf 665.531,21 € festgesetzt.
[Antrag zu 1) 150.000 €, Antrag zu 2) 6.332,41 €, Antrag zu 3) 19.198,80 €, Antrag zu 4) 480.000 € gemäß § 42 Abs. 2 GKG ausgehend von monatlich 10.000 € abzgl. 20% wegen Feststellungsantrag, Antrag zu 5) 10.000 €]