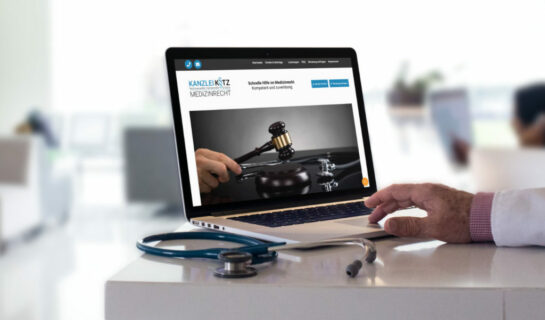OLG Jena – Az.: 4 U 26/11 – Urteil vom 06.03.2012
Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts Gera vom 17.12.2010 – Az.: 3 O 1016/02 – wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens fallen dem Kläger zur Last.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Kläger kann die Vollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des vollstreckbaren Kostenbetrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
I.
Der Kläger nimmt die Beklagte wegen (streitiger) ärztlicher Fehlbehandlung und (gleichfalls streitigen) Aufklärungsversäumnisses auf Schadensersatz in Anspruch.
Am 15.09.2001 stürzte der damals 54jährige (am 26.02.1947 geborene) Kläger beim Pflaumenpflücken aus 2 m Höhe von der Leiter. Mit Rückenschmerzen in der LWS-Region, die in den rechten Oberschenkel ausstrahlten, wurde er in die Notaufnahme der Beklagten eingeliefert und anschließend in der Neurochirurgischen Klinik stationär aufgenommen.
Schon im Vorfeld des Unfallereignisses hatte der Kläger unter (teilweise gravierenden) Beschwerden an der Wirbelsäule zu leiden. Die schwerste Verletzung geht auf das Jahr 1980 zurück; hier zog sich der Kläger bei einem Arbeitsunfall eine Querschnittslähmung zu, die sich in der Folge aber wieder komplett zurückbildete. Weitere (behandlungsbedürftige) Rückenbeschwerden gab es 1996 und 2000. Die erste (ambulante) Vorstellung in der Neurochirurgie der Beklagten fand im Sommer 1996 statt; und zwar wegen eines Bandscheibenvorfalls L5/S1 rechts bei gleichzeitiger Bandscheibenprotusion L5/S1 rechts sowie Bandscheibendegeneration L4 bis S1. Behandelt wurde konservativ mit Krankengymnastik u.ä. Im Frühjahr 2000 stellte sich der Kläger mit einer akuten rechtsbetonten Lumbalgie erneut (ambulant) in der Neurochirurgie vor. Es folgte wieder eine konservative Behandlung.
Anders als die ambulant behandelten Rückenprobleme der Jahre 1996 und 2000 führte das Unfallereignis vom 15.09.2001 zu einer stationären Behandlung in der Neurochirurgie der Beklagten. Im Ergebnis umfangreicher klinischer und apparativer Untersuchungen (Röntgenaufnahmen, CT der BWS und LWS, MRT der LWS) stellten die behandelnden Ärzte am 15.09.2001 eine Kompressionsfraktur des zweiten Lendenwirbelkörpers (LWK-2-Fraktur mit Beteiligung der Hinterkante und Verlagerung der Frakturfragmente nach dorsal und spinaler Einengung) fest. Die Indikation für einen operativen Eingriff wurde (zunächst) noch nicht gesehen; man wartete ab und beobachtete den Kläger.
Am 16.09.2001 führte der Zeuge Dr. E. mit dem Kläger ein Therapiegespräch über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten der Fraktur (konservative Ruhigstellung oder operatives Vorgehen); eine ärztliche Empfehlung zur Operation bestand zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Gleichwohl unterzeichnete der Kläger (vorsorglich) schon im Ergebnis des mit dem Zeugen Dr. E. geführten Gesprächs am 16.09.2001 eine „Einwilligung in ärztlichen Eingriff“ zu der – so der handschriftliche Eintrag auf dem Einwilligungsbogen – „vorgesehenen Maßnahme: Stabilisierungsoperation- LWK 1-3; Fixateur, Navigation/CT; Beckenkammspanentnahme“ (Einwilligungsbogen vorgelegt als Anlage B10, Bd. I Bl. 60).
Am 17.09.2001 hatte sich das Beschwerdebild gegenüber dem Aufnahmezustand verschlechtert (schwächere Beweglichkeit des rechten Beines mit deutlich verringerter Fußhebung). Ein erneut gefertigtes MRT zeigte im Vergleich zur Voraufnahme vom 15.09.2001 nun eine deutlichere Einengung des Spinalraumes auf nur noch 11 mm und eine deutliche Einengung des ventralen Thekalraumes in Frakturhöhe. Chefarzt und Oberarzt sahen deshalb nun die Indikation für den stabilisierenden Eingriff im Segment L1 bis L3, nachdem sich auch das Becken des Klägers in der Röntgenaufnahme als unauffällig (problemlos für die Beckenkammspanentnahme) gezeigt hatte.
Am 18.09.2001 führten zwei Oberärzte der Neurochirurgischen Klinik der Beklagten den geplanten Eingriff durch. Im OP-Bericht (Anlage B11, Bd. I Bl. 61) heißt es hierzu auszugsweise wie folgt:
„Bauchlagerung auf dem Operationstisch. Höhenlokalisation im CT-Scan. Medianer Hautschnitt von BWK 12 – LWK 4. Subperiostale Abschiebung der Rückenmuskulatur bds.. Zunächst Einbringen der Markerschrauben in LWK 1 und LWK 3. Nach Durchführung des Planungs-CTs wurden sodann die Pedikel der LWK 1 und 3 mit dem scharfen Pfriem aufgesucht und sondiert. Im LWK 3 wurden 8 x 45 mm Schrauben eingebracht, in LWK 1 eine 6,7 x 45 mm-Schraube und eine 6,7 x 45 mm Schraube. Nochmalige CT-Untersuchung und Dokumentation des regelrechten Schraubensitzes. Mit der Mikrofräse wurde sodann der Halbbogen LWK 2 und der Halbbogen LWK 1 teilabgetragen. Fensterung des Ligamentum flavum LWK 1/2 und von dort ausgehend mit den Flachschuhstanzen. Freilegen des Spinalkanals. ….Im Foramen LWk 1/2 rechts fanden sich kleinere Knochenfragmente, die die Nervenwurzel L! komprimierten. Diese wurden entfernt. Die Nervenwurzel L2 und der Duralsack waren von rechts ebenfalls deutlich knöchern komprimiert und wurden schrittweise freigestanzt. Hier muss auch von einer vorbestehenden Rezessusstenose ausgegangen werden. Schließlich waren die nervalen Strukturen wieder frei und locker. Es wurde nun in das Bandscheibenfach LWK 1/2 eingegangen. In Bandscheibenhöhe war das kleine Wirbelgelenk teilabgetragen worden. Das Bandscheibenfach war dorsal sehr flach und wurde mit den scharfen löffeln entsprechend erweitert. Anschließend wurde das verletzte Bandscheibengewebe aus der Etage komplett entfernt. Mit den scharfen Löffeln wurde sodann die Knorpelfläche im Zwischenwirbelraum komplett abgezogen. Über einen 5 cm langen Schnitt über dem rechten Beckenkamm dorsallateral wurde dieser dargestellt. Nach Freipräparieren des Beckenkammes ventral und dorsal ….wurde mit der Säge ein 4 cm langer Span ausgesägt…..Der Beckenkamm wurde in 4 kleinere Stücke geteilt und in das Bandscheibenfach mit dem Stößel eingebracht….Die vordere Hälfte des Zwischenwirbelraumes konnte komplett aufgefüllt werden. Anschließend wurden die Stäbe des Fixateurs eingebracht und fest verschraubt. …..“
Am folgenden Tag – am 19.09.2001 – wurde der Kläger von der Intensivstation auf die „normale“ Station zurückverlegt. Er konnte alle Muskelgruppen deutlich kräftiger bewegen als vor der Operation. Paresen waren im Wesentlichen nicht feststellbar; auch keine sensiblen Störungen.
Eine Röntgenkontrolluntersuchung erfolgte am 21.09.2001. Das Röntgenbild zeigte einen regelrechten Sitz des Fixateurs interne; Anhaltspunkte für eine Lockerung gab es – so die Behandlungsdokumentation – nicht.
In der Folgezeit wurde der Kläger unter Zuhilfenahme eines Korsetts immer weiter mobilisiert. Die Fäden wurden am 28.09.2001 bei reizlosen Wundverhältnissen entfernt. Am 01.10.2001 wurde der Kläger – so heißt es im Entlassungsbrief (Anlage K1, Bd. I Bl. 19) – „ohne neurologische Defizite, voll mobilisiert mit Rahmenstützkorsett“ zur Anschlussheilbehandlung (AHB) entlassen, die er am 03.10.2001 in der Moritzklinik in Bad Klosterlausnitz antrat.
Im Verlauf der AHB verspürte der Kläger wieder zunehmend Schmerzen. Anlässlich seiner (bevorstehenden) Entlassung wurde am 29.10.2001 eine Röntgenaufnahme der LWS gefertigt, die die Ärzte der Moritzklinik im vorläufigen Entlassungsbericht vom gleichen Tage (Anlage K2, Bd.I Bl. 20) zu der Einschätzung veranlasste „Rö-Bild mit Verdacht auf Lockerung der Protektorschrauben des Fixateur interne, würde subj. Beschwerden im OP-Gebiet erklären“.
Noch am Tag der Entlassung aus der AHB, also am 30.10.2001 stellte sich der Kläger erneut in der Neurochirurgie der Beklagten vor. Die stationäre Aufnahme in der Neurochirurgie erfolgte – wegen des Entlassungsberichts der Moritzklinik und der wieder zunehmenden Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in beide Beine – unter dem Verdacht einer Schraubendislokation L1 links und zum Ausschluss einer Spondylodiszitis.
Im Ergebnis der klinischen und apparativen (bildgebenden) Untersuchung (CT und MRT) vom Aufnahmetag konnten die Ärzte der Beklagten zwar keine Dislokation (Materiallockerung) feststellen; der stationäre Aufenthalt dauerte aber dennoch bis zum 06.11.2011 an. Der Kläger wurde konservativ behandelt (Bettruhe, Krankengymnastik, Physiotherapie, Schmerztherapie etc.). Im Entlassungsbrief vom 06.11.2001 (Anlage K4, Bd. I Bl. 22) heißt es, dass es unter der konservativen Therapie zu einem langsamen Rückgang der Symptomatik gekommen sei, so dass der Kläger aktuell gut zurecht käme und vollständig mobilisiert entlassen werden könne. Als Wiedervorstellungstermin zur Nachkontrolle wurde der 03.12.2001 bestimmt.
Zu einer Nachkontrolle in der Neurochirugie der Beklagten kam es jedoch nicht mehr. Vielmehr stellte sich der Kläger wegen progredienter Schmerzen mit Ausstrahlung in beide Beine und begleitenden Kribbelparästesien am 30.11.2001 in der Zentralklinik Bad Berka vor. In der dortigen orthopädischen Klinik wurde er am 18.12.2001 mit der Verdachtsdiagnose Pseudarthrose nach dorsaler Stabilisierung L1 bis bei LWK 2-Fraktur stationär aufgenommen.
Bei der klinischen Aufnahmeuntersuchung in Bad Berka hatte der Kläger ein breitbeiniges, hinkendes Gangbild. Ein am 19.12.2001 gefertigtes MRT der LWS zeigte „im Verlauf eine weitere Deckplattenimpression LWK 2 mit gering zunehmender Gibbusbildung und gering zunehmender Dorsalvorwölbung von Hinterkantenanteilen“ (vgl. hierzu den Entlassungsbericht v. 28.01.2002; Anlage K5, Bd. I Bl. 23f.).
Daraufhin erfolgte am 21.12.2001 die dorso-ventrale Revisionsoperation mit dorsaler Korrekturspondylodese und Uminstrumentation L1 bis L3 sowie ventraler Respondylodese L 1/2 und L 2/3 über einen minimalinvasiven retroperitonealen Zugang von links. (vgl. hierzu im Einzelnen den als Anlage K6, Bd.I Bl. 25f. vorgelegten OP-Bericht).
Am 15.01.2002 wurde der Kläger – wie es der Entlassungsbericht (Anlage K5, Bd. I Bl.23f.) formuliert – „bei Wohlbefinden“ entlassen.
Er hat in erster Instanz zuletzt ein Schmerzensgeld von zumindest 130.000 €, daneben die Feststellung der Ersatzpflicht der Beklagten für künftige materielle wie immaterielle Schäden begehrt.
Zur Begründung von Leistungs- und Feststellungsantrag hat sich der Kläger
– neben dem Behaupten einer insbesondere im Hinblick auf Behandlungsalternativen nicht hinreichenden Aufklärung und deshalb fehlenden Einwilligung in die Operation vom 18.09.2001 – im Wesentlichen auf die Rüge von zwei Behandlungsfehlern gestützt. Die Operation vom 18.09.2001 sei fehlerhaft durchgeführt worden, sodass sich eine Schraubenlockerung am LWK 1 links und hieraus resultierend ein Knochenmarködem entwickelt habe; die Hinterkante des operierten Wirbels habe sich in den Spinalkanal vorgewölbt. Wegen der fehlerhaften (Erst-)Operation und einer fehlerhaft unterlassenen weiterführenden Befunderhebung und Diagnostik im Zeitraum vom 30.10. bis 06.11.2001. sei die Revisionsoperation in Bad Berka erforderlich geworden. Als Folge des insgesamt behandlungsfehlerhaften Vorgehens in der Neurochirurgie der Beklagten seien schmerzhafte Bewegungseinschränkungen im Bereich der LWS zurückgeblieben; daneben eine inkomplette Parese des Nervus axillaris mit noch ablaufender akuter Denervierung. Diese Gesundheitsstörungen hätten dazu geführt, dass der Kläger ähnlich dem Krankheitsbild einer inkompletten Querschnittslähmung unter voraussichtlich dauerhaft verbleibenden neurologischen Schäden leide. Er müsse dreimal wöchentlich eine häusliche Physiotherapie in Anspruch nehmen. Durch die Nervenlähmung sei er in der Hüft- und Blasenregion völlig gefühllos. Im Bereich der Oberschenkel seien auch beide Beine gefühllos; er könne nur mühsam und unter starken Schmerzen bis max. 250 m gehen. Schließlich sei infolge der Nervenschädigung auch der linke Arm nur eingeschränkt bewegungsfähig und leide er auch noch unter Schluckstörungen.
Im Gesamtergebnis der erheblichen Gesundheitsschäden werde der Kläger – so sein Vortrag – voraussichtlich dauerhaft berufsunfähig bleiben.
Wegen der (weiteren) Einzelheiten des unstreitigen und streitigen Parteivortrags der ersten Instanz und der dort gestellten Anträge wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils Bezug genommen.
Mit Urteil vom 17.12.2010 hat das Landgericht die Klage nach umfangreicher Beweisaufnahme (Vernehmung des Zeugen Dr. E. zur OP-Aufklärung im Termin v. 18.03.2003, Bd. I Bl. 142ff.; Vernehmung der Zeugen Dr. E. und Dr. Ech. zur Erhebung eines neurologischen Entlassungsbefundes am 06.11.2001 in den Terminen v. 12.09. und 28.11.2006, Bd. II Bl. 463ff. und Bl.475ff.; orthopädisches Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. F. v. 26.01.2004 nebst fünf schriftl. Ergänzungen v. 16.07.2004, Bd.I Bl. 237ff.; 05.07.2004, Bd. I Bl. 240ff.; 07.07.2004, Bd. I Bl. 245ff.; 04.07.2005, Bd. II Bl. 320ff.; 10.01.2006, Bd. II Bl. 363ff.; und einer mündlichen Erläuterung im Termin v. 10.01.2006, Bd. II Bl. 368ff.; neurochirurgisches Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. M. v. 17.03.2008, Bd. III Bl. 554ff.; nebst schriftl. Ergänzung v. 25.05.2009, Bd. III Bl. 599 und mdl. Erläuterung im Termin v. 19.06.2009, Bd. III Bl. 625ff.) abgewiesen.
Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt, der Kläger habe nach ordnungsgemäßer Aufklärung durch den Zeugen Dr. E. am 16.09.2001 wirksam in die Operation eingewilligt, auch wenn zu diesem Zeitpunkt die Operationsindikation noch nicht sicher gewesen sei. Eine Aufklärung über eine andere Operationsmethode, nämlich die (zusätzliche) ventrale Abstützung der Frakturzone und der ausgeräumten Bandscheibe sei nicht erforderlich gewesen, da im Jahr 2001 allein die dorsale Operationsmethode, (noch) nicht aber die kombinierte dorsoventrale Technik dem Standard entsprochen habe. Die standardgerecht gewählte Operationsmethode sei auch regelgerecht durchgeführt worden. Die Operation sei indiziert gewesen und standardgemäß praktiziert worden; und zwar auch in Bezug auf die korrekte Lagerung der Arme während der Operation. Demzufolge seien sowohl die Implantatlockerung, als auch die Schädigung des Nervus axillaris schicksalhaft und keine Folgen eines Behandlungsfehlers.
Ob den Ärzten der Beklagten beim zweiten stationären Aufenthalt (vom 30.10. bis 06.11.2001) eine Fehleinschätzung bezüglich der Implantatlockerung vorzuwerfen sei, könne dahingestellt bleiben. Selbst wenn die Feststellung im Entlassungsbericht (kein Anhalt für eine Materialdislokation) falsch gewesen sei, habe der Kläger jedenfalls nicht nachweisen können, dass ein früheres Erkennen der Implantatlockerung und damit eine frühere Revisionsoperation die aktuellen Gesundheitsbeeinträchtigungen vermieden hätte. Auf eine Beweislastumkehr zu seinen Gunsten könne sich der Kläger nicht berufen; als grob sei ein – unterstellter – Behandlungsfehler jedenfalls nicht zu bewerten; und zwar auch nicht in Bezug auf eine als Befunderhebung unterlassene neurologische Abschlussuntersuchung.
Gegen das seinem Prozessbevollmächtigtem am 03.01.2011 zugestellte Urteil hat der Kläger am 11.01.2011 Berufung eingelegt und diese – nach Fristverlängerung bis dahin – am 04.04.2011 begründet.
Die Berufung greift das landgerichtliche Urteil in zwei Punkten an.
Zum Einen bleibt der Kläger dabei, dass es wegen des Unterlassens einer ordnungsgemäßen Aufklärung an der erforderlichen Einwilligung in die Operation vom 18.09.2001 gefehlt habe. Mit dem in wesentlichen Teilen falschen Aufklärungsbogen und der unergiebigen Aussage des Zeugen Dr. E. habe die Beklagte eine hinreichende und zutreffende Aufklärung nicht bewiesen. Zudem sei unstreitig keine Aufklärung über die vom Sachverständigen Prof. Dr. F. im Heilungspotential als überlegen eingestufte dorsoventrale Operationsalternative erfolgt, obgleich diese Alternativmethode schon 2001 erfolgreich praktiziert worden sei und deshalb ein Aufklärungsbedarf bestanden habe.
Zum Anderen rügt der Kläger nach wie vor das Unterlassen einer weiterführenden Diagnostik und Befunderhebung in der Zeit vom 30.10. bis 06.11.2001 und danach; das Unterlassen einer neurologischen Abschlussuntersuchung und engmaschiger Kontrolluntersuchungen nach der Entlassung stelle einen groben Befunderhebungsfehler dar. In diesem Kontext wirft der Kläger dem Landgericht vor, den „zahlreichen“ Widersprüchen in den Gutachten der Sachverständigen Prof. Dr. F. und Prof. Dr. M. nicht nachgegangen zu sein.
Der Kläger beantragt, unter Aufhebung des angefochtenen Urteils den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückzuverweisen, hilfsweise im Falle einer eigenen Sachentscheidung des Senats unter Abänderung des angefochtenen Urteils,
1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger ein in das Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld, mindestens jedoch 130.000 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz aus 40.000 € seit dem 01.07.2002 sowie aus 90.000 € seit Rechtshängigkeit zu zahlen,
2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtliche weiteren materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen, die diesem durch die Operation vom 18.09.2001 sowie durch die ärztlich fehlerhafte Behandlung vom 30.10.2001 bis 06.,11.2001 entstanden sind und zukünftig entstehen werden, soweit diese Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergehen.
Die Beklagte verteidigt das Urteil des Landgerichts und beantragt, die Berufung zurückzuweisen.
II.
Die Berufung des Klägers ist zulässig. Sie ist statthaft (§ 511 ZPO) und auch im Übrigen in verfahrensrechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden; insbesondere ist sie form- und fristgerecht erhoben sowie begründet worden (§§ 517, 519, 520 Abs. 2, 3 ZPO).
In der Sache bleibt die Berufung aber ohne Erfolg. Das Landgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen. Die Beklagte haftet dem Kläger weder aus Vertrag (§ 280 BGB), noch aus Delikt (§§ 823, 831 BGB) auf (materiellen und immateriellen) Schadensersatz. Im Ergebnis der erstinstanzlichen Beweisaufnahme steht fest, dass der Beklagten kein haftungsbegründender Fehler ihres ärztlichen Personals vorzuwerfen ist. Ihr ist weder ein Aufklärungsfehler (Aufklärungsversäumnis) im Vorfeld der Operation vom 16.09.2001, noch ein Behandlungsfehler (bei der Wahl der Operationsmethode und der Operationsdurchführung, bei der Interpretation der Röntgenaufnahmen der Moritzklinik vom 29.10.2001 und bei der Erhebung nachfolgender Kontrollbefunde) anzulasten; zumindest fehlt es an der haftungsbegründenden Kausalität. Einer ergänzenden Beweisaufnahme in der zweiten Instanz bedurfte es nicht. Die entscheidungserheblichen Tatsachen sind schon vom Landgericht fehlerfrei festgestellt worden.
In Anlehnung an die Chronologie der haftungsrechtlich zu bewertenden Ereignisse ist im Einzelnen Folgendes auszuführen:
Das Landgericht ist in Würdigung des als Anlage B 10 (Bd. I Bl. 60) vorgelegten Einwilligungsbogens und der Aussage des Zeugen Dr. E. vom 18.03.2003 (Bd. I Bl. 142ff.) davon ausgegangen, dass der Kläger am 16.09.2001 hinreichend und ordnungsgemäß über die zwei Tage später – am 18.09.2001 – durchgeführte Operation aufgeklärt worden ist. Hiergegen gibt es nichts zu erinnern. Die Beklagte haftet also nicht bereits wegen unterlassener, bzw. ungenügender Behandlungs- und Risikoaufklärung.
Dass am 16.09.2001 ein Aufklärungsgespräch zwischen dem Kläger und dem Zeugen Dr. E. stattgefunden hat, steht außer Streit. Der Kläger rügt lediglich den Zeitpunkt desselben als falsch (zu früh) und daneben den Inhalt der Aufklärung als ungenügend.
Zur Behandlungsaufklärung (als Kernstück der vom Arzt geschuldeten Aufklärung) gehört zunächst die Erläuterung der Art der konkreten Behandlung; daneben aber auch der Tragweite des Eingriffs. Unter letzterem Gesichtspunkt ist die Grenze zur Risikoaufklärung fließend. Gegenstand derselben ist die Frage, inwieweit der Patient über die mit fehlerfreier medizinischer Behandlung möglicherweise verbundenen Schädigungsrisiken aufzuklären ist; seien es mögliche Eingriffskomplikationen in der Operation, seien es sonstige schädliche Nebenfolgen aus dem Eingriff. Schließlich gehört zur Behandlungsaufklärung noch, dass der Arzt dem Patienten die Kenntnis von echten Behandlungsalternativen verschaffen muss. Art und Weise (Umfang) der Aufklärung wird dabei bestimmt und begrenzt von der Notwendigkeit, dem Patienten als medizinischen Laien eine allgemeine Vorstellung von der in Betracht stehenden ärztlichen Behandlung, von den Belastungen und den Risiken, denen er sich in der Behandlung ausgesetzt sieht, zu vermitteln. Aufklärung soll also nicht medizinisches Detailwissen vermitteln, sondern eine ergebnisbezogene zutreffende Entscheidungsgrundlage für die Selbstbestimmungskompetenz des Patienten; dieser muss dementsprechend (nur) „im Großen und Ganzen“ aufgeklärt werden (ständige BGH-Rechtspr.; NJW 2000, 1784; VersR 1992, 960; 238; 1991, 777).
Gemessen an diesen Grundsätzen ist der Kläger vom Zeugen Dr. E. hinreichend und ordnungsgemäß aufgeklärt worden.
Der Zeuge Dr. E. hat ausgesagt, dem Kläger in einem „Therapiegespräch“ die (beiden) Behandlungsmöglichkeiten, nämlich die konservative Methode der Ruhigstellung und die operative Methode vorgestellt zu haben. Für beide Varianten seien (auch) die Risiken besprochen worden; und zwar für die operative Variante entsprechend des „Fettgedruckten“ auf dem (schon vorbereiteten) Einwilligungsbogen. Die im Formular enthaltenen (fettgedruckten) Risiken gehe er – so der Zeuge – bei Aufklärungsgesprächen regelmäßig Punkt für Punkt mit dem Patienten durch; sie dienten als „Leitfaden“ für das Gespräch. Daneben erläutere er regelmäßig im Einzelnen, wie der Eingriff selbst vonstatten gehe.
Diese plausible Schilderung ergibt in der Gesamtschau mit dem vom Kläger unterzeichneten Einwilligungsbogen die Feststellung einer ordnungsgemäßen Behandlungs- und Risikoaufklärung, wie sie das Landgericht im Ergebnis – nur ohne diese Begrifflichkeiten zu verwenden – beanstandungsfrei getroffen hat. Dass sich der Zeuge Dr. E. (der Sache nach gut nachvollziehbar) an die Details des von ihm geführten Aufklärungsgesprächs nicht mehr erinnern konnte, lässt seine Aussage – entgegen dem Dafürhalten des Klägers – nicht unergiebig erscheinen. Steht – wie hier – die Tatsache des Aufklärungsgesprächs fest, kommt es nicht mehr entscheidend darauf an, ob der Arzt sich noch an den konkreten Inhalt des Gesprächs erinnert. Der Nachweis des üblichen Inhalts eines solchen Gesprächs kann dann genügen (OLG Brandenburg VersR 2000, 1283).
So ist es hier, denn das vom Kläger unterzeichnete Einwilligungsformular hat eine die Schilderungen des Zeugen stützende Indizwirkung dafür, dass am 16.09.2001 eine Aufklärung über die Art und Weise des operativen Eingriffs und dessen Risiken erfolgt ist.

Im Formular ist zunächst die operative Maßnahme (handschriftlich) näher skizziert, und zwar so, dass die vom Zeugen geschilderte Leitfadenfunktion für den das Aufklärungsgespräch führenden Arzt absolut plausibel ist („Stabilisierungsoperation LWK 1 – 3, Fixateur, Navigation /CT, Beckenkammspanentnahme“). Daneben enthält das Formular – ebenfalls stichwortartig im Sinne eines Gesprächsleitfadens – eine (fettgedruckte) Liste möglicher Risiken (u.a. „neurologische Ausfälle (Sensibilitätsausfälle, Lähmungen, Blasen-, Mastdarmstörung), Lagerungsschäden, Materialbruch bzw. dislokation“).
Dass es im Formular heißt „Ich wurde darüber informiert, dass die oben genannte Maßnahme bei meinem Enkelkind / Kind durchgeführt werden soll“, schmälert die Indizwirkung schon deshalb nicht, weil abweichend hiervon als Patient (handschriftlich und korrekt) der Kläger selbst eingetragen ist. Zu einer (beweisrechtlichen) Entwertung – wie der Kläger meint – führt der Umstand, dass der Zeuge Dr. E. das Aufklärungsgespräch mit einem (nur) formal falschen, jedoch inhaltlich in Bezug auf Behandlung und Risiken richtigen (zutreffenden) Formular als Leitfaden geführt hat, nicht.
Steht damit fest, dass der Kläger eine ordnungsgemäße Risikoaufklärung erfahren hat und auch über die einzelnen Schritte der Operation selbst (im Großen und Ganzen) aufgeklärt worden ist, war eine – unstreitig nicht erfolgte – weitere Aufklärung über eine andere OP-Methode, nämlich die (kombinierte) dorsoventrale Methode (also die Abstützung der Frakturzone und der ausgeräumten geschädigten Bandscheibe durch ein solides knöchernes Transplantat oder Implantat im Rahmen eines zusätzlichen ventralen Eingriffs statt des Einbringens von Beckenkammspänen durch den ohnehin „offenen“ dorsalen Zugang) nicht veranlasst.
Die Wahl der Behandlungsmethode ist grundsätzlich primär Sache des Arztes. Er muss dem Patienten nicht ungefragt erläutern, welche Behandlungsmethoden in Betracht kommen und was für und gegen die eine oder andere Methode spricht, solange er eine Therapie anwendet, die dem medizinischen Standard genügt. Aufzuklären hat der Arzt nur über echte Behandlungsalternativen, also über medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Standardbehandlungsmethoden, die gleichwertig sind, aber unterschiedliche Risiken und Erfolgschancen haben (BGHZ 144, 1; NJW 1996, 776; 1992, 2351).
Eine solche echte Behandlungsalternative hat die dorsoventrale Methode aber ungeachtet dessen, dass der Sachverständige Prof. Dr. F. selbst sie favorisiert hätte, zum hier maßgebenden Zeitpunkt im Herbst 2001 (noch) nicht dargestellt. In seiner mündlichen Anhörung am 10.01.2006 hat der Sachverständige seine schriftlichen Ausführungen ergänzt, bzw. auf den Punkt gebracht und sich dabei wie folgt eindeutig und unmissverständlich positioniert: “Bereits im September 2001 wurden beide Verfahren praktiziert und durch wissenschaftliche Studien miteinander verglichen. Bereits im September 2001 hätte ich dem Kläger das dorsoventrale Vorgehen vorgeschlagen, da ich schon damals der Auffassung war, dass es sich um ein besseres Verfahren handelt. Dies war damals allerdings nicht der Standard.“ (Bd. II, Bl. 372).
Steht damit fest, dass im September 2001 nur die tatsächlich zur Durchführung gelangte (rein) dorsale Operationsmethode eine, bzw. die operative Standardbehandlung darstellte (zum Standardcharakter des rein dorsalen Vorgehens s. nur S.15ff. des Ursprungsgutachtens des Sachverständigen Prof. Dr. F.), hat das Landgericht das Erfordernis einer Aufklärung über die dorsoventrale Methode zu Recht und mit zutreffender Begründung verneint; von einer echten (als Standard schon im Behandlungszeitraum, also 2001 zur Verfügung gestandenen) Behandlungsalternative kann nicht die Rede sein.
Gegen die vom Zeugen Dr. E. geleistete Aufklärung ist aber nicht nur unter inhaltlichen Gesichtspunkten nichts zu erinnern. Auch die Rüge des falschen (zu frühen) Aufklärungszeitpunkts verfängt nicht; auch hiermit kann der Kläger keinen (haftungsrelevanten) Aufklärungsfehler begründen.
Die Frage, wann aufzuklären ist, orientiert sich am Sinn und Zweck der Aufklärung, dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten Geltung zu verschaffen. Dieses auf der Hand liegende Verständnis vorausgesetzt, war hier die zwei Tage vor der Operation erfolgte Aufklärung nicht fehlerhaft zu früh. Im Gegenteil. Die Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten verlangt regelmäßig eine rechtzeitige Aufklärung, die Überlegungsfreiheit ohne vermeidbaren Zeitdruck gewährleistet. Eine solche Überlegungsfreiheit war hier gewahrt. Eine sich nahtlos an das Aufklärungsgespräch anschließende Durchführung des Eingriffs stand nicht im Raum; der Kläger hatte Raum und Zeit, sich in Ruhe und ohne psychischen Druck für oder gegen die Operation zu entscheiden. Dass die (endgültige) Indikation zur Operation zum Zeitpunkt des Aufklärungsgesprächs noch gar nicht feststand, ändert hieran nichts. Sie war immerhin schon – wie es der Zeuge Dr. E. anschaulich und plausibel geschildert hat – mit der Folge „sehr wahrscheinlich“, dass sie für den in diese sehr wahrscheinliche Behandlung vorab einwilligenden Kläger ein realistisches Szenario dargestellt hat, mit dem er sich ernsthaft auseinandersetzen musste.
Ein Aufklärungsfehler (im Vorfeld der Operation vom 18.09.2001) lässt sich nach alledem nicht feststellen. Auf die Kausalitätsfrage, die Frage nach dem ernsthaften Entscheidungskonflikt etc. kommt es deshalb nicht mehr an. Eine Haftung der Beklagten aus einem (schon tatbestandlich nicht vorliegenden) Aufklärungsfehler scheidet aus.
Schadensersatzansprüche – seien sie vertraglicher oder deliktischer Natur – hat der Kläger aber auch unter dem Aspekt des Behandlungsfehlers nicht. Ein solcher Fehler liegt nicht vor; zumindest fehlt es am haftungsbegründenden Kausalband zu den als Primärschäden geltend gemachten Nervenschäden.
Zunächst ist festzuhalten, dass wegen der progredienten neurologischen Ausfälle und einer zunehmenden spinalen Enge die am 17.09.2001 gefällte Entscheidung nun zu operieren, d.h. nicht weiter konservativ zu behandeln, richtig war. Die diesbezüglichen erstinstanzlichen Feststellungen greift die Berufung nicht an. An die Feststellungen des Landgerichts zur Operationsindikation ist der Senat gebunden. Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Feststellungen bestehen nach dem – insoweit nicht angegriffenen – Beweisergebnis der ersten Instanz nicht (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
Dies vorausgeschickt, lässt sich auch kein Fehler in der gewählten (angewandten) Operationstechnik feststellen.
Die Wahl der Therapiemethode ist im Grundsatz (s.o.) primär Sache des Arztes, dem die höchst- und obergerichtliche Rechtsprechung darin ein zunehmend weites, freies Ermessen einräumt (BGH NJW 1988, 763; 1989, 1538; OLG Naumburg VersR 2006, 979; OLG Brandenburg VersR 2004,199). Unter verschiedenen eingeführten und bewährten Standardtherapiemethoden ist die getroffene Methodenwahl vom Vorwurf des Behandlungsfehlers (weitgehend) frei bis zur Grenze der medizinischen Kontraindikation aus den Gegebenheiten der konkreten Behandlungslage.
Nach diesen Grundsätzen kann dem ärztlichen Personal der Beklagten keine behandlungsfehlerhafte Methodenwahl vorgeworfen werden.
Nach übereinstimmender Einschätzung der Sachverständigen Prof. Dr. F. und Prof. Dr. M. wäre zwar das (kombinierte) dorsoventrale Vorgehen – trotz des ihm wegen des (zusätzlichen) ventralen Zugangs immanenten höheren Risikos der Verletzung größere Blutgefäße – wegen der deutlich besseren Heilungschancen (zusätzliche ventrale Abstützung als wesentlicher Stabilisationsfaktor) schon 2001 vorzugswürdig gewesen (vgl. hierzu näher und eingehend S. 15ff. des Ursprungsgutachtens des Sachverständigen Prof. Dr. F. sowie dessen Ergänzungsgutachten v. 05.07.2004, Bd. I Bl. 240ff). Der zusätzliche abstützende Eingriff von vorne (ventral) war aber noch keine allgemein eingeführte Standardmethode, wie der orthopädische Sachverständige Prof. Dr. F. (s.o.) und ihm zustimmend auch der neurochirurgische Sachverständige Prof. Dr. M. (vgl. hierzu dessen Ursprungsgutachten v. 17.03.2008, Bd. III Bl. 554ff.) ausgeführt haben. Damit scheidet die Wahl der zum Behandlungszeitpunkt – mit den Worten des Sachverständigen Prof. F. – „jahrelang mit guten Behandlungsergebnissen angewandten, etablierten und anerkannten“ (rein) dorsalen Operationsmethode als Behandlungsfehler aus. Behandlungsfehlerhaft ist die Wahl einer in zurückliegender Zeit anerkannten Therapiemethode (erst) dann, wenn sie durch gesicherte medizinische Erkenntnisse überholt ist und daher derzeit bedenklich erscheinen muss (BGH VersR 1978, 41; 1988, 179; NJW 1988, 763). So weit war es im Jahr 2001 (noch) nicht; die wissenschaftliche Diskussion um die Gold-Standard-Operationsmethode war noch im Fluss.
Auch im Operationsgeschehen selbst lässt sich kein Behandlungsfehler finden. Die lege artis gewählte Operationsmethode ist kunstgerecht ausgeführt worden. Auch in diesem Punkt sind sich der orthopädische und der neurochirurgische Sachverständige einig; Fehler im Operationsgeschehen haben beide nicht feststellen können. Die hierauf beruhenden, von der Berufung auch nicht angegriffenen Feststellungen des Landgerichts binden den Senat also ebenfalls (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
Dabei gilt die Feststellung der ohne Haftungsrelevanz (fehlerfrei) durchgeführten Operation nicht nur für die Operationstechnik selbst, also den Fixateur interne, die Dekompression des Spinalkanals, die Ausräumung der Bandscheibe und die Spondylodese durch Einbringen von Beckenspankämmen, sondern auch für die Lagerung des Klägers während der Operation.
Zwar steht die in der Anschlussheilbehandlung (im Oktober 2001) festgestellte (dauerhaft zurückgebliebene) Deltoideuschwäche infolge einer Schädigung des Nervus axillaris – mit den Worten des Sachverständigen Prof. F. – „aller Wahrscheinlichkeit nach im Zusammenhang mit der Operation“ (s. hierzu das Ergänzungsgutachten v. 16.07.2004, Bd. I Bl. 237ff.). Da es (auch) insoweit aber an jeglichem Hinweis für einen „technischen Operationsfehler“ mangelt, bliebe als (denkbarer) Haftungstatbestand allein eine falsche (schadensgeneigte) Lagerung der Arme des Klägers bei der Operation. Auch unter diesem Gesichtspunkt (unter dem Stichwort „voll beherrschbares Risiko“) ist jedoch ein haftungsrelevanter Fehler zu verneinen, denn die Beklagte hat mit der im OP-Bericht dokumentierten (standardgerechten) Bauchlage (vgl. auch hierzu das Ergänzungsgutachten v. Prof. Dr. F. v. 16.07.2004, a.a.O.) eine etwaig zu ihren Lasten streitende Fehlervermutung entkräftet. Gegen die deshalb im Ergebnis beanstandungsfrei getroffene Feststellung des Landgerichts, es sei von einer korrekten Operationslagerung des Klägers und der Verwirklichung eines nicht vermeidbaren Risikos auszugehen, erinnert die Berufung auch nichts.
Ebenso wie das Operationsgeschehen vom 18.09.2001 scheidet auch die Befundung (Interpretation) der Röntgenbilder vom 29.10.2001 als Haftungsgrund aus. Ein als Behandlungsfehler (Diagnosefehler) zu wertende Fehlinterpretation der in der Moritzklinik (zum Abschluss der AHB) gefertigten Röntgenaufnahmen ist dem ärztlichen Personal der Beklagten nicht vorzuwerfen.
Gegen einen Diagnosefehler (übersehene Dislokation bzw. Lockerung einer zur Stabilisierung eingebrachten Schraube) spricht schon die eindeutige Einschätzung des neurochirurgischen Sachverständigen Prof. Dr. M., der – nachdem er im Beweisaufnahmetermin v. 19.06.2009 (Bd.III Bl. 625ff) erstmals die Röntgenbilder selbst eingesehen hat – ausgeführt hat, eine Materiallockerung sei auf den Röntgenaufnahmen nicht zu erkennen.
Ob das oder aber die anderslautende Bewertung des orthopädischen Sachverständigen Prof. Dr. F. von der „leicht nach kranial und dorsal dislozierten Schraube“ (S. 10 des Ursprungsgutachtens) richtig ist, kann letztlich offenbleiben. Der vom Kläger (in diesem Punkt von der Sache her zutreffend gerügte) Widerspruch in der Einschätzung der beiden Sachverständigen ist nicht entscheidungsrelevant. Es bedarf also keiner Abklärung/Aufklärung des (nicht streitentscheidenden) Widerspruchs durch eine ergänzende Anhörung der beiden Sachverständigen oder gar ein Obergutachten eines anderen (neuen) Sachverständigen; und zwar aus folgendem Grund:
Selbst wenn man mit Prof. Dr. F. vom Röntgenbefund einer Materialdislokation ausgeht, handelt es sich hierbei – wie Prof. Dr. F. so nachdrücklich wie auch eindeutig in seiner Anhörung im Termin v. 10.01.2006 (Bd. II Bl. 3658ff.) betont hat – um einen „leichten und schwer zu erkennenden“ Befund, dessen Nichterkennen auch einem sorgfältigen Arzt passieren könne. Damit fehlt es jedenfalls an der Unvertretbarkeit der – hier als objektiv fehlerhaft unterstellten – Diagnose des ärztlichen Personals der Beklagten, es gäbe keinen Anhalt für eine Materialdislokation.
Mit Blick auf die in der Praxis wegen der Unterschiedlichkeiten des menschlichen Organismus und der Mehrdeutigkeit von vielen Krankheitssymptomen häufig vorkommenden Irrtümer bei der Diagnosestellung wertet die Rechtsprechung objektiv fehlerhafte Interpretationen erhobener Befunde nur mit Zurückhaltung als Behandlungsfehler (BGH VersR 2003, 1256; NJW 1992, 2962; 1988, 1513; OLG Koblenz VersR 2006, 1547; OLG München NJW 2006, 1883; OLG Hamm OLGR 2002, 217; OLG Naumburg OLGR 2002, 39; OLG Stuttgart OLGR 2002, 251; 404; OLG Frankfurt VersR 1997, 1358). Ein Diagnoseirrtum kann dem Arzt regelmäßig nur dann als haftungsrelevanter (einfacher) Behandlungsfehler vorgeworfen werden, wenn eindeutige Symptome nicht erkannt, bzw. falsch gedeutet werden oder das diagnostische Vorgehen und/oder die Bewertung der durch diagnostische Hilfsmittel gewonnenen Ergebnisse für einen gewissenhaften Arzt nicht mehr vertretbar erscheinen.
An solchen zu einer (unterstellten) objektiven Fehlerhaftigkeit hinzugetretenen Umständen fehlt es vorliegend ersichtlich. Deshalb kann offen bleiben, ob die Ärzte der Beklagten die Röntgenaufnahmen der Moritzklinik tatsächlich (objektiv) fehlerhaft interpretiert haben. Selbst wenn man das – dem orthopädischen Sachverständigen Prof. Dr. F. folgend – unterstellt, liegt hierin noch kein Behandlungsfehler (Diagnosefehler); sondern nur ein haftungsirrelevanter Diagnoseirrtum.
Die Beklagte haftet schließlich auch nicht wegen unterlassener Befunderhebung am 06.11.2001 und in der Zeit danach.
Auch hier kann der – vom Kläger monierte – Widerspruch zwischen den orthopädischen und neurochirurgischen Gutachten (wird ausgeführt) letztlich dahinstehen, weil es in Würdigung der Ausführungen beider Sachverständiger jedenfalls an der haftungsbegründenden Kausalität fehlt.
Während der Sachverständige Prof. Dr. M. – was der Kläger massiv angreift – den keine neurologischen Ausfälle beschreibenden Entlassungsbrief der Beklagten vom 06.11.2001 (Anlage K4; Bd. I Bl. 22) als Beleg für eine stattgefundene neurologische Abschlussuntersuchung interpretiert hat (vgl. hierzu die Anhörung v. 19.06.2009, Bd. III bl. 625ff.), hat der Sachverständige Prof. Dr. F. ausgeführt, in der konkreten Behandlungssituation (Komplikationen im nachoperativen Heilungsverlauf) hätte die ausdrückliche Dokumentation einer neurologischen Abschlussuntersuchung zum Standard gehört (Anhörung v. 10.01.2006, Bd. III Bdl. 368ff.). Diese Ausführungen stehen aber nur scheinbar in einem unauflösbaren Widerspruch zu denen des Sachverständigen Prof. Dr. M..
Auch der Sachverständige Prof. Dr. F. ist wegen des Entlassungsbriefes davon ausgegangen, dass ein neurologischer Abschlussbefund zwar faktisch erhoben, aber standardwidrig nicht ausdrücklich als eingehender Untersuchungsbericht dokumentiert wurde (vgl. hierzu seine Anhörung v. 10.01.2006, Bd. II Bl. 368ff. „Gerade bei den aufgetretenen Komplikationen entspricht es dem ärztlichen Standard, dass der Patient bei der Entlassung untersucht wird und dieser Befund in der Verlaufsdokumentation niedergelegt wird. Dies fehlt. Der neurologische Befund ist nur im Arztbrief vermerkt. Dort steht, dass neurologische Ausfälle nicht bestanden. Das ist unter dem Standard und wäre mir zu mager.“). Damit gibt es den vom Kläger konstruierten „Streit“ der beiden Sachverständigen in Bezug auf den neurologischen Abschlussbefund tatsächlich nicht. Zu der Frage, ob der Befund
– was aus Gründen der Weiterbehandlung naheliegt – im Detail hätte dokumentiert werden sollen und müssen, hat sich der (hierzu nicht befragte) Sachverständige Prof. Dr. M. nicht geäußert.
Eine solche Befragung muss auch nicht nachgeholt werden, da die logischen und überzeugenden Darlegungen des Sachverständigen Prof. Dr. F. zu diesem Punkt völlig ausreichen.
Geht man nämlich – wie im Ergebnis schon das Landgericht – der nachvollziehbaren Bewertung des Sachverständigen Prof. Dr. F. folgend von einer aus medizinischen Gründen (für die weitere Behandlung) im Detail zu dokumentierenden neurologischen Abschlusskontrolluntersuchung aus, fehlt es an einer solchen Dokumentation. Das hat zur Folge, dass zu Lasten der Beklagten die – im Ergebnis der für eine neurologische Abschlussuntersuchung unergiebig gebliebenen Zeugenaussagen Dr. E. und Dr. Ech. (Bd. II Bl. 463f. und 475) nicht entkräftete – Vermutung einer tatsächlich unterlassenen neurologischen Abschlussuntersuchung streitet.
Zum haftungsbegründenden Behandlungsfehler führt das aber noch nicht.
Auch wenn die neurologische Abschlusskontrolluntersuchung – da sind sich beide Sachverständige einig – in Fällen der vorliegenden Art Standard ist; hier aber in der Folge der unterbliebenen Dokumentation als – den Standard verletzend – unterblieben zu gelten hat, fehlt es am haftungsbegründenden Ursachenzusammenhang zwischen dem in der unterlassenen Befunderhebung liegenden Behandlungsfehler und den als Primärschaden in Betracht kommenden diversen Nervenschäden.
Einen groben Befunderhebungsfehler – mit einer Beweislastumkehr im Hinblick auf die haftungsbegründende Kausalität zu Gunsten des Klägers – stellt das Unterlassen der neurologischen Abschlussuntersuchung nicht dar. In diesem Sinne (jedenfalls kein grober Behandlungsfehler) hat sich nicht nur ausdrücklich der Sachverständige Prof. Dr. M. positioniert (Ergänzungsgutachten v. 25.05.2009, Bd. III Bl. 599ff.); auch die Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. F. lassen einen groben Fehler nicht annehmen.
So steht ja fest, dass der Kläger von den Ärzten der Beklagten zumindest am 30.10.2001 (also bei der Wiederaufnahme im unmittelbaren Anschluss an die AHB) neurologisch untersucht wurde; und zwar (nur) mit dem Ergebnis eines – mit den Worten des Sachverständigen Prof. Dr. F. – „leichten“ neurologischen Befundes (s. hierzu die Anhörung des Sachverständigen F. v. 10.01.2006, Bd. II Bl. 368ff.) Diese Einschätzung spricht in Kombination mit dem zunehmenden Abklingen des subjektiven Beschwerdebildes im Verlauf des stationären Aufenthaltes vom 30.10. bis 06.11.2001 nach – ebenso unstreitigen – unauffälligen CT- und MRT-Kontrollbefunden und schließlich der (weiteren) Einschätzung des Sachverständigen Prof. Dr. F., die Nervenläsionen seien auch (noch) im Zeitpunkt der tatsächlich erst rund 6 Wochen nach der (unterlassenen) neurologischen Abschlussuntersuchung stattgefundenen Revisionsoperation rückbildungsfähig gewesen (Ergänzungsgutachten v. 04.07.2005, Bd. II Bl. 320ff.), gegen einen groben Befunderhebungsfehler.
Aber auch unterhalb der Schwelle zum – hier nicht vorliegenden – groben Behandlungsfehler kommt dem Kläger für das Kausalitätsband zum Primärschaden keine Beweiserleichterung zu. Zwar war die Unterlassung des neurologischen Abschlussbefundes aus medizinischen Gründen geboten (s.o.). Dass aber der Befund mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein medizinisch positives und deshalb aus medizinischer Sicht reaktionspflichtiges Ergebnis gehabt hätte (zur Beweiserleichterung für die Patientenseite in solchen Fällen BGH NJW 2004, 2001; VersR 2004, 790; 1999, 1282; NJW 1996, 1589), kann nicht angenommen werden. Im Gegenteil. Dass schon am 06.11.2001, also bei der (zweiten) Entlassung aus der Neurochirurgie der Beklagten eine Indikation zur (sofortigen) Revisionsoperation bestand, haben beide Sachverständige eindeutig verneint. Besonders deutlich wird das mit den an dieser Stelle beispielhaft zitierten Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. F. im Ergänzungsgutachten v. 04.07.2005. Dort heißt es auf S. 6f (Bd. II Bl. 325f.) wie folgt:
„Eine Schraubendislokation ist ein Zeichen für einen Stabilitätsverlust im Operationsgebiet. Symptomatisch kann dieser Stabilitätsverlust zu erneuten Schmerzen und bei Irritation des Rückenmarks und / oder der Nervenwurzeln zu neurologischen Störungen, in schweren Fällen bis hin zu Querschnittslähmungen führen. Ein solcher Stabilitätsverlust tritt in der Regel, wie auch beim Kläger, nicht abrupt, sondern allmählich durch zunehmende Auslockerung auf. Er ist auch zu Beginn nicht leicht erkennbar. Eine leichte Schraubendislokation und ein leichter Korrekturverlust sind nicht unbedingt mit einer stärkeren Instabilisierung und dringend notwendiger Reoperation verbunden. …Inwieweit bei einer postoperativen Instabilisierung neurologische oder sonstige Schäden auftreten, hängt sehr davon ab, wie stark diese ist und wie stark sich die anatomische Situation, insbesondere im Bereich des Rückenmarkkanals verschlechtert. Im vorliegenden Fall war die Instabilisierung und der damit verbundene Korrekturverlust zunächst nur gering. ….Bei der Aufnahme in Bad Berka am 18.12.2001, also ca. 6 Wochen nach der Entlassung in Jena, war eine neurologische Verschlechterung feststellbar. Zu diesem Zeitpunkt waren die Läsionen noch rückbildungsfähig. Wenn die Situation noch über einige Wochen weiter so bestanden hätte, wäre eine weitere neurologische Verschlechterung, eventuell auch irreversibel, zu befürchten gewesen.“
Bleibt es damit im Ergebnis bei der vollen Beweislast des Klägers für die haftungsbegründende Kausalität zwischen der am 06.11.2001 unterlassenen neurologischen Abschlussuntersuchung und den zurückgebliebenen Nervenschäden, hat nicht nur der Sachverständige Prof. Dr. M. einen solchen Ursachenzusammenhang mit Blick auf die zahlreichen (einschlägigen) Vorbelastungen und Vorschäden des Klägers im Bereich der LWS zum Einen und die nur kurze Verzögerung der Revisionsoperation um wenige Wochen zum Anderen als „schwierig“ bezeichnet (Ursprungsgutachten v. 17.03.2008, Bd. III Bl. 554ff.). Auch die o. zitierte – in Einklang mit der Einschätzung des Sachverständigen Prof. Dr. M. zu bringende – Feststellung des Sachverständigen Prof. Dr. F., selbst rund 6 Wochen später seien die Nervenläsionen noch rückbildungsfähig gewesen, lässt keinen Raum für die Annahme eines vom Kläger geführten Kausalitätsbeweises.
Im Ergebnis scheitern damit – vertragliche wie auch deliktische – Schadensersatzansprüche wegen unterlassener Erhebung eines neurologischen Kontrollbefundes am 06.11.2001 an der nicht feststehenden (bewiesenen) haftungsbegründenden Kausalität.
Aus dem gleichen Grund des nicht geführten haftungsbegründenden Kausalitätsnachweises kann der Kläger schließlich auch daraus, dass nach dem 06.11.2001 keine engmaschigen Kontrollbefunde erhoben wurden, keine Haftung der Beklagten herleiten.
Folgt man hier dem – vom Kläger heftig bis hin zum erfolglosen Befangenheitsantrag bekämpften – Sachverständigen Prof. Dr. M., war die bei der Entlassung am 06.11.2001 erfolgte Empfehlung des ärztlichen Personals der Beklagten, der Kläger solle sich (erst) in vier Wochen (zur Kontrolle) wiedervorstellen, adäquat und richtig (vgl. hierzu die Anhörung im Termin v. 19.06.2009, Bd. III Bl. 623ff.). Da sich diese These aber nicht nur auf die (unstreitig) keinerlei Materialdislokation zeigenden CT- und MRT-Aufnahmen, sondern auch auf die (umstrittene) Interpretation der Röntgenbilder vom 29.09.2001 bezieht, auf denen der Sachverständige Prof. Dr. M. im Widerspruch zum Sachverständigen Prof. Dr. F. keine Materiallockerung erkannt hat, stellt sich – allerdings nur auf den ersten Blick – zum zweiten Mal die Frage nach einem weiteren Aufklärungsbedarf in Bezug auf die (richtige) Interpretation der Röntgenaufnahmen der Moritzklinik vom 29.10.2001.
Wie schon bei der Prüfung eines Diagnosefehlers (S.18f. der Urteilsgründe) ist die Divergenz in den Ausführungen des neurochirurgischen und des orthopädischen Sachverständigen in Bezug auf die Röntgenbilder vom 29.10.2001 jedoch auch an dieser Stelle (bei der Prüfung eines Befunderhebungsfehlers) mit der Folge nicht entscheidungserheblich, dass der Senat nicht gehalten war, die Beweisaufnahme in der zweiten Instanz zu ergänzen.
Zwar ist mit den (erstinstanzlichen) Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. F. von einem Kontrollbefunderhebungsfehler auszugehen, denn seiner Einschätzung nach wäre wegen der zur stationären Wiederaufnahme am 30.10.2001 führenden Kombination von möglichen Hinweisen für eine beginnende Implantatlockerung in Gestalt der Schmerzsymptomatik, der Nervenstörungen und der (in ihrer Interpretation streitigen) Röntgenaufnahmen vom 29.10.2001 eine kurzfristige neurologische (klinische) Kontrolluntersuchung binnen einer Woche geboten gewesen (vgl. hierzu das Ergänzungsgutachten v. 04.07.2005, Bd. II Bl. 320ff., aber auch die Anhörung im Termin v. 10.01.2006, Bd. II Bl. 368ff.).
Aber auch hier fehlt dem (unterstellten) Befunderhebungsfehler, wenn man der Bewertung des Sachverständigen Prof. Dr. F. folgt, jedenfalls die haftungsbegründende Ursächlichkeit zu den als Primärschaden beklagten Nervenschäden. Nervenläsionen waren auch noch nach vier Wochen – hieran haben beide Sachverständige keinen Zweifel gelassen – rückbildbar. Eine Indikation zur Revisionsoperation schon vor dem vom ärztlichen Personal der Beklagten empfohlenen Wiedervorstellungstermin am 03.12.2001 bestand mithin fraglos nicht; wofür im Übrigen auch der Klägervortrag selbst spricht. Denn trotz der – wie es die Klageschrift auf S. 6 (Bd. I Bl. 15) formuliert – „sofort bei der Vorstellung am 30.11.2001 erkannten Lockerung der implantierten Bolzen in Bad Berka“ erfolgte die Revisionsoperation tatsächlich erst rund 3 Wochen später am 21.12.2001. Von einer unverzüglich erforderlichen Revisionsoperation kann also mit der Folge keine Rede sein, dass auch die Wiedervorstellungsempfehlung der Beklagten (erst für den 03.12.2001) als Haftungstatbestand ausscheidet. Einem (unterstellten) Kontrollbefunderhebungsfehler fehlt es jedenfalls an der haftungsbegründenden Kausalität zum Primärschaden.
III.
Da die Berufung nach alledem erfolglos bleibt, weil es an einem haftungsbegründenden Behandlungsfehler ebenso fehlt wie an einem Aufklärungsfehler, fallen dem Kläger die Kosten des Berufungsverfahrens zur Last (§ 97 Abs. 1 ZPO).
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Revision ist nicht zuzulassen, da es an Gründen hierfür fehlt (§ 543 Abs. 2 ZPO). Der Senat hat über einen Einzelfall nach den höchstrichterlich (vom Bundesgerichtshof) entwickelten Haftungskriterien entschieden, ohne sich dabei in Widerspruch zu seiner eigenen Rechtsprechung oder der anderer Obergerichte zu setzen.