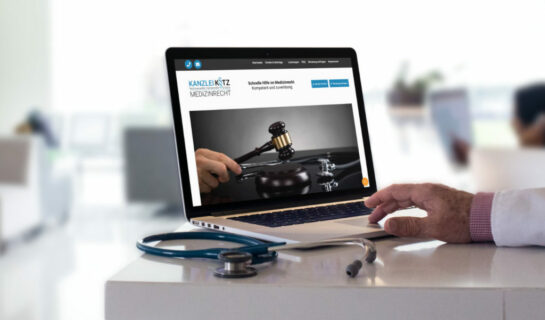OLG Karlsruhe – Az.: 7 U 10/19 – Urteil vom 11.03.2020
I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Karlsruhe vom 07. Dezember 2018 – 3 O 70/17 – wird zurückgewiesen.
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsrechtszugs. Die Streithelferin behält ihre außergerichtlichen Kosten auf sich.
III. Das Urteil und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Die Zwangsvollstreckung kann durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages abgewendet werden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
I.

Die Klägerin macht gegen den Beklagten Ansprüche auf Schmerzensgeld und Feststellung der Ersatzpflicht hinsichtlich materieller und künftiger immaterieller Schäden wegen einer von ihr behaupteten fehlerhaften ärztlichen Behandlung geltend.
Das Landgericht, auf dessen Urteil wegen des Sach- und Streitstands im ersten Rechtszug einschließlich der dort gestellten Anträge sowie der getroffenen Feststellungen Bezug genommen wird, hat die Klage abgewiesen.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie ihr Begehren in vollem Umfang weiterverfolgt. Die Streithelferin der Klägerin ist auch im Berufungsrechtszug auf ihrer Seite dem Rechtstreit beigetreten. Sie hat keinen eigenen Antrag gestellt. Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil und beantragt Zurückweisung der Berufung.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstands im zweiten Rechtszug wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen, wegen der Antragstellung auf die Sitzungsniederschrift – fortan SN – vom 29.01.2020 (II 119 f). Der Senat hat die Parteien ergänzend gemäß § 141 ZPO angehört. Auf die SN vom 29.01.2020 (II 119-125) wird verwiesen.
II.
Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der Sache keinen Erfolg.
Der Klägerin stehen weder aus Vertrag gemäß §§ 611, 630a, 630b, 630c Abs. 2 S. 1, 280 Abs. 1, 253 Abs. 2 BGB noch aus Delikt gemäß §§ 823 Abs. 1, 253 Abs. 2 BGB die geltend gemachten Ansprüche zu.
Die Rechtslage beurteilt sich hinsichtlich einer vertraglichen Haftung des Beklagten aus der Behandlung durch ihn im Dezember 2013, wie das Landgericht zutreffend ausführt, nach den zum Zeitpunkt der Behandlung geltenden §§ 630a ff. BGB, die mit Wirkung vom 26.02.2013 durch Gesetz vom 20.02.2013 (BGBl. I S. 277) eingefügt wurden. Weitergehende Ansprüche stehen der Klägerin aus einer deliktischen Haftung des Beklagten gemäß § 823 Abs. 1 BGB nicht zu.
1. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht einen Behandlungsfehler des Beklagten im Zusammenhang mit der von ihm am 11.12.2013 vorgenommenen Koloskopie und der damit verbundenen Probeentnahme und Abtragung einer polypoiden Veränderung als solcher verneint. Die Klägerin erbringt nicht den ihr obliegenden Beweis, dass der Beklagte dabei entgegen § 630a Abs. 2 BGB nicht den zum Zeitpunkt der Behandlung allgemein anerkannten fachlichen Standard eingehalten hat. Das Berufungsvorbringen rechtfertigt keine andere Beurteilung.
Das Landgericht ist unter überzeugender Würdigung der Angaben des Beklagten davon ausgegangen, dass er bei der rektalen Abtastung einen Befund und digital rektal dort eine Erhabenheit festgestellt hat, weswegen er auch nach der Untersuchung des eigentlichen Darms diese Stelle mit dem Endoskop erneut betrachtet und den Befund abgetragen hat. Er habe – so der Beklagte (SN vom 29.09.2017, S. 8, I 185) – schon bei der Untersuchung den Verdacht auf eine Präkanzerose im Analkanal (AIN 3) gehabt und deswegen auf den Anforderungsschein den Vermerk „Malingnität?“ geschrieben.
Das Landgericht hat ferner mit einer auch den Senat überzeugenden Würdigung der Beweise unter Bezugnahme auf die Darlegungen des Sachverständigen Prof. D. K. ausgeführt, dass es zum Zeitpunkt der Untersuchung und Behandlung, zu dem es wie üblich noch keine Diagnose und keine histologischen Befunde gab, dem Standard entsprach, einen kleineren Befund von 2-3 mm wie hier mit einer Zange abzutragen und zu biopsieren (Gutachten vom 15.01.2018, S. 2, I 261; SN vom 12.10.2018, S. 5/6, I 575/577). Die Größeneinschätzung des Beklagten könne – so der Sachverständige (Gutachten vom 15.01.2018, S. 2, I 261) – anhand des vorliegenden Bildmaterials gut nachvollzogen werden. Der Beklagte habe bei dieser Größe bei Verwendung der von ihm benutzten Zange davon ausgehen können, dass er die Läsion mit einer Wahrscheinlichkeit von fast einhundert Prozent vollständig erfasst hatte. Die Vollständigkeit der Abtragung müsse – so der Sachverständige weiter – nicht mittels Kontrollbiopsie oder Abstrichentnahme überprüft werden. Vielmehr sei eine Empfehlung zur Kontrolluntersuchung in einem bestimmten Intervall ausreichend (Gutachten vom 15.01.2018, S. 2, I 261; SN vom 12.10.2018, S. 6, I 577).
Soweit die Berufung rügt (II 55/57) und durch Gutachten eines Sachverständigen unter Beweis stellt, der gerichtliche Sachverständige berücksichtige die Morphologie des bei der Klägerin erhobenen Befundes unzureichend, vermag ihr des nicht zum Erfolg zu verhelfen. Die Klägerin trägt insoweit vor, die Ausführungen des Sachverständigen, durch die Zange sei im Hinblick auf die Größe der Läsion eine vollständige Abtragung der Läsion erfolgt, möge für andere Tumorarten gelten, nicht jedoch bei für bei Klägerin gegebene intraepitheliale Dysplasie. Bei einer AIN III handele es sich um ein in situ des Analkanals, wobei die hochgradige Dysplasie die gesamte Epidermis betreffe. Die Dysplasie beschränke sich somit nicht zwangsläufig auf die von dem Beklagten getastete 2-3 mm große Induration. Eine weitere Erstreckung sei möglich, die von ihm makroskopisch nicht erkennbar gewesen wäre. Ein hier nicht erfolgter Ausschluss weitergehender Veränderungen über den Abtragungsrand hinaus wäre durch den Beklagten ausschließlich mittels hochauflösender Anoskopie unter Verwendung von Essigsäure oder einer Jodprobe oder durch den Pathologen, bei entsprechendem Auftrag, die Vollständigkeit der Abtragung zu prüfen, möglich gewesen.
Der Sachverständige hat seiner Begutachtung genau den von der Klägerin vorgetragenen Befund und die Gefahr eines Wiederauftretens von Läsionen zu Grunde gelegt (Gutachten vom 15.01.2018, S. 3, I 263). Er hat der seine Ausführungen ausdrücklich auf den im Verfahren festgestellten Befund oder vergleichbare Befunde bezogen und die Sorge der Klägerin berücksichtigt, dass nicht alles entfernt worden sein könne und dennoch daran festgehalten, dass der Beklagte davon ausgehen durfte, die Läsion vollständig erfasst zu haben. Selbst, wenn etwas verblieben wäre, sei ein Kontrollintervall von sechs Monaten ausreichend. Es sei weder eine topische Nachbehandlung noch eine Vorstellung in einer proktologischen Klinik oder einer Dysplasie-Ambulanz geboten gewesen. Dem Umstand, dass das Virus ja vorhanden sei und es erneut zu derartigen Läsionen aus eventuell mikroskopischen Resten kommen könne oder entsprechendes Gewebe nachwachsen könne, werde mit einer klinischen und endoskopischen Kontrolle im Intervall ausreichend Rechnung getragen (SN vom 12.10.2018, S. 6/7, I 577-581; vgl. auch: Gutachten vom 15.01.2018, S. 2, I 261).
Auch steht nicht fest, dass das Analkarzinom überhaupt später an der Stelle aufgetreten ist, an welcher der Beklagte die Läsion abgetragen hat (SN vom 12.10.2018, S. 8, I 581).
2. Der Klägerin gelingt auch in der Berufung nicht der ihr obliegende Beweis, dass der Beklagte gegen die therapeutische Aufklärung gemäß § 630c Abs. 2 S. 1 BGB verstoßen hat.
a) Der Patient hat einen Anspruch auf Unterrichtung über die im Rahmen einer ärztlichen Behandlung erhobenen Befunde und Prognosen. Das gilt in besonderem Maße, wenn ihn erst die zutreffende Information in die Lage versetzt, eine medizinisch gebotene Behandlung durchführen zu lassen (Therapeutische Aufklärung/Sicherungsaufklärung). Es ist ein (schwerer) ärztlicher Behandlungsfehler, wenn der Patient über einen bedrohlichen Befund, der Anlass zu umgehenden und umfassenden ärztlichen Maßnahmen gibt, nicht informiert und ihm die erforderliche ärztliche Beratung versagt wird (BGH, NJW 2018, 3382 ff., Tz. 11, juris).
b) Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der Beklagte die ihm obliegende therapeutische Aufklärung nicht verletzt.
aa) Der Beklagte hat die Klägerin am 13.12.2013 hinreichend in dem unmittelbar nach der Behandlung möglichen Umfang therapeutisch aufgeklärt.
Der Beklagte hat angegeben (Sitzungsniederschrift vom 29.09.2017, S. 7/8, I 183/185), er habe der Klägerin in dem Nachgespräch anhand der gefertigten Bilder genau erläutert, was für eine Auffälligkeit bestanden habe und, dass er diese mit einer Zange abgetragen habe. Er erläutere auch, dass der Befundbericht noch um die Histologie ergänzt werde. Er habe ihr ferner gesagt, dass in 7 bis 10 Tagen der Bericht bei dem Hausarzt mit der kompletten Histologie eintreffen werde. Daran hat er bei seiner Anhörung vor dem Senat festgehalten (SN vom 29.01.2020, S. 3, II 123). Er habe der Klägerin im Hinblick auf die von ihm festgestellte und abgetragene polypöse Struktur im Analkanal mitgeteilt, dass man abwarten müsse, was die histologische Untersuchung ergebe. Der Senat hält die Angaben des Beklagten hinsichtlich seiner Darstellung gegenüber der Klägerin für glaubhaft. Er hat sowohl die übliche Handhabung in seiner Praxis als auch den konkreten Gesprächsverlauf nachvollziehbar geschildert und auch für ihn möglicher Weise nachteilige Umstände wie die nicht ausdrückliche Mitteilung an die Klägerin, dass sie sich bei ihrer Hausärztin melden solle, eingeräumt (vgl. SN vom 29.01.2020, S. 3, II 123). Auch der Senat hält – wie schon das Landgericht – die Angaben des Beklagten für zutreffend. Er hat nachvollziehbar begründet, dass und warum er nicht nur die übliche Routine schildern, sondern sich auch konkret an die Klägerin als Patientin erinnern konnte (SN vom 29.09.2017, S. 9, I 187; vgl. auch die überzeugenden Ausführungen des Landgerichts im angefochtenen Urteil S. 12, I 665).
Auch nach den Angaben der Klägerin vor dem Landgericht (SN vom 29.09.2017, S. 4, I 177) hat der Beklagte ihr jedenfalls gesagt, dass der Polyp noch histologisch untersucht werden müsste und auch ein Arztbrief an ihre Hausärztin ginge (a.a.O., S. 6, I 181). Zwar hat sie vor dem Senat angegeben (SN vom 29.01.2020, S. 2, II 121), sich insoweit nicht mehr zu erinnern (vgl. auch SN des LG vom 29.09.2017, S. 4, I 177). Dies steht den Angaben des Beklagten jedoch insoweit nicht entgegen.
Zu einer weitergehenden therapeutischen Aufklärung war der Beklagte zu diesem Zeitpunkt nicht verpflichtet. Daran ändert der Umstand nichts, dass er nach seinen Angaben (SN vom 29.09.2017, S.8, I 183; SN vom 29.01.2020. S. 3, II 123) bereits bei der Untersuchung den Verdacht auf eine Präkanzerose des Analkanals hatte. Denn der Befund war nach seinen nachvollziehbaren Angaben auch für ihn nicht eindeutig, sondern es kam auf die Histologie an, was er der Klägerin – so der Beklagte überzeugend (SN vom 29.09.2017, S. 9, I 187; SN vom 29.01.2020, a.a.O.) – erläutert hat. Dies stimmt mit den Darlegungen des Sachverständigen überein (SN vom 12.10.2018, S. 6, I 577), wonach man zu dem Zeitpunkt der Abtragung der Läsion noch keine näheren Angaben zu deren Qualität machen konnte. Nichts Anderes folgt aus dem Eintrag des Beklagten in seiner Dokumentation vom 11.12.2013 (AH II, 1, B1), wo unter „AD“ vermerkt ist „Analtumor (D37.78 G)“. Der Beklagte hat auf Vorhalt nachvollziehbar und überzeugend angegeben (SN vom 29.01.2020, S. 4, II 125), dass die Bezeichnung „Tumor“ nicht bedeutet, dass es sich um etwas Bösartiges handelt (vgl. auch Gutachten des Sachverständigen vom 15.01.2018, S. 3/4, I 263/265, zur Abrechnungsdiagnose des Pathologen).
Der Klägerin war auch hinreichend die Bedeutung und Schwere eines möglichen pathologischen Befundes und damit die Bedeutung der histologischen Untersuchung bekannt (vgl. auch: BGH, VersR 1989, 702; OLG Saarbrücken, GesR 2016, 691 f., juris tz. 50). Sie hat vorgetragen (SN vom 29.09.2017, S. 4, I 177; SN vom 29.01.2020, S. 2, II 121), der Beklagte habe sie gewissermaßen auch beruhigt, sie solle sich nicht so viele Gedanken machen und wenn sich ein bösartiger oder auffälliger Befund ergeben würde, werde er sich selbst telefonisch melden. Schon danach war ihr bekannt, dass auch die konkrete Möglichkeit eines bösartigen Befundes bestand. Der Beklagte hat ferner bei seiner Anhörung vor dem Senat (SN vom 29.01.2020, S. 3, II 123) überzeugend vorgetragen, er sage den Patienten bei der Aufklärung, dass Polypen, wenn sie vorhanden sein sollten, entfernt würden, weil diese eine Vorstufe des Darmtumors sein könnten. Im Übrigen hat die Klägerin angegeben (SN, a.a.O., S. 2, II 121), sie sei selbst Krankenschwester und wisse, dass abgetragenes Gewebe immer eingeschickt und darauf untersucht werde, ob es gutartig oder bösartig sei.
bb) Der Beklagte hat auch nach Erhalt der Histologie vom 13.12.2013 (AH II, 73, B3) nicht gegen seine therapeutische Aufklärungsplicht aus § 630c Abs. 2 S. 1 BGB verstoßen.
aaa) Der hinzugezogene Arzt ist grundsätzlich gehalten, den behandelnden Arzt in einem Arztbrief über das Ergebnis des Überweisungsauftrages zu unterrichten. Diese Pflicht gehört zu den Schutzpflichten gegenüber dem Patienten, die eine solche Unterrichtung des die Behandlung führenden Arztes über die von ihm aus der Hand gegebene Behandlungsphase umfassen und die der hinzugezogene Arzt dem Patienten aufgrund der übernommenen Behandlungsaufgabe vertraglich wie deliktisch schuldet. Im Übrigen gehört sie als Bestandteil der gegenseitigen Informationspflicht auch zu den Berufspflichten des Arztes (BGH, NJW 1994, 797 ff., juris Tz. 20 OLG Saarbrücken, OLGR Saarbrücken 2005, 5 ff., juris Tz. 50). Das Landgericht hat jedoch mit einer auch den Senat überzeugenden Würdigung der Angaben des Beklagten gemäß § 141 ZPO sowie der Aussage der Zeugin Z. festgestellt, dass der Beklagte den Arztbrief vom 12.12.2013 verfasst und an seine Mitarbeiter übergeben hat. Dies zieht auch die Berufung nicht mehr in Zweifel.
bbb) Entgegen der Berufung hat das Landgericht auch unter überzeugender Würdigung der Beweise festgestellt, dass die im Arztbrief vom Beklagten als Therapieempfehlung ausgesprochene bioptische Kontrolle im Abstand von sechs Monaten nicht behandlungsfehlerhaft war.
Der Sachverständige hat bei seiner Anhörung bezogen auf den konkreten Fall ausgeführt, dass im Hinblick auf die geringe Größe der Läsion, bei welcher der Beklagte davon habe ausgehen können, diese vollständig entfernt zu haben, nach Erhalt der Histologie, nach der kein invasives Wachstum vorlag, ein Kontrollintervall von sechs Monaten jedenfalls ausreichend war. Selbst, wenn etwas verblieben wäre, sei dies noch ausreichend gewesen, weil ein erneutes Wachstum des Polypen in wenigen Wochen nicht festzustellen gewesen sei.
Der in der Berufung wiederholte Einwand der Klägerin, im Hinblick auf die nach der Anhörung des Sachverständigen vorgelegten S2 Leitlinien (AH I, 14-16) sei von einem gebotenen Kontrollintervall von drei bis sechs Monaten auszugehen, greift aus den vom Landgericht dargelegten Gründen, auf die der Senat zustimmend Bezug nimmt, nicht durch. Der Sachverständige hat vielmehr, wie das Landgericht zutreffend ausführt, nicht etwa in Abrede gestellt, sondern berücksichtigt, dass es derartige Leitlinien gibt. Er hat weiter zutreffend darauf hingewiesen, dass diesen jedoch nicht das gleiche Gewicht wie etwa einer S1 Leitlinie zukommt, bei der man einen erhöhten Evidenzgrad habe. Er hat überzeugend begründet, warum im konkreten Fall der Klägerin ein Intervall von jedenfalls sechs Monaten und die Empfehlung im Arztbrief an die Allgemeinärztin hier ausreichend waren Im Übrigen weist das Landgericht zutreffend darauf hin, dass auch der vom Beklagten empfohlene Zeitraum von sechs Monaten noch die äußere Grenze des von der Klägerin im Hinblick auf die von ihr vorgelegten Leitlinien angenommenen Intervalls von drei bis sechs Monaten einhält. Soweit die Klägerin im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 17.02.202o, S. 3 (II 135) unter Vorlage eines Auszugs aus dem Facharztportal „Altmeyers Enzoklopädie“ (II 143 ff.) vorträgt, im Rahmen der Nachsorge hätten bei Patienten mit AIN III regelmäßige Verlaufskontrollen im Abstand von drei Monaten und Biopsiekontrollen zu erfolgen, bezieht sich dies ausdrücklich nur auf HIV-Patienten (II 149).
ccc) Entgegen der Auffassung der Berufung hat das Landgericht auch zutreffend ausgeführt und begründet, warum es nicht fehlerhaft war, dass der Beklagte seinen Arztbericht vom 12.12.2013 mit den vom Pathologen mitgeteilten Ergebnissen der Streithelferin postalisch übersandte. Ein Verstoß gegen die ihm obliegende Pflicht zur Sicherstellung des Behandlungserfolgs fällt dem Beklagten nicht zur Last.
Anders, als die Berufung meint, muss zunächst nicht wie im Rahmen des § 130 BGB, der Beklagte beweisen, dass der Brief der Streithelferin zugegangen ist, sondern die Klägerin ist dafür beweispflichtig, dass der Beklagte nicht alles Erforderliche dafür getan hat, dass der Brief der Streithelferin zuging (vgl. Möller/Makowski, Der Arztbrief – Rechtliche Rahmenbedingungen, KV 2015, 186 ff. (194 m.w.N.)). Nicht der Beklagte macht Ansprüche geltend, die den Zugang einer Willenserklärung voraussetzen, sondern die Klägerin begehrt Schadensersatz wegen der Verletzung der therapeutischen Aufklärungspflicht. Insoweit hat der Beklagte, wie das Landgericht zutreffend ausführt, seiner sekundären Darlegungslast genügt und die Klägerin, wie das Landgericht auch den Senat überzeugend festgestellt hat, den ihr obliegenden Beweis nicht geführt.
Auch musste der Beklagte nicht die Klägerin persönlich telefonisch informieren oder wiedereinbestellen, sondern es genügte die Information ihrer Hausärztin. Zwar mag es hochpathologische Befunde geben oder Befunde, die weitere zeitkritische Behandlungsschritte erfordern, bei denen eine rasche Reaktion geboten ist und bei denen deshalb auch eine persönliche Information des Patienten geboten sein kann (vgl. OLG Frankfurt, NJW-RR 2004, 1333 (1334)). Erhält der behandelnde Arzt einen Arztbericht, in dem für die Weiterberatung und -behandlung des Patienten neue und bedeutsame Untersuchungsergebnisse enthalten sind, die eine alsbaldige Vorstellung des Patienten bei dem Arzt unumgänglich machen, so hat er den Patienten auch dann unter kurzer Mitteilung des neuen Sachverhalts einzubestellen, wenn er ihm aus anderen Gründen die Wahrnehmung eines Arzttermins angeraten hatte. Auch eine entgegenstehende Übung entbindet den Arzt jedenfalls dann nicht von einer Pflicht zu besonderer Benachrichtigung seines Patienten, wenn dessen alsbaldige Vorstellung bei ihm aufgrund eines neuen Sachverhalts nötig wird und die Gefahr besteht, der Patient werde – weil ihm die neue Sachlage unbekannt ist – die Bedeutung des Arzttermins unterschätzen (BGH, NJW 2018, 3382 ff., Tz. 12, juris; BGH, NJW 1985, 2749 (2750), hier: Histologischer Befund nach Curettage).
Eine solche Konstellation lag hier jedoch nicht vor. Eine besondere Dringlichkeit war nach den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen nicht geboten. Er hat vielmehr dargelegt, dass bei dem vorliegenden Befund einer abgetragenen Krebsvorstufe ein Kontrollintervall von sechs Monaten und die Befundübermittlung mit der Therapieempfehlung an die Hausärztin ausreichte. Auch aus Rechtsgründen war das unter diesen Umständen hinreichend (vgl. auch: OLG Hamm, MedR 2005, 471 ff., juris Tz. 18).
Daran vermag auch der Hinweis der Klägerin im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 17.02.2020 (II 131 ff.) auf die Angaben des Beklagten, er rufe bei einem bösartigen Befund seine Patienten selbst an, und er habe in seiner Abrechnung selbst eine „bösartige Neubildung: Anus“ beschrieben (II 141) nichts zu ändern. Die Abrechnungsdiagnose ist nach den überzeugenden Darlegungen des Sachverständigen medizinisch irrelevant, da für die Prognosebeurteilung und die abzuwägende Behandlungs- und Überwachungsstrategie die medizinische und nicht die abrechnungstechnische Diagnose zugrunde gelegt werden muss. In welche Diagnosekategorie die Abrechnungsdiagnose eingeordnet wird, ist für den medizinischen Sachverhalt belanglos (vgl. Gutachten vom 15.01.2018, S. 3/4, I 263/265, zur Abrechnungsdiagnose des Pathologen).
Gleiches gilt für den Vortrag der Klägerin (vgl. Schriftsatz vom 17.02.2020, S. 2, II 133), aus dem Bericht des Pathologen vom 13.12.2013, der eine „histologisch hochgradige plattenepitheliale Dyplasie der Analschleimhaut“ (AIN III) sowie ein „Carcinoma in situ“ beschrieben habe, ergebe sich ein bösartiger Befund, den der Beklagte – schon ausgehend von seinen eigenen Angaben – der Klägerin unmittelbar habe telefonisch mitteilen müssen. Zum einen findet sich in der pathologischen Begutachtung vom 12./13.12.2013 (AH II, 73, B3) nicht wörtlich der Begriff eines „Carcinoma in situ“; zum anderen hat der Sachverständige bei seiner Begutachtung den Wortlaut des Pathologieberichts vom 13.12.2013 zutreffend seinen Ausführungen zu Grunde gelegt (Gutachten vom 15.01.2018, S. 3, I 263) und ist zu dem auch den Senat überzeugenden Ergebnis gelangt, dass es sich bei der dort bescheinigten hochgradigen plattenepithelialen Dyplasie der Analschleimhaut“ (AIN III) um eine „hochgradige Dysplasie in der gesamten Epidermis“ handelt, d.h. um eine Epithelveränderung, die schwere Störungen der Zellarchitektur aufweist, aber noch kein invasives, somit kein bösartiges Wachstum zeigt, und damit nicht einem Karzinom entspricht. Ausgehend davon hat der Sachverständige nach dem o. G. gerade eine besondere Dringlichkeit verneint und ein Kontrollintervall von sechs Monaten und die Befundübermittlung mit der Therapieempfehlung an die Hausärztin für ausreichend erachtet. Auch nach den von ihm angegebenen Grundsätzen bestand unter diesen Umständen für den Beklagten zu 2 kein Anlass, die Klägerin persönlich unmittelbar zu informieren.
Der Senat ist im Übrigen davon überzeugt, dass der Beklagte die Klägerin gefragt hat, ob sie eine Kopie des Befundberichts erhalten wollte und sie dies verneint hat. Zwar hat die Klägerin angegeben, dass der Beklagte nicht von dieser Möglichkeit gesprochen hat. Als Krankenschwester hätte sie ein solches Angebot – so die Klägerin weiter – angenommen (SN vom 29.09.2017, S. 4, I 177; SN vom 12.10.2018, S. 3, I 571; SN vom 12.10.2018, S. 4, I 573; SN vom 29.01.2020, S. 2, II 121). Der Senat folgt insoweit jedoch den – aus den oben dargelegten Gründen glaubhaften – Angaben des Beklagten. Die Klägerin war sich nach dem o. G. auch nicht sicher, ob davon die Rede war, dass die Hausärztin einen Befundbericht bekomme (vgl. SN vom 12.10.2018, S. 3, I 571/SN vom 29.09.2017, S. 6, I 181; SN vom 29.01.2020, S. 2, II 121). So wusste sie auch nicht mehr, ob der Beklagte selbst etwas dazu gesagt hatte, weshalb das Gewebe untersucht wurde und hat darauf hingewiesen, dass sie nach der Behandlung noch ermüdet war (SN vom 29.01.2020, S. 2, II 121). Der Beklagte hat dagegen glaubhaft angegeben, dass er seine Patienten fragt, ob sie eine Kopie des Befundberichts erhalten wollen. Die Klägerin habe dies verneint (SN vom 29.09.2017, S. 7, I 183). Die Aussage der Zeugin Z. steht den Angaben des Beklagten nicht entgegen. Sie hat zwar ein Angebot einer Kopie des Arztbriefes an den Patienten bei dessen Aufnahme verneint, wusste jedoch nicht, wie der Beklagte dies persönlich handhabt (SN vom 29.09.2017, S. 16, I 201). Adressat der Mitteilung war unter diesen Umständen vereinbarungsgemäß nicht die Klägerin als Patientin, sondern ihre Hausärztin. Eine Informationspflicht unmittelbar der Klägerin gegenüber bestand unter diesen Umständen nach dem o. G. aus medizinischen Gründen im Hinblick auf eine besondere Gefährlichkeit des Befundes bzw. Eilbedürftigkeit einer Behandlung nicht. Die Zeugin Z. hat dies zwar verneint. Sie wusste jedoch nicht, wie der Beklagte dies persönlich handhabt (SN vom 29.09.2017, S. 16, I 201). Ihre Aussage steht insoweit nicht entgegen.
Zwar wäre ein Verstoß gegen die therapeutische Aufklärung voraussichtlich zu bejahen, wenn der Beklagte, wie die Klägerin angibt (SN vom 29.09.2017, S. 4/6, I 177/181; SN vom 12.10.2018, S. 3, I 571; SN vom 29.01.2020, S. 2, II 121) und der Beklagte bestreitet (SN vom 29.09.2017, S. 8, I 185; SN vom 12.10.2018, S. 4/5, I 573/575; SN vom 29.01.2020, S. 3, II 123), erklärt hätte, er werde sich telefonisch bei ihr melden, wenn Auffälligkeiten bestünden.
Auch nach der ergänzenden Anhörung der Parteien vor dem Senat erbringt die Klägerin jedoch nicht den ihr insoweit obliegenden Beweis. Vielmehr ist der Senat im Hinblick auf die aus den oben dargelegten Gründen glaubhaften Angaben des Beklagten davon überzeugt, dass er mit der Klägerin nicht über eine mögliche telefonische Benachrichtigung hinsichtlich des Ergebnisses des noch ausstehenden Befundberichts gesprochen hat, weil aus seiner zutreffenden Sicht nicht ein hinreichend konkreter Verdacht bezüglich eines bösartigen Karzinoms gegeben war.
Aus dem Umstand, dass die Streithelferin auf ihrer ärztlichen Überweisung mit der Diagnose/Verdachtsdiagnose „Stuhlgang-Entleerungsstörungen“ auch das Kästchen „Mit-/Weiterbehandlung“ angekreuzt hat (AH II, 9), folgt entgegen der Auffassung der Berufung nichts Anderes. Es mag zwar sein, dass in diesem Fall – anders, als wenn die Überweisung ausschließlich zu einer konkret benannten Diagnosemaßnahme vorgenommen wird (BGH, NJW 1994, 797 f., juris Tz. 14; OLG Saarbrücken, GesR 2016, 691 f., juris Tz. 61; OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2011 – 8 U 1/08, juris Tz. 32; Geiß/Greiner, Arzthaftungsrecht, 7. Aufl., B 124 ff.) – die gesamte diagnostische und therapeutische Tätigkeit dem weiterbehandelnden Vertragsarzt übertragen wird (OLG Jena, GesR 2014, 348 ff., juris Tz. 49; Geß/Greiner, a.a.O., B 132 ff. bei Übernahme der Behandlung). Der Beklagte durfte jedoch nach den Darlegungen des Sachverständigen sich auf die Übermittlung des Befundes und der Therapieempfehlung an die Hausärztin begnügen und musste nicht selbst die Weiterbehandlung der Klägerin übernehmen (vgl. Sitzungsniederschrift vom 12.10.2018, S. 7, I 579). Er durfte bei objektiver Betrachtung davon ausgehen, dass die weitere ärztliche Versorgung der Klägerin im Hinblick auf seinen Arztbrief an die Streithelferin hinreichend sichergestellt war. Auch war im Übrigen eine Weiterbehandlung beim Beklagten wegen der auf dem Überweisungsschein angegebenen „Stuhlgang-Entleerungsstörungen“ ersichtlich nicht geboten. Weitere Kontrolluntersuchungen waren vielmehr wegen der bei der Untersuchung entfernten polypoiden Veränderung und der sich aus dem diesbezüglichen Befundbericht ergebenden AIN III erforderlich.
Im Übrigen erläuterte der Beklagte nach seinen glaubhaften Angaben der Klägerin auch (s.o.), dass der Befundbericht noch um die Histologie ergänzt werde und, dass in 7 bis10 Tagen der Bericht bei dem Hausarzt mit der kompletten Histologie eintreffen werde. Die Übersendung einer Kopie des Befundberichtes an sich selbst hat die Klägerin auf die Nachfrage des Beklagten verneint. Eine telefonische oder sonstige unmittelbare Benachrichtigung der Klägerin war nicht vereinbart. Sie konnte hier den Umständen hinreichend entnehmen, dass eine Weiterbehandlung beim Beklagten nicht erfolgen würde und die Behandlung bei ihm mit der Übersendung des Befundberichtes und eines Arztbriefes an ihre Hausärztin abgeschlossen war.
Der Beklagte war auch entgegen der auch in der Berufung von der Klägerin vertretenen Auffassung nicht verpflichtet, einen anderen Informationsweg als die postalische Übersendung, etwa die Übermittlung per Telefax, zu wählen oder den Zugang bei der Streithelferin zu überprüfen. Der Arztbrief ist ein gängiges Mittel zur gebotenen Aufrechterhaltung des Informationsflusses zwischen den an der Behandlung beteiligten Ärzten (vgl. BGH, NJW 1994, 797 ff., juris Tz. 20; Möller/Makowski, a.a.O., 185 ff.). Normaler Weise darf der Absender darauf vertrauen, dass sein Arztbrief beim Empfänger ankommt. Es kann ihm nicht zugemutet werden, sich bei jedem Arztbrief zu vergewissern, dass dieser erfolgreich übermittelt wurde (vgl. auch die Ausführungen des Sachverständigen, SN vom 12.10.2018, S. 11, I 587). Nur dann, wenn dem Arzt aus vorherigen Fällen z. B. bekannt ist, dass es bei einer Praxis Probleme bei der Postzustellung gibt, kann es eine derartige Pflicht geben. Alternativ sollte der Behandler dann auf eine andere Kommunikationsmethode wie etwa Fax umstellen. Hinreichende Anhaltspunkte für derartige Probleme liegen hier nicht vor.
Allerdings gilt in dringenden Fällen, dass der Absender überprüfen muss, ob die Information beim Empfänger angekommen ist, z. B. bei hochpathologischen Befunden oder Befunden, die weitere, zeitkritische Behandlungsschritte erforderlich machen (Möller/Makoski, a.a.O., 192; OLG Saarbrücken, OLGR Saarbrücken 2005, 5 ff., juris Tz. 64 ff.). Eine derartige Konstellation lag hier jedoch entgegen der Klägerin nicht vor. Sie hat das Landgericht, wie schon oben dargelegt, sachverständig beraten zutreffend verneint (vgl. auch die Ausführungen des Sachverständigen, SN vom 28.10.2018, S. 11, I 587).
Danach konnte sich der Beklagte, nachdem er den Informationsfluss im gebotenen Umfang aufrecht erhalten hatte, darauf verlassen, dass die Hausärztin der Klägerin seinen Arztbrief mit dem Befund lesen und ihrerseits die vorgeschlagenen Untersuchungen in dem von ihm empfohlenen Zeitraum veranlassen würde (vgl. auch: OLG Naumburg, Urteil vom 10.05.2010 – 1 U 97/09, juris Tz. 44; OLG Hamm, MedR 2005, 471 ff., juris Tz. 20).
3. Das Landgericht hat mit zutreffender Begründung, auf die der Senat zustimmend Bezug nimmt, auch eine Haftung des Beklagten wegen nicht rechtzeitiger Meldung zum Krebsregister verneint. Eine solche Haftung entfällt schon deshalb, weil der geltend gemachte Schaden nach Art und Entstehungsweise nicht unter den Schutzzweck der verletzten Norm fällt. Das Landeskrebsregistergesetz verfolgte im maßgeblichen Zeitraum im Jahre 2013/2014 den Zweck, eine für wissenschaftliche und empirische Krebsforschung notwendige Datenbasis unter Achtung des informationellen Selbstbestimmungsrechts des einzelnen betroffenen Krebspatienten zu schaffen. Sein Zweck war in keiner Weise die individuelle therapeutische Behandlungsoptimierung. Hinsichtlich des einzelnen Patienten zielten die Bestimmungen des § 4 Abs. 2 LKrebsRG a. F. lediglich auf die Wahrung seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Nichts anderes ergibt sich entgegen der Berufung aus den vorgelegten Informationsblättern (vgl. AH, SH, N5; AH I, A13, Patienteninformationsblatt). Derartige Informationsblätter wären im Übrigen nicht geeignet, den sich aus der Gesetzesbegründung ergebenden Normzweck zu ändern.
III.
Die nicht nachgelassenen Schriftsätze der Klägerin vom 17.02.2020 (II 131-139) und des Beklagten vom 02.03.2020 (II 161-163) boten keine Veranlassung zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung, §§ 156, 296a ZPO.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97 Abs. 1, 101 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Gründe für die Zulassung der Revision gem. § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor.