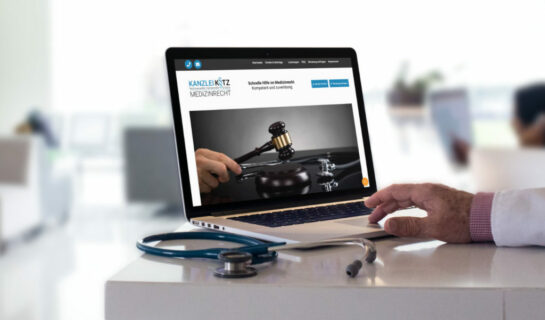OLG Stuttgart 1 – Az.: 1 U 52/15 – Urteil vom 10.08.2017
I. Auf die Berufung der Beklagten Ziff. 1 und 3 wird das Urteil des Landgerichts Hechingen vom 26.03.2015 – 2 O 116/08 – abgeändert und wie folgt neu gefasst:
1. Die Beklagten Ziff. 1 und 3 werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin Ziff. 1 ein Schmerzensgeld in Höhe von 30.000,00 EUR nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 16.09.2006 zu bezahlen.
2. Die Beklagten Ziff. 1 und 3 werden als Gesamtschuldner verurteilt, der Klägerin Ziff. 1 die entstandenen Kopier- und Gutachterkosten in Höhe von insgesamt 5.167,75 EUR zu erstatten.
3. Es wird festgestellt, dass die Beklagten Ziff. 1 und 3 als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin Ziff. 1 sämtliche derzeit nicht absehbaren immateriellen Schäden sowie die weiteren vergangenen und künftigen materiellen Schäden, die ihr aus der fehlerhaften Behandlung ihres Ehemannes ab dem 06.04.2004 entstanden sind bzw. noch entstehen werden zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind bzw. übergehen werden.
4. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
II. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.
III. 1. Die Kosten der ersten Instanz verteilen sich wie folgt:
a) Von den Gerichtskosten tragen
– die Klägerin Ziff. 1 47 %,
– die Klägerin Ziff. 2 22 %,
– die Kläger Ziff. 3 und 4 jeweils 8 %,
– die Beklagten Ziff. 1 und 3 als Gesamtschuldner 15 %.
b) Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin Ziff. 1 tragen die Beklagten Ziff. 1 und 3 als Gesamtschuldner 24 %.
c) Von den außergerichtlichen Kosten der Beklagten Ziff. 1 und 3 tragen
– die Klägerin Ziff. 1 10 %,
– die Klägerin Ziff. 2 22 %,
– die Kläger Ziff. 3 und 4 jeweils 8 %.
d) Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten Ziff. 2, 4, 5, 6 und 7 tragen
– die Klägerin Ziff. 1 zu 62 %,
– die Klägerin Ziff. 2 zu 22 %,
– die Kläger Ziff. 3 und 4 jeweils zu 8 %.
e) Im Übrigen findet eine Kostenerstattung nicht statt.
2. Die Kosten der zweiten Instanz verteilen sich wie folgt:
a) Von den Gerichtskosten tragen
– die Klägerin Ziff. 1 5 %,
– die Klägerin Ziff. 2 15 %,
– die Beklagten Ziff. 1 und 3 als Gesamtschuldner 80 %.
b) Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin Ziff. 1 tragen die Beklagten Ziff. 1 und 3 als Gesamtschuldner 94 %.
c) Von den jeweiligen außergerichtlichen Kosten der Beklagten Ziff. 1 und 3 tragen
– die Klägerin Ziff. 1 5 %,
– die Klägerin Ziff. 2 15 %.
d) Im Übrigen findet eine Kostenerstattung nicht statt.
IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagten Ziff. 1 und 3 können die Vollstreckung der Klägerin Ziff. 1 durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn die Klägerin Ziff. 1 nicht vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Die Klägerin Ziff. 1 kann die Vollstreckung der Beklagten Ziff. 1 und 3 durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn die Beklagten Ziff. 1 und 3 nicht vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.
Die Klägerin Ziff. 2 kann die Vollstreckung der Beklagten Ziff. 1 und 3 durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn die Beklagten Ziff. 1 und 3 nicht vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.
Streitwert des Berufungsverfahrens: 195.167,75 EUR
Gründe
A.
Die Klägerinnen Ziff. 1 und 2 machen eigene Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit der Behandlung ihres verstorbenen Ehemannes und Vaters im von der Beklagten Ziff. 1 getragenen … geltend.
I.
Dr. …, der Ehemann der Klägerin Ziff. 1 und Vater der – seit 1998 an einer schizophrenen Psychose leidenden – Klägerin Ziff. 2, wurde am 02.04.2004 im … wegen eines Rektumkarzinoms (auf Höhe 8 cm ab ano) operiert (anteriore Rektumresektion), die Anastomose lag extraperitoneal im kleinen Becken. Bei dem Eingriff entfernte man im Wege einer sog. Gelegenheitsappendektomie zugleich den Blinddarm. Am späten Abend des 04.04.2004 wurde Herr Dr. … von der Intensivstation auf die Normalstation verbracht. Während bis einschließlich 05.04.2004 im Wesentlichen nur ein erhöhter CRP-Wert auffällig war, klagte Herr Dr. … am Morgen des 06.04.2004 über Übelkeit und Erbrechen (laut Behandlungsunterlagen 1/4 Nierenschale wässrig Erbrochenes). Die zunächst bei 37,5 Grad Celsius liegende Temperatur stieg bis 11.30 Uhr auf 38,3 Grad Celsius an, der klinische Zustand verschlechterte sich zusehends. Anlässlich einer für 14.30 Uhr vorgesehenen Röntgenuntersuchung kollabierte Herr Dr. … Unter der im Operationsbericht festgehaltenen präoperativen Diagnose „Anastomoseninsuffizienz/Sepsis“ wurde Herr Dr. … ab 18.20 Uhr vom Beklagten Ziff. 3 operiert. Es wurde über einen ca. 2-3 cm langen Schnitt im rechten Unterbauch die Bauchhöhle inspiziert. Laut Operationsbericht zeigte sich nach Einführen des Saugers „leicht trübes Exsudat“. Es wurde ferner der Unterbauch lavagiert, ein doppelläufiges Ileum-AP angelegt und eine Rektoskopie durchgeführt, bei der keine Leckage der Anastomose festgestellt werden konnte. Durch den Eingriff konnte die entstandene Sepsis ebenso wenig beherrscht werden wie durch die am 07.04.2004 durchgeführte Revisionslaparotomie und die diversen Spülungen an den Folgetagen. Am 09.04.2004 verstarb Herr Dr. … im septischen Schock.
II.
Neben den Klägerinnen Ziff. 1 und 2 haben auch die Kläger Ziff. 3 und 4 als Söhne des Verstorbenen gegen die Beklagten Ziff. 1 und 3 sowie weitere fünf Ärzte (Bekl. Ziff. 2, 4 – 7) Klage erhoben. Die Klage war ursprünglich neben der Erstattung von Kopier- und Gutachterkosten i.H.v. 5.167,75 EUR an die Klägerin Ziff. 1 gerichtet auf Zahlung eines ererbten Schmerzensgeldes an alle Kläger (mind. 20.000,00 EUR), Zahlung eines eigenen Schmerzensgeldes an die Klägerinnen Ziff. 1 und 2 (jeweils mind. 20.000,00 EUR) sowie Feststellung der Ersatzpflicht für künftige immaterielle sowie weitere materielle Schäden betreffend alle Kläger. In der mündlichen Verhandlung haben die Kläger Ziff. 3 und 4 den sie selbst betreffenden Feststellungsantrag zurückgenommen.
Die Kläger haben geltend gemacht, ihr Ehemann und Vater sei zu früh auf die Normalstation verlegt worden. Auf die Verschlechterung seines Zustandes ab dem Morgen des 06.04.2004 hätten die Beklagten unzureichend und verspätet reagiert. Bei der Operation um 18.20 Uhr, die ohnehin früher hätte durchgeführt werden müssen, seien nicht die erforderlichen Maßnahmen ergriffen worden. Der Tod des Ehegatten und Vaters habe bei beiden Klägerinnen psychische Erkrankungen ausgelöst bzw. bei der Klägerin Ziff. 2 verstärkt.
III.
Das Landgericht hat – sachverständig beraten und unter Klagabweisung im Übrigen – die Beklagten Ziff. 1 und 3 verurteilt, der Klägerin Ziff. 1 ein Schmerzensgeld von 40.000,00 EUR zzgl. Zinsen und der Klägerin Ziff. 2 ein solches von 5.000,00 EUR zzgl. Zinsen zu zahlen. Es hat ferner festgestellt, dass die Beklagten Ziff. 1 und 3 als Gesamtschuldner verpflichtet sind, den Klägerinnen Ziff. 1 und 2 sämtliche derzeit nicht absehbaren immateriellen Schäden sowie die weiteren vergangenen und künftigen materiellen Schäden zu ersetzen, die ihnen aus der fehlerhaften Behandlung ihres Ehemannes / Vaters ab dem 06.04.2004 entstanden sind bzw. noch entstehen werden.
Bei der Operation vom 06.04.2004 sei es behandlungsfehlerhaft unterlassen worden, mittels Revisionslaparotomie über den alten Zugang die gesamte Bauchhöhle zu inspizieren und prä- oder intraoperativ eine Dichtigkeitsprüfung der Anastomose mittels Luftinsufflation oder transrektale Gabe eines Färbeindikators vorzunehmen.
Entgegen der Ansicht des Sachverständigen halte die Kammer diesen Fehler auch für unverständlich. Es greife daher für die haftungsbegründende Kausalität eine Beweislastumkehr infolge groben Behandlungsfehlers, daneben aber auch wegen einfachen Befunderhebungsfehlers ein.
Während eigene Schmerzensgeldansprüche des Verstorbenen nicht bestünden, hätten die Klägerinnen Ziff. 1 und 2 durch den Tod des Ehemannes und Vaters Schmerzensgeldansprüche begründende psychische Beeinträchtigungen erlitten.
Die Einholung der medizinischen Privatgutachten sei erforderlich gewesen; deren Kosten seien erstattungsfähig.
Die Gelegenheitsappendektomie sei nicht für die nachfolgenden Beschwerden ursächlich geworden, weshalb sich hieraus keine Ansprüche ableiteten.
Dass der Verstorbene zu früh auf Normalstation verlegt worden sei und die Operation vom 06.04.2004 zu spät eingeleitet worden sei, lasse sich nicht feststellen.
IV.
Gegen das den Beklagten am 31.03.2015 zugestellte Urteil vom 26.03.2015 haben die Beklagten Ziff. 1 und 3 mit am 28.04.2015 eingegangenem Schriftsatz Berufung eingelegt und diese innerhalb der bis zum 01.07.2015 verlängerten Berufungsbegründungsfrist am 30.06.2015 begründet.
Sie machen geltend, der Sachverständige sei ohne ausreichende Tatsachengrundlage und in der Sache zu Unrecht davon ausgegangen, dass die ergriffenen Maßnahmen bei der Operation vom 06.04.2004 nicht ausgereicht hätten und eine Anastomoseinsuffizienz Ursache der Peritonitis gewesen sei. Insoweit sei ein Verstoß gegen das rechtliche Gehör gegeben, da sich das Landgericht mit dem zum abweichenden Ergebnis kommenden Privatgutachten des Prof. Dr. … nicht auseinandergesetzt habe. Es sei kein Behandlungsfehler gegeben, keinesfalls aber ein grober Fehler.
Es gehe auch nicht um einen Befunderhebungsfehler, sondern um die Interpretation erhobener Befunde. Im Übrigen sei es äußerst unwahrscheinlich, dass der Verlauf durch die vom Landgericht für erforderlich gehaltenen Maßnahmen noch günstig hätte beeinflusst werden können.
Die Voraussetzungen für ein eigenes Schmerzensgeld der Klägerinnen sei nicht gegeben.
Die gerichtlichen Gutachter hätten wesentliche, die Klägerin Ziff. 1 betreffende Behandlungsunterlagen nicht ausgewertet. Das Landgericht habe sich nicht mit dem vorgelegten Privatgutachten der Prof. Dr. … auseinandergesetzt und insoweit gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör verstoßen. Im Übrigen sei ein etwaiges Schmerzensgeld überhöht.
Hinsichtlich der Klägerin Ziff. 2 stütze das Landgericht seine Überzeugung allein auf die Vernehmung der sachverständigen Zeugin Dr. …, die die Klägerin Ziff. 2 aber erst im September 2005 wieder behandelt habe. Es habe einer Begutachtung der Klägerin Ziff. 2 bedurft, die aber nicht vorgenommen habe werden können. Die Ausurteilung eines Schmerzensgeldes von 5.000 EUR sei nicht nachvollziehbar und übersetzt.
Zudem sei bei der Klägerin Ziff. 2 die etwaige Beeinträchtigung alleine durch den Erhalt der Unfallnachricht eingetreten, was eine Haftung von vornherein ausschließe.
Hinsichtlich des Feststellungsausspruchs habe dieser bei der Klägerin Ziff. 2 auf Ersatz der Schäden bis Ende 2006 beschränkt und wegen der abgrenzbaren Vorschädigung quotal gekürzt werden müssen.
Die Beklagten Ziff. 1 und 3 beantragen, in Abänderung des Urteils des Landgerichts Hechingen vom 26.03.2015 – 2 O 116/08 – die Klage insgesamt abzuweisen.
Die Klägerinnen Ziff. 1 und 2 beantragen, die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen das landgerichtliche Urteil.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Feststellungen des landgerichtlichen Urteils (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO) sowie auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Der Senat hat ergänzende schriftliche Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. … eingeholt (GA v. 09.05.2016, Bl. 706 ff. d.A.; GA v. 24.05.2017, Bl. 875 ff. d.A.) und den Sachverständigen mehrfach angehört. Auf die Protokolle der mündlichen Verhandlung vom 18.02.2016 (Bl. 638 ff. d.A.) und vom 20.07.2017 (Bl. 930 ff. d.A.) wird verwiesen. Er hat zudem in der mündlichen Verhandlung vom 13.04.2017 den Sachverständigen Dr. … betreffend die Klägerin Ziff. 1 angehört (Bl. 832 ff. d.A.) sowie ein schriftlich erstattetes ( vgl. Bl. 771 ff. d.A.) und in der Sitzung vom 20.07.2017 (Bl. 930 ff. d.A.) mündlich erläutertes Gutachten des Sachverständigen Dr. … betreffend die Klägerin Ziff. 2 eingeholt.
B.
Die zulässige Berufung hat in der Sache insoweit Erfolg soweit es die Klage der Klägerin Ziff. 2 betrifft (vgl. II.). Soweit das Landgericht der Klage der Klägerin Ziff. 1 stattgegeben hat, war lediglich das Schmerzensgeld auf 30.000,00 EUR herabzusetzen und die Berufung im Übrigen zurückzuweisen (vgl. I.).
I.
Die Klägerin Ziff. 1 kann von den Beklagten Ziff. 1 und 3 auf deliktischer Grundlage (§§ 823, 831 BGB) ein Schmerzensgeld i.H.v. 30.000,00 EUR sowie materiellen Schadensersatz verlangen. Die Beklagten Ziff. 1 und 3 haben für den Tod Herrn Dr. … einzustehen (hierzu 1.), der wiederum zu eigenen deliktischen Ansprüchen der Klägerin Ziff. 1 geführt hat (hierzu 2.).
1.
Den Beklagten liegt eine fehlerhafte Behandlung Herrn Dr. … zur Last (vgl. a). Da eine Beweislastumkehr nach den Regeln des groben Behandlungsfehlers greift, ist der Entscheidung zugrunde zu legen, dass Herr Dr. … bei korrektem Vorgehen überlebt hätte (vgl. b).
a)
Im Vorfeld des Eingriffs vom 06.04.2004 und bei diesem Eingriff selbst ist es zu Behandlungsfehlern gekommen.
aa)
Die anlässlich der Operation vom 02.04.2004 erfolgte (vorsorgliche) Entfernung des Blinddarms war nicht indiziert (vgl. insoweit einmütig der Sachverständige Prof. Dr. … [im Folgenden „Sachverständiger“, soweit es Abschnitt 1 des Senatsurteils betrifft] u.a. im Senatsprot. v. 18.02.2016 S. 3, der PGA der Beklagtenseite Prof. Dr. …, GA v. 03.09.2010 S. 13 sowie der klägerische PGA Prof. Dr. … in seinem ersten PGA auf S. 18). Indessen ist eine Auswirkung auf den weiteren Verlauf bei Herrn Dr. … auszuschließen (Senatsprot. v. 18.02.2016 S. 3 auf die Ausführungen im LGU auf S. 15 f. wird verwiesen).
Weiterhin ist davon auszugehen, dass Herr Dr. … am Vormittag des 06.04.2004 nicht ausreichend klinisch untersucht wurde. Ausweislich der Pflegedokumentation für 9.40 Uhr hatte Herr Dr. … erbrochen. Innerhalb der nächsten halben Stunde hätte der Patient von einem Arzt, insbesondere im Bereich des Abdomens, untersucht werden müssen (Senatsprot. v. 18.02.2016 S. 4 f.). Wäre der Patient gar nicht aufgesucht bzw. untersucht worden, wäre dies gar ein grober Fehler (Senatsprot. v. 18.02.2016 S. 5). Dabei waren im konkreten Fall nach der schwerwiegenden Operation vom 02.04.2004 auch Normalbefunde aus medizinischen Gründen dokumentationspflichtig (Senatsprot. v. 18.02.2016 S. 5). In den Behandlungsunterlagen findet sich indessen keine Dokumentation hierzu. Der Sachverständige hat dargelegt, wegen des Dokumentationsdefizits lasse sich beispielsweise nicht beurteilen, ob bereits am Morgen des 06.04.2004 weitergehende diagnostische Maßnahmen erforderlich gewesen wären (GA v. 14.04.2009 S. 35). Hieraus folgt eine Beweiserleichterung für den Patienten. Es besteht die Vermutung, dass eine dokumentationspflichtige, aber nicht dokumentierte Maßnahme vom Arzt auch nicht getroffen worden ist (BGH, Urteil vom 14. Februar 1995 – VI ZR 272/93 –, BGHZ 129, 6-16, Rn. 13). Diese Vermutung wurde von Seiten der Beklagten nicht widerlegt.
Dabei geht der Senat davon aus, dass Herr Dr. … am 06.04.2004 morgens kurz nach 7.00 Uhr anlässlich der Visite ärztlicherseits gesehen wurde (so der Bekl. Ziff. 3; Prot. v. 15.10.2015 S. 3). Ebenso liegt nahe, dass Herr Dr. … jedenfalls von einem Arzt aufgesucht wurde, um ihm Blut abzunehmen, denn Blutentnahmen wurden nach Aussage des Beklagten Ziff. 2 ausschließlich durch ärztliches Personal durchgeführt (LG-Prot. v. 03.03.2010 S. 5) und es liegen für den 06.04.2004 Laborergebnisse mit Druckzeit 12.30 Uhr vor. Die Beklagte Ziff. 6 (Dr. …) hat angegeben, sie sei an dem Tag einmal bei Herrn Dr. … gewesen und habe sich die Drainagen angesehen, wusste aber nicht mehr, wann dies war (LG-Prot. v. 03.03.2010 S. 4). Dass (und wann) Herr Dr. … allerdings klinisch untersucht worden wäre, steht damit noch nicht fest.
bb)
Der Eingriff vom 06.04.2004 war behandlungsfehlerhaft unzureichend, da es der umfassenden Inspektion des Bauchraums über die Wiedereröffnung der Laparatomiewunde vom 02.04.2004 sowie einer Überprüfung der Anastomose auf ihre Dichtigkeit bedurft hätte.
Am Vormittag des 06.04.2004 hatte Herr Dr. … ein septisches Zustandsbild entwickelt (GA v. 14.04.2009 S. 36 ErgGA v. 02.12.2011 S. 6). Bei der Visite kurz nach 7.00 Uhr klagte Herr Dr. … über krampfartige Schmerzen (Senatsprot. v. 15.10.2015 S. 3), später erbrach er wässrig und schwitzte mehrfach, die Temperatur war um 11.30 Uhr auf 38,3 Grad Celsius angestiegen, ein Leukozytenanstieg war ebenso festzustellen wie Zeichen einer beginnenden Niereninsuffizienz. Von Seiten des Kreislaufs bestand eine Hypotonie und Tachykardie um die 125 bpm (vgl. GA v. 14.04.2009 S. 15; ErgGA v. 09.05.2016 S. 2). Bei Herrn Dr. … hatte sich damit eine fulminante Infektion mit Zeichen eines beginnenden septischen Schocks (Hypotonie und Tachykardie in Verbindung mit Temperaturerhöhung als klassische Schockzeichen) entwickelt, die bereits mit beginnendem Organversagen (Nieren- und Leberinsuffizienz) einherging (ErgGA v. 09.05.2016 S. 3). Dieser Zustand wurde von den Beklagten auch richtig eingeschätzt. Der Beklagte Ziff. 3 hegte selbst sogar die Befürchtung, Herr Dr. … würde möglicherweise eine Operation nicht überleben (Senatsprot. v. 15.10.2015 S. 3).
Bei Vorliegen einer Peritonitis mit septischem Zustandsbild ist die Ursache der Peritonitis aber zu klären und ggfs. der Fokus zu beseitigen (ErgGA v. 02.12.2011 S. 20). Dabei gingen die Beklagten (nach Auffassung des Sachverständigen Prof. Dr. … mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Recht vgl. GA v. 14.04.2009 S. 51, ErgGA v. 02.12.2011 S. 7 ff., S. 14 ff ErgGA v. 09.05.2016, S. 4 f.) sowohl vor dem Eingriff am 06.04.2004 als auch danach von einer Insuffizienz der angelegten Dickdarmanastomose aus. Auch bei bloßem Verdacht der Insuffizienz einer Dickdarmanastomose ist aber eine Revision über den alten operativen Zugang erforderlich, da nur auf diesem Weg die erforderliche Übersicht gewonnen werden kann (GA v. 14.04.2009 S. 44, 47 LG-Prot. v. 03.03.2010 S. 6; Senatsprot. v. 18.02.2016 S. 8; zustimmend der klägerische Privatgutachter Prof. Dr. … in seinem ersten Gutachten auf S. 19 f., 23). Man muss klären, ob die Insuffizienz Kontakt zur Bauchhöhle hat. Hierzu hätte man intraoperativ die Dichtigkeit der Anastomose überprüfen müssen und zwar entweder über die transrektale Gabe eines Färbeindikators wie Methylenblau oder eine Luftinsufflation in das Neorektum über einen transanal eingeführten Blasenkatheter und gleichzeitigem Auffüllen des kleinen Beckens mit Kochsalzlösung (GA v. 14.04.2009 S. 42; LG-Prot. v. 03.03.2010 S. 7; Senatsprot. v. 18.02.2016 S. 9). Mit der gebotenen umfassenden Inspektion des Bauchraums hätte zu nahezu 100 % die Ursache der bei Herrn Dr. … vorliegenden Peritonitis geklärt werden können (ErgGA v. 02.12.2011 S. 9 f.). Der von den Beklagten gewählte Zugang gewährte jedoch weder den nötigen Überblick noch ließ er die beschriebenen Überprüfungsmaßnahmen zu (LG-Prot v. 03.03.2010 S. 6).
Dabei ist hervorzuheben, dass das in der Bauchhöhle vom Beklagten Ziff. 3 gefundene leicht trüb-seröse Exsudat ein deutliches Zeichen dafür ist, dass in der Bauchhöhle eine Infektion stattfindet (LG-Prot. v. 03.03.2010 S. 6 f. Senatsprot. v. 18.02.2016 S. 9 ErgGA v. 24.05.2017 S. 3). In diesem Fall ist zwingend zu klären, wo das Exsudat herkommt (a.a.O.). Dies gilt auch für „nur“ leicht-trübes Exsudat, denn auch wenn man im Zweifel ist, durfte man sich in einer Situation wie der vorliegenden nicht für den kleinstmöglichen Eingriff entscheiden, sondern muss den umfassenden Eingriff durchführen, um sicherzustellen, dass der Infektionsherd keinen Zugang zur Bauchhöhle hat (LG-Prot. v. 03.03.2010 S. 7).
Der Einwand des Beklagten Ziff. 3, seine Dokumentation von „leicht trübem Exsudat“ sage nichts darüber aus, wie er das Exsudat tatsächlich empfunden habe, da sich aus der Bauchhöhle kaum einmal klares Exsudat entleere (LG-Prot. v. 03.03.2010 S. 7) ändert an dem Behandlungsfehler nichts. Denn er hat unstreitig kein klares, sondern leicht trübes Exsudat angetroffen (auch Senatsprot. v. 15.10.2015 S. 3) und die Handlungsanweisungen für diesen Fall sind eindeutig und Lehrbuchstandard, der jedem Operateur präsent sein muss.
Soweit der Privatgutachter der Beklagten Prof. Dr. … im Gutachten vom 03.09.2010 (dort S. 14 und 15 f.) meint, bei objektiver Betrachtung habe der durchgeführte kleine Eingriff am Abend des 06.04.2009 „vielleicht eine Chance gehabt“, das Problem zu beenden und man habe die kleinere Operation machen dürfen in der „Hoffnung“, eine kleine Insuffizienz konservativ ausheilen zu lassen, weil ein größerer Eingriff zu einem späteren Zeitpunkt immer noch möglich sei und es Herrn Dr. … bei der Operation vom 06.04.2009 noch nicht so schlecht gegangen sei, dass man unbedingt eine konsequentere Operation hätte machen müssen, überzeugt dies nicht. Vor allem nicht vor dem Hintergrund der eigenen Einschätzung des Beklagten Ziff. 3 als Operateur, Herrn Dr. … sei es so extrem schlecht gegangen, dass sogar die Befürchtung bestand, er würde die Operation nicht überleben (vgl. auch Anästhesieprotokoll: „Pat. in sehr schlechtem AZ“). Bei Herrn Dr. … bestand eine höchst bedrohliche Situation, die Prof. Dr. … in seinen Darstellungen nicht zutreffend erfasst hat (vgl. auch ErgGA des SV v. 09.05.2016 S. 3).
b)
Zwar lässt sich medizinisch nicht feststellen, dass Herr Dr. … bei korrektem Vorgehen überlebt hätte. Jedoch greift zugunsten der Klägerin Ziff. 1 eine Beweislastumkehr für das Kausalitätsband zwischen dem Behandlungsfehler und dem Tod Herrn Dr. … als Primärschaden aufgrund groben Behandlungsfehlers ein.
aa)
Bei der gebotenen Gesamtbetrachtung ist von einem groben Behandlungsfehler auszugehen. Ein Behandlungsfehler ist dann als grob zu bewerten, wenn der Arzt eindeutig gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkenntnisse verstoßen und einen Fehler begangen hat, der aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf (BGH, Urt. v. 17.11.2015 – VI ZR 476/14 –, NJW 2016, 563 Rn. 14, zitiert nach juris). Bei der Einstufung eines ärztlichen Fehlverhaltens als grob handelt es sich um eine juristische Wertung, die dem Tatrichter und nicht dem Sachverständigen obliegt (BGH, Urt. v. 25. Oktober 2011 – VI ZR 139/10 –, NJW 2012, 227, Rn. 9, zitiert nach juris), jedoch muss die wertende Entscheidung in vollem Umfang durch die vom ärztlichen Sachverständigen mitgeteilten Fakten getragen werden und sich auf die medizinische Bewertung des Behandlungsgeschehens durch den Sachverständigen stützen können (BGH, Urt. v. 17.11.2015 – VI ZR 476/14 –, NJW 2016, 563 Rn. 14, zitiert nach juris).
Zwar hat der Sachverständige zunächst nur einen einfachen Behandlungsfehler angenommen (GA v. 14.04.2004 S. 53; LG-Prot. v. 03.03.2010 S. 8; ErgGA v. 02.12.2011 S. 20; Senatsprot. v. 18.02.2016 S. 9), dies aber stets damit begründet, es sei menschlich verständlich, dass man dem kreislaufinstabilen Patienten eine größere Operation habe ersparen wollen (LG-Prot. v. 03.03.2010 S. 8; Senatsprot. v. 18.02.2016 S. 9, 10; Senatsprot. v. 20.07.2017 S. 7). Er hat aber keinen Zweifel daran gelassen, dass das gewählte Vorgehen „den Prinzipien der septischen Chirurgie vollständig widerspricht“ (ErgGA v. 09.05.2016 S. 7 und 9 f.) und es sich um Lehrbuchstandard handelt (LG-Prot. v. 03.03.2010 S. 7; ErgGA v. 09.05.2016 S. 9; auch der klägerische Privatgutachter … stellt auf S. 23 seines ersten Gutachtens fest, dass es zum fachchirurgischen Grundwissen gehört, dass zur Behandlung einer Peritonitis die Ursachenabklärung unabdingbar ist). Bei Herrn Dr. … war die Verdauung nach dem Eingriff vom 02.04.2004 bereits wieder in Gang gekommen (ErgGA v. 24.05.2017 S. 8). Er hatte mehrfach Stuhlgang, worüber der Beklagte Ziff. 3 auch informiert war (Senatsprot. v. 15.10.2015 S. 3). Dann aber spielt es keine Rolle mehr, dass der Darm vor der Operation vom 02.04.2004 vorbereitet gewesen war, vielmehr war der Darm zu behandeln wie ein Darm, der nie gereinigt worden ist (Senatsprot. v. 20.07.2017 S. 5, 6). Die Behandlung war wie bei einer intraperitonealen Anastomoseinsuffizienz vorzunehmen (ErgGA v. 24.05.2017 S. 11). Es bedurfte daher – sollte eine Operation überhaupt Sinn machen – zumindest der Spülung des abführenden Dickdarmschenkels, um den dort befindlichen – stark keimbelasteten – Darminhalt zu entfernen (Senatsprot. v. 18.02.2016 S. 10 f.). Eine solche Spülung war aber bei dem beklagtenseits gewählten Vorgehen gar nicht möglich.
Der Sachverständige hat angegeben, die Voraussetzungen eines groben Behandlungsfehlers hätte er für gegeben erachtet, wenn man gar nicht interveniert hätte (Senatsprot. v. 18.02.2016 S. 10). Indessen war der tatsächlich durchgeführte Eingriff (bei allem menschlichen Verständnis für den Beklagten Ziff. 3, der sicher nur das Beste für Herrn Dr. … wollte) so defizitär, dass er einem Nichtintervenieren auch nach Auffassung des Sachverständigen gleichsteht. Dieser hat ausgeführt (Senatsprot. v. 20.07.2017 S. 7): „Wenn ich die Gesamtumstände berücksichtige, war die Entscheidung, es während der Operation am Abend des 06.04.2004 (Schnitt 18:20 Uhr, Naht 19:37 Uhr) bei der Minilaparotomie zu belassen, aus medizinischer Sicht nicht mehr vertretbar, insbesondere dann, wenn man berücksichtigt, wie sich die Beschwerdesymptomatik ausweislich der Pflegedokumentation im Laufe des Tages entwickelt hat, auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass zuvor keine Bildgebung erfolgen konnte und dass eine Dichtigkeitsprüfung der Anastomose nicht erfolgt ist, obwohl man von einer Anastomoseinsuffizienz als Verdachtsdiagnose ausging. Wenn man lediglich so vorgeht, hätte man den Eingriff als solchen gleich lassen können.“
Bereits hiernach ist von einem groben Behandlungsfehler auszugehen. Dies gilt erst recht bei zusätzlicher Annahme (infolge Dokumentationsdefizits), dass die gebotene klinische Untersuchung am Vormittag des 06.04.2004 unterblieben ist (was möglicherweise zu einer zeitlichen Verzögerung geführt hat).
bb)
Das gebotene operative Vorgehen wäre generell geeignet gewesen, den Tod Herrn Dr. … zu verhindern.
Vorliegend hätte man mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der geforderten Inspektion der Bauchhöhle eine Insuffizienz der Dickdarmanastomose mit Anschluss zur freien Bauchhöhle festgestellt. Der Sachverständige hat überzeugend dargelegt, dass dies die bei weitem wahrscheinlichste Ursache der Peritonitis gewesen ist (ErgGA v. 02.12.2011 S. 7 ff., sowie S. 14 ff. in eingehender Auseinandersetzung mit dem Privatgutachter Prof. Dr. …). Dann aber hätte man je nach konkretem Ausmaß der Anastomoseinsuffizienz die gebotenen Maßnahmen ergreifen können (hierzu ErgGA v. 02.12.2011 S. 12 f.), die in jedem Falle über das hinausgegangen wären, was tatsächlich erfolgt ist. Jedenfalls hätte man auf die Spülung des abführenden Darmschenkels keinesfalls verzichten können, weil bei Herrn Dr. … die Verdauung bereits wieder in Gang gekommen war und er mehrfach Stuhlgang gehabt hatte (siehe auch Angabe des Beklagten Ziff. 3 Senatsprot. v. 15.10.2015 S. 3).
Damit ist aber die generelle Eignung des groben Behandlungsfehlers zur Herbeiführung des Schadens gegeben. Die generelle Eignung reicht für die Beweislastumkehr aus, eine Wahrscheinlichkeit wird nicht gefordert (BGH, Urt. v. 08.01.2008 – VI ZR 118/06 – NJW 2008, 1304, Rn. 12, zitiert nach juris). Erst recht muss die Klägerin Ziff. 1 nicht nachweisen, dass tatsächlich eine Insuffizienz der Anastomose vorlag und kein anderes Geschehen, das man ärztlicherseits ohnehin nicht hätte beeinflussen können. Letzteres nachzuweisen wäre vielmehr Sache der Beklagten. Die Unsicherheit, ob der Schaden tatsächlich durch den groben Fehler oder durch eine andere Ursache bedingt ist, soll in einem solchen Fall die fehlerhaft behandelnde Seite aufklären (BGH, Urteil vom 08.01.2008 – VI ZR 118/06 –, NJW 2008, 1304, Rn. 12, juris). Der Vernehmung der beklagtenseits zum Beweis des Umstands, dass bei der Obduktion keine Nahtinsuffizienz festgestellt wurde, benannte sachverständige Zeugin Dr. …, bedurfte es nicht. Dass bei der Obduktion eine Insuffizienz nicht positiv festgestellt wurde, ist unstreitig. Dafür dass die Zeugin eine Nahtinsuffizienz ausschließen konnte, ist die Zeugin nicht benannt und hierzu finden sich in dem Obduktionsbericht auch keine Anhaltspunkte. Die Berufung (BB S. 5) geht mit ihrem Privatgutachter (ebenso wie alle anderen Gutachter) nicht von einer ausgeschlossenen (oder auch nur gänzlich unwahrscheinlichen) Insuffizienz aus, vielmehr nur von einer nicht nachgewiesenen Insuffizienz. Dass eine Insuffizienz im Raum steht, ergibt sich eindrucksvoll aus der Stellungnahme des Privatgutachters im Gutachten vom 31.01.2016, auch wenn dieser persönlich letztlich glaubt, dass keine Insuffizienz vorgelegen hat: „Über die Ursache dieser Peritonitis ist sehr viel in den Gutachten diskutiert worden. Es erscheint jedem eigentlich offensichtlich, dass es sich wohl um eine insuffizienzbedingte Peritonitis gehandelt haben müsste, weil etwas anderes eigentlich nicht wirklich vorkommt.“
Dass Herr Dr. … bei behandlungsfehlerfreiem Vorgehen überlebt hätte, ist nicht gänzlich unwahrscheinlich. Vielmehr hat der Sachverständige angegeben, bei Durchführung einer konsequenten Revisionsoperation hätte Herr Dr. … wahrscheinlich überlebt (GA v. 14.04.2009 S. 46, 52), jedenfalls hätte eine relativ gute Chance bestanden, die Sepsis zu beherrschen (LG-Prot. v. 03.03.2010 S. 9).
c)
Anlass zur Einholung eines weiteren Gutachtens gem. § 412 ZPO besteht nicht. Die Ausführungen des Sachverständigen sind in sich stimmig und widerspruchsfrei. Mit den Einwänden des Privatgutachters hat er sich eingehend auseinandergesetzt.
2.
Die Voraussetzungen, unter denen die Klägerin Ziff. 1 Schadensersatz verlangen kann, sind gegeben.
Vorliegend begehrt die Klägerin Ziff. 1 Schadensersatz wegen eines Gesundheitsschadens, der mittelbar als psychische Folge der Fehlbehandlung und des Todes ihres Ehegatten eingetreten ist (sog. Schockschaden). Ein Anspruch für solche Schäden kommt grundsätzlich in Betracht (vgl. BGH, Urt. v. 27.01.2015 – VI ZR 548/12 – NJW 2015, 1451, Rn. 6, zitiert nach juris). Auch wenn Verkehrsunfälle Ausgangspunkt und Hauptanwendungsbereich der hierzu ergangenen Rechtsprechung sind, gibt es keinen Grund, die Haftung hierauf zu beschränken. Auch im Bereich der Arzthaftung sind die Grundsätze daher anwendbar (vgl. schon OLG Stuttgart, Urt. v. 21.07.1988 – 14 U 3/88, VersR 1988, 1187).
Die Voraussetzungen, unter denen ein solcher „Schockschaden“ als vom Schutzbereich der anspruchsbegründenden, vorliegend deliktischen Norm erfasst angesehen wird und damit ersatzfähig ist (vgl. Ebert in Erman, BGB, 14. Aufl., Vorbem. zu §§ 249-253, Rn. 51 ff.), sind vorliegend erfüllt. Die Klägerin Ziff. 1 steht als Ehefrau in einer besonderen Nähebeziehung zum Verstorbenen und der Schock ist angesichts des (tragischen) Todes von Herrn Dr. … verständlich und nachvollziehbar. Die bei der Klägerin Ziff. 1 infolge des Todes gegebene Gesundheitsbeschädigung ist überdies pathologisch fassbar und geht (weit) über die gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinaus, denen Hinterbliebene bei der Benachrichtigung von dem Unfall eines nahen Angehörigen oder dem Miterleben eines solchen Unfalls erfahrungsgemäß ausgesetzt sind (st. Rspr., zuletzt BGH, Urt. v. 10.02.2015 – VI ZR 8/14 – NJW 2015, 2246, Rn. 9, zitiert nach juris).
a)
Zur Überzeugung des Senats (§ 286 ZPO) steht fest, dass bei der Klägerin Ziff. 1 durch den Tod ihres Mannes sowie die Begleitumstände im Krankenhaus zunächst eine akute Belastungsreaktion ausgelöst wurde, aus der sich über eine Anpassungsstörung im zeitlichen Verlauf eine posttraumatische Belastungsstörung (mit ausgeprägter peritraumatischer Dissoziation) entwickelt hat, wie sie der ICD 10 beschreibt. Ferner steht fest, dass sie eine rezidivierende depressive Störungen hatte – mittelgradig ab Mai 2004, mindestens höhergradig bis schwer 2005, 2006 und 2007 -, die sich zwischenzeitlich chronifiziert hat (GA S. 36, ErgGA S. 10).
Die Sachverständigen Prof. Dr. … und Dr. … haben die Klägerin Ziff. 1 drei Tage lang (10.12.2012 – 12.12.2012) stationär untersucht (zum Ergebnis siehe GA v. 22.01.2013 [im Folgenden: GA] S. 10 ff.) und zwar unabhängig voneinander in insgesamt drei mehrstündigen Interviews und mehrstündigen Testungen, wobei sich in der Einschätzung und Bewertung der unabhängig erhobenen Befunde keine Differenzen zeigten (GA S. 33). Ferner wurden nicht nur die Unterlagen ausgewertet, sondern ebenso Eindrücke des in der Einrichtung der Sachverständigen beschäftigten ärztlichen und nichtärztlichen Personals (Senatsprot. v. 13.04.2017 S. 4).
aa)
Es steht für den Senat fest, dass die Klägerin Ziff. 1 an den von den Sachverständigen genannten Erkrankungen leidet. Die Sachverständigen haben im Ergänzungsgutachten die Definition der posttraumatischen Belastungsstörung gem. F43.1 des ICD 10 GM zitiert:
„Diese entsteht als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Prädisponierende Faktoren wie bestimmte, z.B. zwanghafte oder asthenische Persönlichkeitszüge oder neurotische Krankheiten in der Vorgeschichte können die Schwelle für die Entwicklung dieses Syndroms senken und seinen Verlauf erschweren, aber die letztgenannten Faktoren sind weder notwendig noch ausreichend, um das Auftreten der Störung zu erklären. Typische Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), Träumen oder Albträumen, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit auftreten. Ferner finden sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Meist tritt ein Zustand von vegetativer Übererregtheit mit Vigilanzsteigerung, einer übermäßigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörung auf. Angst und Depression sind häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert und Suizidgedanken sind nicht selten. Der Beginn folgt dem Trauma mit einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann. Der Verlauf ist wechselhaft, in der Mehrzahl der Fälle kann jedoch eine Heilung erwartet werden. In wenigen Fällen nimmt die Störung über viele Jahre einen chronischen Verlauf und geht dann in eine andauernde Persönlichkeitsänderung (F62.0) über.“
Schon im Gutachten und ebenso im Ergänzungsgutachten (ErgGA S. 10) haben die Sachverständigen dargelegt, dass die typischen Merkmale, nämlich Übererregung, sozialer Rückzug, Vermeidungsverhalten, Nachhallerinnerungen und Ängste bei der Klägerin Ziff. 1 vorlagen und bereits im Rahmen der früheren Behandlungen festgestellt wurden (siehe auch Senatsprot. v. 13.04.2017 S. 3). Ebenso, dass sich aufgrund des chronifizierten Stresses rezidivierende mittelgradig bis schwergradige depressive Episoden entwickelt haben. Dass die vorbehandelnden Ärzte zu unterschiedlichen Diagnosen gekommen sind, stellt das Ergebnis der Sachverständigen nicht in Frage. Abgesehen davon, dass die Vorbehandelnden untereinander auch keine einheitliche Diagnose zu stellen vermochten, wurden die typischen Merkmale (Wiedererinnerung, Übererregung, Vermeidungsverhalten) nebst depressiven Episoden von den Vorbehandlern ebenfalls feststellt (ErgGA S. 10, Senatsprot. vo, 13.04.2017 S. 6).
Auch die Gewichtigkeit des Traumas, die die ICD 10-Definition (wenngleich in Fachkreisen umstritten) verlangt, ist vorliegend gegeben. Der Sachverständige Dr. … hat überzeugend dargelegt, dass die Gefahr, dass sich ein traumatisches Geschehen in einer posttraumatischen Belastungsstörung äußert, umso höher ist, desto intensiver die Beziehung zu der eigentlich betroffenen Person ist und sie überdies ebenfalls erhöht ist, wenn der von der posttraumatischen Belastungsstörung Betroffene in das konkrete Geschehen einbezogen ist (Senatsprot. v. 13.04.2017 S. 5). Beide Merkmale waren vorliegend gegeben.
Die Klägerin Ziff. 1 hatte mit ihrem Ehemann eine besonders tragende Partnerschaft (GA S. 33 f.). Dies vermochte der Sachverständige Dr. …, der auf seine Ausbildung und langjährige Erfahrung als Paar- und Familientherapeut verweisen kann, festzustellen. Das Ehepaar … habe überdurchschnittliche Belastungen bewältigt, ohne dass dies zum Scheitern der Ehe geführt habe. Er hat die besondere Tragfähigkeit der Partnerschaft unter anderem damit untermauert, dass das Paar sowohl den Umstand gemeistert hat, dass die Klägerin Ziff. 1 beruflich erfolgreicher gewesen ist als ihr Ehemann und ebenfalls die gravierende psychische Erkrankung ihrer Tochter verkraftet hat (Senatsprot. v. 13.04.2017 S. 4, 6 f.).
Die Klägerin Ziff. 1 war auch in das Geschehen eingebunden. Sie war am 06.04.2004, dem Geburtstag ihres Ehegatten und der Tag der Weichenstellung auf medizinischem Gebiet, ab 12.00 Uhr bei ihrem Mann. Sie hat den schlechten Zustand ihres Ehemannes und die weitere dramatische Verschlechterung des Gesundheitszustands selbst mitangesehen. Hinzu kommt jedoch eine weitere emotionale Einbindung dergestalt, dass die Klägerin Ziff. 1 Schuldgefühle umtreiben, weil sie eine erfolgreiche Kommunikationstrainerin war und sie sich vorwirft, in einer Situation, in der ihre kommunikativen Fähigkeiten gefragt gewesen wären, diese nicht umgesetzt zu haben (LG-Prot. v. 14.01.2015 S. 6). Dieser Unmittelbarkeit der Geschehensbeteiligung kommt auch auf rechtlicher Ebene Bedeutung zu, da es bei solch intensiver Einbindung nahe liegt, dass der Angehörige das Geschehene (und unmittelbar Erlebte) psychisch nicht verkraften kann (BGH, Urt. v. 27.01.2015 – VI ZR 548/12 – NJW 2015, 1451, Rn. 10, zitiert nach juris).
Dass der Sachverständige Dr. … in dieser Situation die Begleitumstände im Krankenhaus und den Tod des Ehegatten als außergewöhnlich belastendes Ereignis im Sinne der ICD 10-Definition annimmt (Senatsprot. v. 13.04.2017 S. 4, 5; LG-Prot. v. 14.01.2015 S. 3), ist für den Senat ohne weiteres einleuchtend. Dass die Erkrankung bei der Klägerin Ziff. 1 einen für eine posttraumatische Belastungsstörung außerordentlich schweren Verlauf genommen hat, gab dem Sachverständigen keinen Anlass zu einer abweichenden Einschätzung. Auch ist für den Senat die Schwere der Erkrankung verständlich, insbesondere wenn man sich vor Augen hält, dass die Klägerin Ziff. 1 (sei es zu Recht oder auch zu Unrecht) die Befürchtung hegt, sie hätte durch entsprechende Kommunikation mit dem Krankenhauspersonal möglicherweise den Tod ihres Mannes verhindern können. Dabei sei am Rande angemerkt, dass sich dem Senat nicht erschließt, dass die besondere Schwere einer Haftung der Beklagten entgegenstehen könnte. Selbst wenn wegen der besonderen Schwere des Verlaufs nach den Definitionen des ICD 10 ggfs. keine posttraumatische Belastungsstörung gegeben wäre, wäre ein anderes Krankheitsbild einschlägig, denn daran, dass die Klägerin Ziff. 1 die geschilderten Beeinträchtigungen zu erdulden hat, besteht kein Zweifel. Dafür, dass die Klägerin Ziff. 1 simuliert oder aggraviert, besteht – auch aus Sicht der Sachverständigen – keinerlei Anhalt.
Auch die weiteren Einwände der Privatgutachterin der Beklagten Prof. Dr. … (vgl. GA vom 06.03.2013 [B7] und ErgGA vom 15.08.2014 [B10]) greifen nicht durch. Der im Privatgutachten vom 06.03.2013 (dort S. 3) erhobene Vorwurf, es fehlten ein Bericht der stationären Behandlung im … Hospital … 2006/2007 und ein Bericht der tagesklinischen Behandlung in Halle von 11/2007 bis 2/2008, wurde dadurch ausgeräumt, dass diese Unterlagen seitens des Landgerichts beigezogen wurden (Arztbriefe Bl. 434 und Bl. 448) und Gegenstand des Ergänzungsgutachtens der Sachverständigen geworden sind. Soweit die Privatgutachterin im Gutachten vom 18.06.2017 (S. 3) nunmehr noch weitere Behandlungsunterlagen aus der Zeit vor dem ersten stationären Aufenthalt vermisst, ist dies nicht nachvollziehbar. Zur sorgfältigen Gutachtenserstattung waren die vorliegenden Unterlagen ausreichend.
Bei der Kritik der Privatgutachterin an der Befunddarstellung (GA S. 4, ErgGA S. 4) geht es um die bloße methodische Frage, ob man eigene Angaben der Patientin in die Anamnese oder in den Befund schreibt. Hier mögen die Sachverständigen zwar die falsche Kategorie gewählt haben, sie haben aber die Angaben der Patientin als solche gekennzeichnet.
bb)
Der Zusammenhang der psychischen Erkrankung der Klägerin Ziff. 1 mit dem Tod des Ehegatten steht zur Überzeugung des Senats (§ 286 ZPO) fest.
Dass die dissoziativen Symptome ab April 2004 Hinweise auf eine akute Belastungsreaktion sind und dies wiederum von einer posttraumatischen Belastungsstörung gefolgt sein kann, hält auch die Privatgutachterin für nachvollziehbar. Ihre Skepsis, ob sich mit Tests nach mehr als acht Jahren klären lässt, ob vor April 2004 eine posttraumatische Belastungsstörung vorgelegen hat oder nicht (PGA v. 06.03.2013 S. 3f.), teilt der Senat indessen nicht. Der Fragebogen (FDS) wird in der Einrichtung der Sachverständigen nicht als Selbstbeurteilungsfragebogen durchgeführt, es handelt sich vielmehr um ein Experteninterview, bei dem der Proband zwar die Antwort gibt, die Beurteilung aber durch den Sachverständigen erfolgt (ErgGA S. 11, LG-Prot. v. 24.02.2015 S. 2). Es mag daher zwar sein, dass der FDS sozusagen „im Original“ anders praktiziert wird, jedoch haben die Sachverständigen durch den Beurteilungsvorbehalt die sehr subjektive Ausrichtung des Tests zu einem guten Teil abgemildert. Dieser Test hat ergeben, dass die Klägerin Ziff. 1 keine dissoziative Störung hat, sondern bezogen auf die traumatische Situation typische peritraumatische dissoziative Symptome, die immer dann wieder auftreten, wenn sie Nachhallerinnerungen (Ganzkörperschmerz, Ganzkörperbrennen) hat (ErgGA S. 10). Dabei hat der Sachverständige Dr. … im Rahmen des FDS-Tests Wert darauf gelegt, alles abzufragen, was darüber hätte Aufschluss geben können, ob dissoziative Symptome schon vor dem Jahr 2004 bei ihr aufgetreten sind. Anhaltspunkte hierfür hätten sich aber nicht ergeben (LG-Prot. v. 14.01.2015 S. 4 f.).
Die Sachverständigen haben auch eine Glaubwürdigkeitsbeurteilung/Konsistenzprüfung durchgeführt. Bereits im Ausgangsgutachten haben die Sachverständigen festgehalten, dass das Denken der Klägerin Ziff. 1 in keiner Weise aggravierend oder simulierend gewesen sei (GA S. 24, auch S. 32). Ferner haben die Sachverständigen angegeben, im Rahmen des FDS-Interviews habe die Konsistenz und Glaubwürdigkeit sichtbar gemacht werden können, da dort sehr differenziert pseudodissoziative Symptome abgefragt werden (ErgGA S. 11).
Soweit die Privatgutachterin eine Auseinandersetzung mit der Frage vermisst, ob die schwere psychische Erkrankung der Tochter oder die Drogenabhängigkeit des Sohnes mitursächlich für die Erkrankung der Klägerin Ziff. 1 gewesen ist, ist anzumerken, dass allein die Mitursächlichkeit die Zurechnung nicht ausschließen würde. Unabhängig davon haben die Sachverständigen diese Frage abgehandelt und überzeugend verneint (GA S. 36; LG-Prot. v. 24.02.2015 S. 6). Sie verweisen darauf, dass die peritraumatische Dissoziation der Hauptgrund dafür sei, dass belastende Ereignisse innerseelisch zu schweren Erkrankungen werden könnten. Vor dem Tod des Ehemannes habe es weder eine posttraumatische Belastungsstörung noch eine dissoziative Störung gegeben (GA S. 36; LG-Prot. v. 24.02.2015 S. 4f.). Zudem hätten die Nachhallerinnerungen und das pathologische Grübeln ausschließlich um Bilder ihres verstorbenen Mannes gekreist sowie um Schuldvorwürfe, die ihr Versagen als Kommunikationstrainerin betreffen (ErgGA S. 12). Zudem habe die Klägerin Ziff. 1 im Zusammenhang mit der Erkrankung der Tochter an Schizophrenie ambulante psychotherapeutische Hilfe und phasenweise medikamentöse Behandlung in Anspruch genommen, jedoch sei sie zu keinem Zeitpunkt krankgeschrieben worden, vielmehr ihrer Arbeit nachgegangen. Dies sei ihr nach dem Tod des Ehemannes nicht mehr gelungen (ErgGA S. 12; LG-Prot. v. 24.02.2015 S. 5). Zu Unrecht sieht die Privatgutachterin (ErgGA S. 4) hier einen Widerspruch zwischen der Feststellung, die Klägerin Ziff. 1 sei 2001/2002 niemals krankgeschrieben gewesen und dem Umstand, dass damals eine behandlungsbedürftige Depression aufgetreten sei. Letzteres verkennen die Sachverständigen nicht, sie weisen aber zu Recht darauf hin, dass die Klägerin Ziff. 1 trotz der behandlungsbedürftigen Depression ihrer anspruchsvollen und mit einer großen Reisetätigkeit verbundenen Arbeit habe nachgehen können.
Die Berufung verweist darauf, dass die Klägerin Ziff. 1 erst ca. 1,5 Jahre nach dem Tod des Ehegatten ihren Beruf aufgegeben hat. Dies stellt aber nach den Umständen des Falles keinen Grund dar, an der Kausalität zwischen dem Tod des Ehegatten und der krankheitsbedingten Aufgabe der Berufstätigkeit zu zweifeln. Die Klägerin Ziff. 1 gab vor dem Tod ihres Ehegatten für das Poko-Institut als Kommunikationstrainerin seit vielen Jahren Seminare und zwar üblicherweise zwei von Montag bis Freitag dauernde Seminare pro Monat. Die Klägerin Ziff. 1 hat bei den Sachverständigen angegeben, sie habe in den ersten Wochen nach dem Tod ihres Ehegatten keine Seminare halten können, ab Mai 2004 habe sie mit Medikamenten ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Sie habe aber immer weniger sprechen können und habe keinen Zugang zu anderen mehr gefunden. Ab Frühjahr 2005 seien die (früher immer sehr guten) Seminarbewertungen schlechter geworden. Im Mai 2005 habe ihr das Poko Institut gesagt, sie solle aussetzen, sich sanieren und man könne sich danach wiedersehen (GA S. 17 f.; die letzten Seminare wurden wohl im Juli 2005 gehalten, K18, 223). Dies habe sie zwar zunächst wie eine Erlösung empfunden, danach habe sie aber panische Angst bekommen, ihre Rechnungen nicht mehr begleichen zu können und habe andere Jobs angenommen (zunächst Ausfahren von Briefen, danach Transporte von Untersuchungsmaterial zwischen Klinik und Labor GA S. 19). Dies ist aber eine schlüssige Darstellung, zumal der Psychiater Dr. … in seinem Attest (K12) angegeben hat, die Klägerin Ziff. 1 sei bereits seit Juni 2004 wieder bei ihm in Behandlung gewesen. Auch wenn die Klägerin Ziff. 1 ihre Beschäftigung als Kommunikationstrainerin daher nach April 2004 noch eine Weile aufrechterhalten konnte, ändert dies nichts daran, dass die letztendlich eingetretene Unfähigkeit, ihrem Beruf nachzugehen auf den Tod des Ehegatten sowie die Begleitumstände im Krankenhaus zurückzuführen ist, wovon auch die Sachverständigen ausgehen (LG-Prot. v. 14.01.2015 S. 6).
b)
Dass die Beeinträchtigungen der Klägerin Ziff. 1 (egal welche Diagnose nach ICD 10 man für die feststehenden Leiden vergeben möchte, nach Auffassung des Senats allerdings die oben genannten) über diejenigen hinausgehen, denen Hinterbliebene bei der Benachrichtigung von dem Unfall eines nahen Angehörigen oder dem Miterleben eines solchen Unfalls erfahrungsgemäß ausgesetzt sind, steht für den Senat außer Frage. Insbesondere gehen die Beeinträchtigungen auch über diejenigen hinaus, die der (seitens der Beklagten zitierten) Entscheidung des OLG Stuttgart, Urt. v. 21.07.1988 – 14 U 3/88 – VersR 1988, 1187 zugrunde lagen.
c)
Anlass zur Einholung eines weiteren Gutachtens gem. § 412 ZPO besteht nicht, insbesondere waren die Ausführungen (und Untersuchungen) der Sachverständigen umfassend, stimmig und widerspruchsfrei.
3.
Die Klägerin Ziff. 1 kann ein Schmerzensgeld (§ 253 BGB) i.H.v. 30.000,00 EUR beanspruchen (vgl. a)), ferner Gutachter- und Kopierkosten (vgl. b)) und Feststellung der Schadensersatzpflicht (vgl. c)).
a)

Ein Schmerzensgeld in Höhe von 30.000,00 EUR erscheint dem Senat angemessen und ausreichend.
Bei der Schmerzensgeldbemessung gem. § 253 BGB sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Dabei stehen die Höhe und das Maß der Lebensbeeinträchtigung ganz im Vordergrund (vgl. BGH, Großer Senat für Zivilsachen, Beschluss vom 6. Juli 1955 – GSZ 1/55, BGHZ 18, 149, 157). Bei den unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit zu berücksichtigenden Umständen hat die Rücksicht auf Größe, Heftigkeit und Dauer der Schmerzen, Leiden und Entstellungen stets das ausschlaggebende Moment zu bilden; der von dem Schädiger zu verantwortende immaterielle Schaden, die Lebensbeeinträchtigung steht im Verhältnis zu den anderen zu berücksichtigenden Umständen immer an der Spitze (BGH, Großer Senat für Zivilsachen, Beschluss vom 6. Juli 1955 – GSZ 1/55, BGHZ 18, 149, 167). Daneben können aber auch alle anderen Umstände berücksichtigt werden, die dem einzelnen Schadensfall sein besonderes Gepräge geben (BGH, Beschl. v. 16.09.2016 – VGS 1/16 –, VersR 2017, 180, Rn. 55, zitiert nach juris).
Als objektivierbare Umstände besitzen vor allem die Art der Verletzungen, Art und Dauer der Behandlungen sowie die Dauer der Arbeitsunfähigkeit ein besonderes Gewicht. Hierbei zählen das Entstehen von Dauerschäden, psychischen Beeinträchtigungen und seelisch bedingten Folgeschäden zu den maßgeblichen Faktoren. Darüber hinaus sind die speziellen Auswirkungen des Schadensereignisses auf die konkrete Lebenssituation des Betroffenen zu berücksichtigen. Die beruflichen Folgen der Verletzung und ihre Auswirkungen auf die Freizeitgestaltung des Geschädigten sind weitere Faktoren bei der Bestimmung des Schmerzensgeldes. (OLG Köln, Urteil vom 07.12.2010 – 4 U 9/09 –, MDR 2011, 290, Rn. 44 mit weiteren Nachweisen, zitiert nach juris).
Betrachtet man die zu den Schockschäden ergangenen Entscheidungen, so fällt auf, dass die bisherige Praxis auch bei schwersten Fällen bei der Höhe der zugebilligten Schmerzensgelder sehr zurückhaltend ist, wobei auch bei schweren Folgen in aller Regel kein 20.000,00 EUR übersteigendes Schmerzensgeld zugebilligt wurde (vgl. den Überblick bei Slizyk, IMMDAT Kommentierung, 13. Aufl. Rn. 307 ff, sowie den Überblick über die Rechtsprechung bei Slizyk, IMMDAT Plus unter den Rubriken „Miterleben des Todes“, „Fernwirkungsschäden“ sowie „Schock“). Vorliegend hält der Senat aber mit dem Landgericht ein 20.000,00 EUR übersteigendes Schmerzensgeld unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles für geboten.
20.000,00 EUR hat das OLG Köln (Urt. v. 12.09.2005 – 16 U 25/05 – NJW 2005, 3074, zitiert nach juris, bestätigt durch BGH, Urt. v. 18.07.2006 – X ZR 142/05 –, NJW 2006, 3268 Rn. 35, zitiert nach juris Hacks/Wellner/Häcker, Schmerzensgeldbeträge, 35. Aufl., lfd. Nr. 35.3046) – dem Landgericht folgend – jeweils Eltern und Geschwistern zugebilligt, die (im Jahr 2001) mit ansehen mussten wie ihr 11-jähriger Sohn und Bruder (infolge einer Verkehrssicherungspflichtverletzung des Reiseveranstalters) bei Benutzung einer Wasserrutsche ertrank und die dabei auch noch Jahre später anhaltende schwerwiegende Beeinträchtigungen und Depressionen davongetragen hatten. Die Beeinträchtigungen der Klägerin Ziff. 1 gehen noch über die dort festgestellten Leiden hinaus. Mit Blick auf die jahrelangen massiven psychischen Beeinträchtigungen, die zum Verlust des Arbeitsplatzes geführt haben sowie jahrelange ärztliche und medikamentöse Behandlungen nach sich gezogen haben, deren Ende nicht absehbar ist, hält der Senat ein Schmerzensgeld i.H.v. 30.000,00 EUR für angemessen, aber auch ausreichend.
Ein noch höheres Schmerzensgeld ist nicht gerechtfertigt. Die Entscheidung des OLG Nürnberg vom 01.08.1995 – 3 U 468/95 – RuS 1995, 384, zitiert nach juris (siehe auch Hacks/Wellner/Häcker, a.a.O., lfd. Nr. 35.3050), mit der 30.000,00 EUR (auf 2017 indexiert: 39.888,00 EUR) zuerkannt wurden, stellt insoweit einen Sonderfall dar. Dort hatten die Eltern ihre drei 18-20 Jahre alten Kinder im Jahr 1986 bei einem Verkehrsunfall verloren, bei dem der Unfallverursacher alkoholisiert mit einer Geschwindigkeit von 100 – 110 km/h unter Missachtung eines Stoppschildes mit dem bevorrechtigten Fahrzeug kollidierte, in dem sich die Kinder befanden. Die beim Vater ausgelöste psychische Erkrankung war im Ausmaß in etwa dem vorliegenden Fall vergleichbar, da er bis zum Urteil fortbestehende schwerste Depressionen ausgebildet hatte. Das OLG Nürnberg hat (zu Recht) angemerkt, dass der (bereits vom Landgericht) zuerkannte Betrag an der oberen Grenze eines möglichen Schmerzensgeldes liege. Anders als im Fall des OLG Nürnberg, wo mit Blick auf die Umstände des Unfalls (neben der Ausgleichsfunktion auch) der Genugtuungsfunktion des Schmerzensgeldes Bedeutung zukam, ist dies vorliegend nicht der Fall. Die Beklagten haben in bester Absicht gehandelt und um das Leben Herrn Dr. …s gerungen (auch wenn es dabei wie ausgeführt zu Behandlungsfehlern gekommen ist).
Soweit die Berufung (unter Hinweis auf BGH Urt. v. 05.11.1996 – VI ZR 275/95 – NJW 1997, 455) meint, es sei eine gesundheitliche Prädisposition für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung schmerzensgeldmindernd zu berücksichtigen, ist dem schon deshalb nicht zu folgen, weil eine entsprechende Prädisposition nicht festzustellen ist. Die Sachverständigen haben ausgeführt, dass die – nunmehr bei der Klägerin Ziff. 1 vorliegende – peritraumatische Dissoziation der Hauptgrund dafür ist, dass belastende Ereignisse innerseelisch zu schweren Erkrankungen führen können. Eine Prädisposition hierfür habe aber nicht bestanden (GA v. 22.01.2013 S. 36; LG-Prot. v. 14.01.2015 S. 5). Aus der Erschöpfungsreaktion in den Jahren 2001/2002 bezogen auf die Erkrankung ihrer Tochter lässt sich auch nicht auf eine entsprechende Prädisposition schließen (vgl. auch Senatsprot. vom 13.04.2017 S. 8).
Der Zinsanspruch rechtfertigt sich aus § 288 BGB. Die Beklagten befinden sich infolge der Zahlungsaufforderung im Anwaltsschreiben vom 28.08.2006 (Anlage K16) seit dem 16.09.2006 in Verzug.
b)
Die Klägerin Ziff. 1 kann darüber hinaus auch den Ersatz der entstandenen Gutachter- und Kopierkosten verlangen, da diese Aufwendungen erforderlich i.S.d. § 249 BGB waren.
c)
Ferner war die begehrte Feststellung der Schadensersatzpflicht auszusprechen, was künftige nicht vorhersehbare immaterielle Schäden und weitere materielle Schäden betrifft.
II.
Ansprüche der Klägerin Ziff. 2 bestehen nicht. Es lässt sich nicht feststellen, dass die Klägerin Ziff. 2 durch den Tod ihres Vaters eine pathologisch fassbare Gesundheitsbeschädigung erlitten hat und etwaige Beeinträchtigungen über diejenigen hinausgehen, denen Hinterbliebene bei der Benachrichtigung von dem Unfall eines nahen Angehörigen oder dem Miterleben eines solchen Unfalls erfahrungsgemäß ausgesetzt sind.
Der Senat hat mit Beschluss vom 14.03.2016 (Bl. 652 ff d.A.) die psychiatrische Begutachtung der Klägerin Ziff. 2 angeordnet. Da sich diese nicht in der Lage gesehen hat, sich einer persönlichen Begutachtung durch Dr. Lang zu unterziehen, hat dieser sein Gutachten auf Grundlage der – äußerst umfangreichen – Behandlungsunterlagen der Klägerin Ziff. 2 erstellt. Der Sachverständige Dr. … hat vor dem Hintergrund einer familiären Belastung (depressive Störungen der Mutter, Depression eines Bruders und narzistische Störung eines weiteren Bruders) sowie eines langjährigen Drogenmissbrauchs (Polytoxikomanie; Cannabis, Ecstasy, LSD) eine vorbestehende, erstmals Ende der 90er Jahre diagnostizierte (aller Wahrscheinlichkeit aber auch bereits Jahre zuvor bestehende) Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis festgestellt (GA S. 7 f., 13). Für die Zeit nach dem Tod des Vaters lasse sich die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung nicht stellen (GA S. 13). Zwar sei es wegen der besonderen Verletzbarkeit/Vulnabilität infolge der Psychose nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen, dass die Klägerin Ziff. 2 infolge des Todes ihres Vaters eine (dann aber auf maximal 1- 2 Jahre beschränkte) Anpassungsstörung ausgebildet habe. Anhaltspunkte hierfür ergäben sich jedoch aus den Behandlungsunterlagen nicht. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit habe danach keine Anpassungsstörung vorgelegen, vielmehr eine normale Trauerreaktion unter Berücksichtigung der schweren Vorerkrankung (Senatsprot. v. 20.07.2017 S. 3). Mit belastbarer Zuverlässigkeit lasse sich ein Einfluss des Todes der Vaters auf den Gesundheitszustand der Klägerin Ziff. 2 nicht feststellen (Senatsprot. v. 20.07.2017 S. 3).
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 92, 100 I, II, IV ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 Sätze 1 und 2, 709 Satz 2 ZPO.
Die Voraussetzungen, unter denen die Revision zuzulassen wäre (§ 543 Abs. 2 ZPO), liegen nicht vor. Soweit beklagtenseits die Zulassung der Revision angeregt wurde (Schriftsatz vom 30.06.2017 S. 12), bezog sich dies lediglich auf die Frage, ob ein Schockschaden unterhalb der Schwelle einer posttraumatischen Belastungsstörung in Betracht kommt. Nachdem eine solche aber bei der Klägerin Ziff. 1 vorliegt, bedarf die Frage, ob anderenfalls die Revision zuzulassen gewesen wäre, keiner Beantwortung.