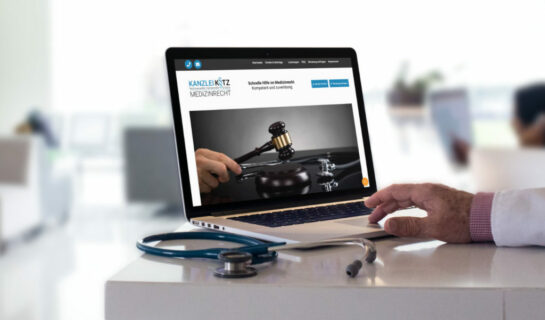Oberlandesgericht Bremen – Az.: 5 U 63/20 – Urteil vom 25.11.2021
Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Landgerichts, 1. Zivilkammer, vom 2.12.2020, Az. 1 O 1708/17, abgeändert.
Der Anspruch des Klägers auf Ersatz des Schadens aus der ärztlichen Behandlung durch die Beklagte vom 4.11.2013 bis zum 5.1.2014 im Klinikum Bremen-Mitte ist dem Grunde nach gerechtfertigt.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtlichen zukünftigen materiellen Schaden sowie sämtlichen weiteren zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung nicht vorhersehbaren immateriellen Schaden zu ersetzen, soweit dieser nicht von den im Berufungsverfahren gestellten Klaganträgen 1., 2. und 4. umfasst ist oder die Forderungen auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind oder übergehen werden.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Revision wird zugelassen.
Gründe
I.
Der Kläger verlangt von der Beklagten Schadensersatz und Schmerzensgeld wegen behaupteter Aufklärungs- und Behandlungsfehler im Zusammenhang mit einer operativen Begradigung der Nasenscheidewand und einer Nasennebenhöhlenoperation am 4.11.2013 in der HNO-Klinik der Beklagten im Klinikum […].
Der Kläger wurde von seinem behandelnden HNO-Facharzt im Hinblick auf eine mögliche Operation der Ohren (Mastoidektomie) in die HNO-Klinik der Beklagten überwiesen und dort in der Ambulanz am 28.10.2013 behandelt. Dort berichtete er Prof. Dr. N. von chronisch rezidivierenden Ohrenentzündungen und Paukenergüssen. Dieser riet dem Kläger zunächst zur Operation der Nasen-Septum-Plastik zur Optimierung der Nasenluftpassage sowie einer sich daran in zeitlichem Abstand von 6-8 Wochen anschließenden Mastoidektomie. Am 1.11.2013 unterzeichnete der Kläger die Operationseinwilligung für die Nasen-Septum-Plastik. Am 4.11.2013 wurde der Kläger stationär aufgenommen und der Eingriff zur Begradigung der Nasenscheidewand sowie eine vollständige Nasennebenhöhlenoperation durch den Oberarzt Dr. P. durchgeführt. Unter der OP trat eine stärkere arterielle Blutung auf. Postoperativ war der Kläger nicht erweckbar. Im CT zeigte sich eine Hirnblutung. Bei der daraufhin erfolgten neurochirurgischen Intervention wurde festgestellt, dass es bei der ersten OP zu einer Duraverletzung, der Verletzung der vorderen Hirnschlagader und zu einer Durchtrennung des Riechnervs links gekommen war. Der Kläger wurde intubiert und beatmet auf die Intensivstation verlegt und im Folgenden neurochirurgisch behandelt. Im weiteren Verlauf entwickelte er eine systemische Entzündungsreaktion des Körpers und wurde am 8.11.2013 erneut operiert. Es folgten weitere stationäre und ambulante Behandlungen in anderen Kliniken in den Jahren 2014 und 2015 sowie ergotherapeutische Behandlungen.

Der Kläger hat behauptet, die Operation am 4.11.2013 sei technisch fehlerhaft durchgeführt worden, insbesondere habe der Operateur die äußerste Sorgfalt, die im Bereich des dünnen und besonders verletzlichen Siebbeins stets und aufgrund der hier erkannten deutlich ausgedünnten Frontobasis-Abdeckung besonders erforderlich gewesen sei, nicht eingehalten. Die präoperative Diagnostik sei nicht ausreichend gewesen. Es hätte ein CT mit koronarer Schichtung veranlasst werden müssen.
Ferner hat der Kläger Aufklärungsfehler gerügt. Es habe keine Aufklärung über Behandlungsalternativen dahingehend gegeben, dass ein Zuwarten und zunächst eine weitere Behandlung der Ohren möglich gewesen wären. Die Operation der Nase sei – anders als von Prof. Dr. N. dargestellt – nicht gegenüber der Ohrenoperation vorrangig gewesen und nicht erforderlich gewesen, um im Anschluss daran die Ohren zu operieren. Ihm seien die unterschiedlichen Vorteile und Risiken in Bezug auf die Reihenfolge der Operationen nicht erläutert worden. Es habe weder ein Gespräch über die mit der Operation allgemein verbundenen Risiken noch über die hohen individuellen Risiken aufgrund der aufgebrauchten Frontobasis-Abdeckung des Klägers stattgefunden. Diese erhöhten Risiken seien auch erkennbar gewesen. Insbesondere sei der Kläger über einen möglichen Hirnschaden mit Dauerfolgen nie aufgeklärt worden. Die im Aufklärungsbogen aufgeführten Risiken seien insgesamt verharmlosend dargestellt und die Auswirkungen auf die Lebensführung bei der Realisierung der Risiken nicht aufgeführt worden. Er sei nicht darüber aufgeklärt worden, dass die Operation nicht dringlich gewesen sei. Spätestens im Zeitpunkt der intraoperativ näher erkannten erhöhten Risiken hätte der Eingriff abgebrochen werden müssen, um die Einwilligung des Klägers zur Fortsetzung des Eingriffs nachzuholen. In Kenntnis der Risiken hätte der Kläger den Eingriff nicht durchführen lassen, sondern die Behandlung der Ohren fortgesetzt.
Der Kläger hat näher genannte gesundheitliche Folgen behauptet. Er ist in Pflegestufe 1 (übergeleitet in Pflegegrad 2) eingestuft und hat einen GdB 90. Im Juli 2014 wurde die Betreuung in sämtlichen Angelegenheiten durch seine Ehefrau angeordnet. Mit Beschluss des Amtsgerichts Osterholz-Scharmbeck vom 3.8.2021 wurde die Betreuung wieder aufgehoben.
Der Kläger hat ein Schmerzensgeld i.H.v. 125.000 € für angemessen gehalten und mit näherer Begründung einen Haushaltsführungsschaden i.H.v. 22.446,00 € verlangt.
Der Kläger hat beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger ein angemessenes, in das Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen;
2. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 22.446,00 € nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen;
3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtlichen weiteren zukünftigen materiellen Schaden sowie sämtlichen weiteren zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung nicht vorhersehbaren immateriellen Schaden zu ersetzen, soweit dieser aus der fehlerhaften/rechtswidrigen Operation vom 4.11.2013 sowie der weiteren Behandlung in dem Behandlungszeitraum vom 4.11.2013 bis zum 5.1.2014 im Klinikum Bremen-Mitte resultiert, soweit dieser nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen ist oder übergehen wird;
4. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 3.789,44 € vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus ab Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
Sie hat behauptet, die Operation sei fehlerfrei durchgeführt worden. Bei dem Kläger habe sich eine seltene, aber typische Operationskomplikation verwirklicht, über die der Kläger auch aufgeklärt worden sei. Die präoperative Diagnostik sei korrekt gewesen. Das zur Vorbereitung der OP angefertigte CT habe die Indikation für den Eingriff bestätigt. Der Operateur P. sei ein erfahrener Operateur für den streitgegenständlichen Eingriff. Die intraoperativ eingetretenen Verletzungen der Hirnschlagader und des Riechnervs seien aufgrund der näher genannten anatomischen Situation beim Kläger als schicksalhaft zu bewerten. Auf die aufgetretenen Verletzungen sei intraoperativ adäquat reagiert worden. Auch die Aufklärung sei nicht zu beanstanden, da der Kläger umfassend durch Prof. Dr. N. über den Eingriff und die Alternativen sowie über den Eingriff und die damit verbundenen Risiken durch die Ärztin Frau A. aufgeklärt worden sei.
Das Landgericht hat die Klage nach Einholung eines Sachverständigengutachtens, Anhörung des Sachverständigen Dr. B. und Vernehmung der Zeugen Prof. Dr. N. und A. mit Urteil vom 2.12.2020 abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass der Kläger einen Behandlungsfehler der Beklagten nicht bewiesen habe und der Eingriff auch nicht aufgrund unzureichender Aufklärung rechtswidrig gewesen sei. Dabei hat sich das Landgericht auf das Gutachten des Sachverständigen Dr. B. gestützt. Dieser habe die präoperative Diagnostik für ausreichend und leitliniengerecht erachtet. Soweit der Zeuge Prof. Dr. N. eine darüberhinausgehende präoperative Diagnostik für erforderlich gehalten habe, begründe dies keinen Behandlungsfehler. Der Zeuge habe im nicht zur Gerichtsakte gelangten CT vom 1.11.2013 lediglich eine zweite Sicherheitsstufe gesehen, die der Sachverständige jedoch auch wegen der damit verbundenen Strahlenbelastung nicht für erforderlich gehalten habe. Die Kammer hat es daher nicht für erforderlich gehalten, dem Sachverständigen aufzugeben, diese CT-Aufnahme zu begutachten und dies auch darauf gestützt, dass der Sachverständige sicher davon ausgegangen sei, dass sich der Befund zwischen dem 8.8.2013 und dem 1.11.2013 nicht derart geändert habe, dass die Indikation entfallen sei. Es sei höchst unwahrscheinlich, dass sich der Umfang der Ausdünnung der Schädelbasis innerhalb dieses Zeitraums verändert habe. Eine weiter fortgeschrittene Ausdünnung würde den Eingriff erst recht indizieren. Aufgrund des Unschärfebereichs des CT könne man überdies ohnehin erst in der Operation erkennen, wie dünn der Knochen tatsächlich sei.
Der Sachverständige habe – unter Verweis auf den OP-Bericht – bestätigt, dass der Eingriff lege artis durchgeführt und auf die aufgetretenen Komplikationen richtig reagiert worden sei. Der Verlauf sei als schicksalhaft zu bewerten. Die Bewertung des Sachverständigen werde auch durch die Ausführungen des MDK-Gutachters Prof. Dr. E. gestützt. Schließlich sei der Operateur Dr. P. für die streitgegenständliche Operation qualifiziert gewesen.
Die Kammer ist nach der Beweisaufnahme zu der Überzeugung gelangt, dass der Kläger sowohl über die Risiken und Chancen des Eingriffs als auch über mögliche Behandlungsalternativen zutreffend aufgeklärt worden sei. Die Risikoaufklärung durch die Zeugin A. sei ausreichend gewesen. Die Beklagte habe bewiesen, dass die Zeugin in dem Aufklärungsgespräch mit dem Kläger alle in dem Formular aufgeführten Komplikationen angesprochen habe. Dabei sei es ausreichend, dass die Zeugin ihr übliches Vorgehen bei der Aufklärung im Einzelnen geschildert habe. Es komme nicht darauf an, dass das Aufklärungsformular nach Einschätzung des Sachverständigen sehr knapp gehalten sei, da allein entscheidend das geführte Gespräch zwischen Arzt und Patient sei. Die dokumentierte Risikoaufklärung sei nach Auffassung des Sachverständigen aus medizinischer Sicht ausreichend. Es habe im individuellen Fall des Geschädigten keinen Anhalt für eine komplexe, risikobehaftetere intraoperative Situation gegeben, die eine über das normale Maß hinausgehende Aufklärung und präoperative Planung nötig gemacht hätte. Auch ein Abbruch der OP sei nach Ansicht des Sachverständigen nicht erforderlich gewesen. Zu diesem Ergebnis sei auch der Gutachter des MDK gekommen. Anhaltspunkte dafür, dass die Zeugin A. bestehende Risiken verharmlost habe, habe die Kammer nicht. Die Aufklärung sei auch rechtzeitig erfolgt. Der Sachverhalt der vom Kläger herangezogenen Entscheidung des OLG Köln (Urteil vom 16.1.2019, 5 U 29/17) sei mit dem vorliegenden nicht vergleichbar. Nach Auffassung der Kammer sei ein expliziter Hinweis auf das Bestehen eines letalen Risikos und möglicher Dauerfolgen nicht erforderlich. Dies hat die Kammer damit begründet, dass der Kläger durch die von der Zeugin genannten seltenen Komplikationen näher bezeichneter Hirnverletzungen mit einem lebensbedrohlichen Verlauf und/oder dauerhaften Schädigungen auch ohne besondere Erwähnung habe rechnen müssen. Aber auch bei Annahme einer Aufklärungspflicht über ein vitales Risiko könne daraus keine Haftung der Beklagten hergeleitet werden, da sich dieses Risiko vorliegend nicht verwirklicht habe.
Auch die Aufklärung durch Prof. Dr. N., dass die Nasenoperation vor der Ohrenoperation durchgeführt werden sollte sowie das Nichtbesprechen von Alternativen zur vorgeschlagenen Nasenoperation sei nicht zu beanstanden. Insbesondere habe Prof. Dr. N. den Eingriff an den Ohren nur für den Fall als indiziert angesehen, dass der Eingriff an der Nase nicht zum Erfolg geführt hätte. Der Sachverständige Dr. B. habe die inhaltliche Richtigkeit der näher ausgeführten Angaben des Zeugen bestätigt. Der Sachverständige habe auch bestätigt, dass es angesichts der Ausprägung der Entzündung der Nebenhöhlen des Klägers keine Alternative gegeben habe, die gleichermaßen indiziert gewesen sei und zu einer Verbesserung der Beschwerden des Klägers geführt hätte. Die Gabe entzündungshemmender Mittel sei zwar prinzipiell eine Behandlungsalternative, allerdings würde man damit nur die Symptome, nicht aber die Ursachen behandeln. Aus diesem Grund sei die medikamentöse Behandlung zwar indiziert, aber keine gleichwertige Therapie. Bei einem komplett entzündeten Zustand wie bei dem Kläger sei die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter Anwendung von Nasenspray eine Besserung ergebe, sehr gering. Auch ein Zuwarten hätte keine Verbesserung der Situation für den Kläger gebracht. Es sei vielmehr davon auszugehen, dass seine Beschwerden zugenommen hätten. Zu dem gleichen Ergebnis sei auch der MDK-Gutachter gekommen. Die vom behandelnden HNO-Arzt angedachte Operation der Ohren sei nicht indiziert und daher keine Behandlungsalternative gewesen.
Das Sachverständigengutachten sei überzeugend, wenn auch schriftlich knapp, jedoch in der mündlichen Verhandlung überzeugend auf Nachfragen ergänzt worden. Dass der Sachverständige dem Gericht nicht angezeigt habe, dass ihm die CT-Aufnahmen vom 1.11.2013 nicht vorgelegen haben, lasse nicht den Schluss darauf zu, der Sachverständige habe das Gutachten unvollständig und ungenau erstellt. Aus Sicht des Sachverständigen sei es auf die Aufnahmen nicht angekommen. Die unterschiedliche Einschätzung des Sachverständigen und des Zeugen Prof. Dr. N. im Hinblick auf die Erforderlichkeit einer weiteren CT-Aufnahme habe nicht die Einholung eines Obergutachtens erforderlich gemacht.
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes im ersten Rechtszug wird auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils Bezug genommen.
Mit der Berufung verfolgt der Kläger seine erstinstanzlichen Anträge weiter. Er greift das Urteil primär im Hinblick auf die verneinten Aufklärungsfehler an. Ferner greift er die Beweiserhebung des Landgerichts insoweit an, dass die Einholung eines weiteren Gutachtens zu der Fragestellung der korrekten intraoperativen Vorgehensweise zu Unrecht abgelehnt worden sei.
Zu Unrecht habe das Landgericht einen Aufklärungsfehler verneint, der darin bestehe, dass der Kläger nicht über das Risiko von Dauerfolgen aufgeklärt worden sei. Insbesondere das hier bestehende Risiko einer dauerhaften Hirnschädigung sei aufklärungspflichtig gewesen. Insoweit stützt sich der Kläger insbesondere auf ein Urteil des OLG Zweibrücken vom 10.11.2009 (5 U 27/08). Die Argumentation des Landgerichts, dass solche Risiken „allgemein bekannt gewesen seien“ überzeuge nicht. Der Kläger habe weder Kenntnis von diesen möglichen Dauerschäden gehabt, noch seien diese allgemein bekannt. Die vom Landgericht herangezogene Entscheidung des BGH vom 14.2.1989 (VI ZR 65/88) sei vorliegend nicht einschlägig. Es sei insbesondere nicht richtig, dass ein Patient mit dem Hinweis auf eine Hirnverletzung/Hirnhautverletzung eine dauerhafte Hirnfunktionsstörung verbinde. Davon könne ein aufklärender Arzt auch nicht ausgehen. Vielmehr werde eine Verletzung als vorübergehender Zustand begriffen, der schlimmstenfalls mittels einer Operation wieder behebbar sei. Auch stelle die genannte BGH-Entscheidung lediglich auf die sogenannten „allgemeinen Operationsrisiken“ ab. Auch hier seien aber bereits bei schwerwiegenden Folgen Ausnahmen vorgesehen. Das Landgericht befinde sich mit seiner Entscheidung ferner im Widerspruch zu der genannten Entscheidung des OLG Zweibrücken, nach der über Verletzungen und Folgen aufzuklären sei. Dies gelte umso mehr, als im dortigen Fall – ebenso wie vorliegend – nach dem präoperativen Kenntnisstand die Operation weder dringlich noch vital indiziert gewesen sei. Sofern der Senat hierzu eine andere Auffassung als das OLG Zweibrücken vertrete, werde hilfsweise die Zulassung der Revision beantragt. Widersprüchlich sei auch, dass das Landgericht das Risiko als selten bezeichne und gleichzeitig als allgemeines Operationsrisiko bewerte. Denn die seltenen Operationsrisiken würden eben gerade nicht regelmäßig auftreten, sodass ein Arzt auch nicht davon ausgehen könne, dass ein entsprechendes Wissen bei dem Patienten zu unterstellen sei. Der Kläger verweist darauf, dass gerade bei einem ärztlichen Routineeingriff der Patient diesen im Allgemeinen als ungefährlich ansehe. Entgegen der Wertung der Kammer sei die dokumentierte verbalisierte Risikoaufklärung zu Hirndauerschäden nach Auffassung des Sachverständigen gerade nicht ausreichend gewesen. Insoweit verweist der Kläger auf die protokollierte Aussage des Sachverständigen. Vielmehr habe der Sachverständige lediglich ausgeführt, dass die schwerwiegenden Komplikationen aufklärungspflichtig gewesen seien. Nicht ausgesagt habe er aber, dass dieses auch dokumentiert worden sei. Außerdem enthalte das Urteil eine Argumentationslücke dahingehend, dass sich die Kammer bei der Hilfsargumentation zwar mit dem Letalitätsrisiko auseinandergesetzt habe, nicht jedoch mit dem Risiko eines Dauerschadens. Das Landgericht habe auch nicht berücksichtigt, dass die Zeugin A. ausgeführt habe, dass sie das Aufklärungsgespräch analog zu dem Aufklärungsbogen führe. Hieraus ergebe sich, dass das Aufklärungsgespräch ebenso defizitär wie der vom Sachverständigen zu Recht als sehr knapp und damit als defizitär bezeichnete Aufklärungsbogen gewesen sei. Dasselbe gelte für die Riechnervverletzung, die ebenfalls zu einem Dauerschaden im Sinne des Verlustes des Geruchssinns geführt habe.
Der Kläger rügt, das Landgericht habe eine wirksame Einwilligung in die OP auch deshalb zu Unrecht angenommen, weil dem Kläger keine hinreichende Bedenkzeit zwischen Aufklärungsgespräch und Operationseinwilligung zugebilligt worden sei. Hierzu verweist er noch einmal auf die Entscheidung des OLG Köln vom 16.1.2019 (5 U 929/17), deren Grundsätze das Landgericht unrichtig angewandt habe. Soweit das Landgericht ausgeführt habe, der Kläger sei von der Zeugin A. nicht bedrängt worden, komme es hierauf nicht an. Die Verkürzung der Entscheidungsfreiheit resultiere vielmehr daraus, dass nicht genügend Bedenkzeit zu einer wohlüberlegten Entscheidung gegeben werde. Anders als das Landgericht meine, sei auch unerheblich, ob der Kläger zuvor schon mit Dr. N. über den Eingriff gesprochen habe, da in diesem Gespräch nicht über die Risiken gesprochen wurde. Ebenso könne nicht darauf abgestellt werden, ob der Kläger sich freiwillig zur Operation begeben habe. Auch wenn in dem der Entscheidung des OLG Köln zugrundeliegenden Fall der zeitliche Abstand zwischen der Unterzeichnung des Aufklärungsbogens und Durchführung der OP deutlich kürzer gewesen sei als vorliegend, sei es erst recht unverständlich, wieso dem Kläger vorliegend keine hinreichende Bedenkzeit gegeben worden sei. Soweit der Senat hierzu eine andere Auffassung als das OLG Köln vertrete, werde hilfsweise die Zulassung der Revision beantragt.
Der Kläger rügt außerdem, das Landgericht habe zu Unrecht eine Aufklärungspflicht über die Behandlungsalternative Nasenspray verneint. Insoweit verweist der Kläger auf ein Urteil des Senats vom 23.5.2019 (5 U 12/16). Der Sachverständige habe ausgeführt, dass er selbst im Falle eines komplett entzündeten Zustandes ein operatives Vorgehen empfehle und nur wenn der Patient dies nicht wünsche, auch noch einmal die Option mittels eines Nasensprays angesprochen werde. Auch hier rügt der Kläger nochmals die Nichtberücksichtigung des CT vom 1.11.2013 und behauptet hierzu, die Auswertung des CT ergebe, dass in dem Bereich der Nebenhöhlen kein komplett entzündeter Bereich erkennbar gewesen sei, der es rechtfertigte, von der Aufklärung über ein alternativ zu verwendendes Nasenspray abzusehen. Hierzu verweist der Kläger auf eine Leitlinie, die das Versagen eines konservativen Therapieversuchs, insbesondere bei dem hier vorliegenden nicht dringlichen Eingriff, voraussetze. Der Kläger rügt schließlich, dass das Landgericht zu Unrecht einen Aufklärungsfehler hinsichtlich der Ohroperation verneint hat. Dies betreffe die vom Kläger näher ausgeführte Alternative der Tympanotomie wegen des beim Kläger bestehenden Verdachts auf ein disloziertes Paukenröhrchen. Bei hinreichender Aufklärung hätte sich der Kläger gegen die Operation entschieden, zumindest noch einmal mit seinem HNO-Arzt gesprochen.
Schließlich rügt der Kläger eine fehlerhafte Beweiserhebung durch das Landgericht. Zu Unrecht sei das CT vom 1.11.2013 nicht ausgewertet worden, aus dem sich der Entzündungsgrad und damit das individuelle Risiko beim Kläger habe feststellen lassen. Auch sei nicht ersichtlich, warum die Kammer der Einschätzung des Sachverständigen Dr. B. gefolgt ist, dass das CT vom 8.8.2013 hinreichend alle Strukturen erkennen lasse und nicht der Auffassung von Prof. Dr. N., dass die Nasennebenhöhlen auf dem Felsenbeinhöhlen-CT vom 8.8.2013 nicht erkennbar seien.
Der Kläger beantragt, unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils,
1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger ein angemessenes, in das Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen;
2. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 22.446,00 € nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen;
3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtlichen weiteren zukünftigen materiellen Schaden sowie sämtlichen weiteren zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung nicht vorhersehbaren immateriellen Schaden zu ersetzen, soweit dieser aus der fehlerhaften/rechtswidrigen Operation vom 4.11.2013 sowie der weiteren Behandlung in dem Behandlungszeitraum vom 4.11.2013 bis zum 5.1.2014 im Klinikum [..] resultiert, soweit dieser nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen ist oder übergehen wird;
4. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 3.789,44 € vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus ab Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das erstinstanzliche Urteil. Ergänzend führt sie aus: Der Kläger sei ordnungsgemäß über die Nasennebenhöhlenoperation aufgeklärt worden. Soweit der Kläger eine Aufklärungsbedürftigkeit über Dauerfolgen postuliere, sei dies im Rahmen der Aufklärung erfolgt. Dies ergebe sich schon aus den Begriffen im Aufklärungsbogen, denn bei Gefühl-, Riech- sowie Atemstörungen, Blindheit oder Hirnverletzung sowie äußere Formveränderungen, Verbrennungen etc. handle es sich bereits begriffsimmanent um Dauerfolgen. Insoweit verweist die Beklagte auf eine Entscheidung des BGH vom 11.10.2016 (VersR 2017,100 ff.). Die dortigen Ausführungen zum Begriff „Lähmung“ seien auf die hier in Rede stehende Möglichkeit des Eintritts von Dauerfolgen zu übertragen. Sofern der Kläger behaupte, dass über Hirndauerschäden und Hirnfunktionsstörungen „definitiv auch nicht aufgeklärt“ worden sei, sei dies eine unbeachtliche Erklärung ins Blaue hinein, da der Klägervertreter in der mündlichen Verhandlung vorgetragen habe, dass der Kläger selbst keine Erinnerungen an die Gespräche mit Prof. Dr. N. oder Frau A. habe. Hinsichtlich der Verletzung des Riechnervs verweist die Beklagte auf das Aufklärungsformular, sodass auch hierüber aufgeklärt worden sei. Der Kläger sei von Frau A. auch nicht zur Unterschrift unter das Formular gedrängt worden. Zudem werde in dem Aufklärungsformular ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Kläger die Einwilligung widerrufen könne. Dem stehe die vom Kläger zitierte Entscheidung des OLG Köln nicht entgegen.
Das vom Sachverständigen nicht ausgewertete CT vom 1.11.2013 führe zu keiner abweichenden medizinischen Bewertung, insbesondere lasse sich hieraus kein individuell erhöhtes Risiko beim Kläger herleiten. Vielmehr ergebe sich hieraus ein ausgeprägter operationsbedürftiger Befund. Die Aufnahme zeige, dass die knöchernen Strukturen intakt erschienen und ohne Hinweis auf eine präoperative Liquorfistel. Hinweise für eine Aufweichung des Knochens seien nicht gegeben, insbesondere sei kein Hinweis für eine Schädelbasiserosion mit Lufteinschlüssen festzustellen. Somit sei von einer intakten Schädelbasis auszugehen gewesen.
Die Verwendung von Nasenspray sei im Falle des Klägers keine aufklärungspflichtige Behandlungsalternative gewesen. Vielmehr sei im Gegenteil bei längerfristiger Anwendung von abschwellendem Nasenspray mit einer zusätzlichen Schädigung der Nasenschleimhaut und häufig mit einem Privinismus zu rechnen. Auch die Wirkung eines kortikoidhaltigen Nasensprays wäre bei den vorliegenden Befunden insuffizient gewesen. Im Übrigen könne das vorliegende chronische Krankheitsbild beim Kläger medikamentös nicht dauerhaft therapiert werden.
Die Beklagte wiederholt schließlich ihre Auffassung, dass die Ohrenproblematik beim Kläger lediglich ein Symptom gewesen sei, welches durch eine mangelhafte Belüftung aufgrund einer Tubenventilationsstörung hervorgerufen worden sei. Im Übrigen sei auch die Mastoidektomie mit erheblichen – näher genannten – Risiken verbunden, die erheblicher seien als beim streitgegenständlichen Eingriff.
Der Kläger trägt ergänzend vor, dass bei ihm am 30.12.2014 eine Mastoidektomie im Klinikum […] durchgeführt worden sei sowie weitere Klinikaufenthalte sich angeschlossen hätten.
Die Beklagte führt hierzu aus, dass die vom Kläger eingereichten Arztberichte eine Bestätigung der chronischen Tubenventilationsstörung enthielten.
Mit Schriftsatz vom 1.11.2021 nimmt die Beklagte zu Hinweisen des Senats in der mündlichen Verhandlung Stellung und vertritt die Ansicht, dass durch das Erscheinen des Klägers in der Klinik der Beklagten zur Durchführung der verabredeten OP am 4.11.2013 jedenfalls die (erneute) Erteilung oder Wiederholung der Einwilligung durch den Kläger zu sehen sei und daher der Abstand von drei Tagen zwischen Aufklärung am 1.11.2013 und Aufnahme in der Klinik am 4.11.2013 ausreichend für eine wirksame Aufklärung sei. Die Entscheidung des OLG Köln betreffe aus näher genannten Gründen einen sehr speziellen Einzelfall, der auf den vorliegenden Rechtsstreit nicht übertragbar sei. Auch der Sachverständige Dr. B. habe die dem bundesweit allgemein üblichen Klinikstandard entsprechende Praxis der Beklagten nicht beanstandet. Zumindest hätte sich die Beklagte in einem nicht vorwerfbaren Irrtum befunden, so dass die Haftung für die nachteiligen Folgen wegen fehlender wirksamer Einwilligung im konkreten Fall mangels Verschuldens entfallen würde. Höchst vorsorglich beruft sich die Beklagte auf den Einwand der hypothetischen Einwilligung.
Zur Ergänzung des Parteivorbringens im Berufungsrechtszug wird auf die Schriftsätze der Parteien Bezug genommen.
Der Senat hat ergänzend Beweis erhoben durch Anhörung des Sachverständigen Dr. B., Vernehmung der Zeugin A. sowie Anhörung des Klägers. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 14.10.2021 (Bl. 370 ff. der Akte) Bezug genommen.
II.
Die Berufung ist zulässig (§§ 511 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 513 Abs. 1, 517, 519 f. ZPO). Sie hat auch in der Sache insoweit Erfolg, als dem erhobenen Feststellungsantrag im Wege des Teilurteils stattzugeben und die Klage im Übrigen durch Zwischenurteil dem Grunde nach für gerechtfertigt zu erklären ist (§ 304 ZPO).
Dem Kläger steht gegen die Beklagte dem Grunde nach ein vertraglicher Anspruch auf materiellen und immateriellen Schadensersatz zu, weil die Operation vom 1.11.2013 wegen unwirksamer Einwilligung des Klägers nicht rechtmäßig war. Soweit der Kläger die Feststellung beantragt, dass weitere materielle und immaterielle Schäden zu ersetzen sind, die nicht vom Schmerzensgeldantrag sowie den bezifferten Klageanträgen umfasst sind, war der Klage im Wege des Teilurteils stattzugeben.
1.
Soweit der Kläger rügt, die Aufklärung sei nicht ausreichend gewesen, da nicht auf das Risiko eines Dauerschadens hingewiesen worden sei, greift diese Rüge jedoch nicht. Das Landgericht hat die Anforderungen an die Aufklärung zutreffend und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung dargestellt. Auch die Beweislast der Behandlerseite hat das Landgericht zutreffend gesehen und vor diesem Hintergrund die Zeugin A. vernommen. Dass die Zeugin die im Formular aufgelisteten Punkte mit dem Kläger besprochen hat, wird mit der Berufung nicht angegriffen. Der Kläger rügt lediglich, dass nicht auf einen Dauerschaden sowohl hinsichtlich des Hirnschadens als auch des Verlustes des Geruchssinns hingewiesen wurde. Richtig ist, dass im Aufklärungsbogen (B1 = Bl. 45 der Akte) ein Dauerschaden nicht ausdrücklich angesprochen wird. Aufgeführt ist jedoch u.a. die Riechstörung sowie die Hirn-(haut)verletzung/-entzündung und der Hirnwasserfluss. Die Zeugin A. hat in ihrer Vernehmung bestätigt, dass sie die genannten Punkte mit dem Patienten durchspreche. Sie habe auch etwas zur Hirnverletzung/Hirnhautverletzung gesagt etwa in dem Sinne, dass es passieren könne, dass die Schädelbasis verletzt wird. Der Sachverständige hat hierzu ausgeführt, dass der Aufklärungsbogen vorliegend sehr kurz sei und in dem von ihm verwendeten Bogen auch etwas über Dauerschaden und Hirnfunktionsstörungen stehe. In der Folge hat der Sachverständige ausgeführt, dass man mögliche gefährliche Folgen ansprechen müsse, aber sicher nicht den Fokus darauf legen solle. Diese Ausführungen hat der Sachverständige auf die Frage nach der Komplikation des Versterbens gemacht. Beispielhaft angesprochen hat er eine Operation an der Halsschlagader, bei der sicherlich über das Versterbensrisiko aufzuklären sei. Dies liege aber in der Gefährlichkeit dieses Eingriffs als solchem. Bei dem vorliegenden standardisierten Eingriff, der in Deutschland hundertfach durchgeführt werde, würde man den Fokus anders legen. Die Nasenscheidewandkorrektur sei sozusagen das Brot- und Buttergeschäft der HNO. Das Landgericht hat einen expliziten Hinweis auf das Bestehen eines letalen Risikos und mögliche Dauerfolgen für nicht erforderlich erachtet und zugleich die insoweit abweichende Ansicht des OLG Zweibrücken im Hinblick auf das letale Risiko bei einer Nasennebenhöhlenoperation angesprochen. Im Übrigen sei es allgemein bekannt, dass die Komplikationen in Bezug auf das Gehirn auch einen lebensbedrohlichen Verlauf nehmen und/oder mit dauerhaften Schädigungen verbunden sein könnten, sodass der Kläger auch ohne besondere Erwähnung damit rechnen müsse. Insoweit hat die Kammer auf ein Urteil des BGH zum bekannten Risiko einer Wundinfektion verwiesen. Im Übrigen habe sich das letale Risiko auch nicht verwirklicht, sodass nach dem Schutzzweck der Aufklärungspflicht aus der Verwirklichung dieses Risikos keine Haftung hergeleitet werden könne. Der Senat schließt sich diesen Ausführungen an. Aus der Entscheidung des OLG Zweibrücken (Urteil v. 10.11.2009, 5 U 27/08) ergibt sich für den vorliegenden Fall nichts anderes. Anders als im vorliegenden Fall hatte sich dort zum einen das Letalitätsrisiko verwirklicht. Zum anderen hat das OLG Zweibrücken darauf verwiesen, dass der Hinweis auf eine Hirnhautentzündung als mögliche Komplikation nicht ausreichend sei, sondern vielmehr auf die Verletzung von Hirnhaut und Hirngewebe hätte hingewiesen werden müssen (OLG Zweibrücken, a.a.O., Rn. 53). Dieser Hinweis auf eine Verletzung ist vorliegend aber erfolgt. Es wird nicht lediglich die Hirnhautentzündung genannt, sondern ausdrücklich auch die Verletzung sowie der Hirnwasserfluss. Dass eine Hirn(haut)verletzung mit Hirnwasserfluss einen Dauerschaden hervorrufen kann, ist auch nach Ansicht des Senats allgemein bekannt.
Soweit der Kläger die Aufklärung über die Möglichkeit eines Dauerschadens in Bezug auf den Geruchssinn nicht für ausreichend hält, greift auch dieser Einwand nicht. Die Zeugin A. hat erstinstanzlich lediglich allgemein ausgesagt, dass sie die Risiken, die im Aufklärungsbogen stehen, mit dem Patienten durchspreche. Die Angaben der Zeugin hat der Kläger nicht in Abrede gestellt. Er rügt lediglich, dass die im Aufklärungsbogen angegebene Riechstörung nicht ausreichend sei. In ihrer Vernehmung durch den Senat hat die Zeugin A. ausgeführt, dass sie den Kläger auch auf die Möglichkeit der Verletzung der Riechrinne und auch darauf hingewiesen hat, dass es hier zu der Beschädigung und in der Folge zu einer Riechstörung kommen kann. Diese Ausführungen hat der Kläger nicht angegriffen. Der Sachverständige hat diese von der Zeugin geschilderte Aufklärung als ausreichend bewertet, die dem Standard in seiner Klinik entspreche. Der Senat folgt diesen überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen und hält die Aufklärung im Hinblick auf eine dauerhafte Beeinträchtigung des Geruchssinnes für ausreichend.
2.
Die Rüge des Klägers, er sei nicht ausreichend über Behandlungsalternativen aufgeklärt worden, greift ebenfalls nicht.
Eine Aufklärungspflicht besteht, wenn für eine medizinisch sinnvolle und indizierte Therapie mehrere im Heilungserfolg gleichwertige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen des Patienten führen oder wesentlich unterschiedliche Risiken oder Erfolgschancen aufweisen (Martis/Winkhart-Martis, MDR 2020, 1421, 1424). Eine echte Wahlmöglichkeit, über die der Patient vor einer relativ indizierten Operation aufzuklären ist, stellt eine konservative oder rein abwartende Behandlung auch nur dann dar, wenn die begründete Aussicht besteht, dass hiermit mehr als eine nur kurzzeitige Beschwerdelinderung erreicht werden kann (Martis/Winkhart-Martis, MDR 2020, 1421, 1426; OLG Dresden, Urteil vom 27. März 2018 – 4 U 1457/17 –, juris).
Soweit der Kläger auf die Behandlungsalternative einer (weiteren) Behandlung mit Nasenspray oder ein (weiteres) Abwarten abstellt, ist dies nicht als aufklärungspflichtige Behandlungsalternative anzusehen. Der Sachverständige hat in seiner Anhörung vor dem Senat insoweit überzeugend ausgesagt, dass die Behandlung mit Nasenspray zwar eine alternative Behandlung darstelle, aber keine gleichwertige. Er hat dies nachvollziehbar damit begründet, dass man der beim Kläger durchgeführten Bildgebung mit hoher Wahrscheinlichkeit entnehmen könne, dass das Vorgehen im Sinne einer konservativen Nasenspray-Behandlung hier keinen Erfolg gebracht hätte. Dies liege nicht zuletzt daran, dass das Cortison eben nicht in der Tiefe wirke, wo beim Kläger die Probleme gelegen hätten. Hinzu komme, dass der Kläger initial Probleme mit den Ohren gehabt habe und das Nasenspray dort nicht wirken könne. Auf die Frage, ob es sich bei der Nasenspray-Behandlung um eine kausale oder lediglich eine symptombezogene Therapie handele, hat der Sachverständige erklärt, dass es keine evidenzbasierten Feststellungen gebe, dass die Nasenspray-Therapie überhaupt geeignet sei, zu einem Behandlungserfolg zu führen. Er würde sagen, es handele sich um ein tradiertes Vorgehen. Auch ein abwartendes Vorgehen stellte vorliegend keine Behandlungsalternative dar. Insoweit hat der Sachverständige überzeugend angegeben, dass dieses Vorgehen bereits in der Vergangenheit beim Kläger zu keiner Veränderung geführt habe. Ein solches Verhalten hätte nach Ansicht des Sachverständigen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu einer Verbesserung beigetragen. Auch insoweit folgt der Senat den Ausführungen des Sachverständigen Dr. B..
Soweit der Kläger rügt, er sei fehlerhaft über die Rangfolge der Operationsalternativen Nasen-OP und Ohren-OP aufgeklärt worden, greift auch diese Rüge nicht. Der Senat folgt insoweit den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen Dr. B.. Dieser hat überzeugend ausgeführt, dass das Vorgehen, die Sanierung der Nebenhöhlen zunächst ins Auge zu fassen, aus seiner Sicht eine gleichwertige Alternative zu dem Vorgehen, unmittelbar das Ohr anzugehen im Sinne einer Mastoidektomie eine gleichwertige Therapie darstellte. Auch er hätte in der konkreten Situation des Klägers dazu geraten, sich zunächst den Nasennebenhöhlen zuzuwenden, weil er keine Anzeichen für eine chronische Mastoiditis habe feststellen können. Man könne von einer 60 %/40 %-Entscheidung sprechen.
3.
Die Einwilligung des Klägers, die dieser am 1.11.2013 mit Unterzeichnung des Aufklärungsbogens erteilte, war jedoch unwirksam, weil der Kläger keinerlei Bedenkzeit zwischen Aufklärung über die Risiken des Eingriffs und der Entscheidung über die Einwilligung gemäß § 630e Abs. 2 Nr. 2 BGB hatte. Eine wohlüberlegte Entscheidung kann schon nach dem Wortlaut des § 630e Abs. 2 Nr. 2 BGB nur treffen, wer ausreichend Zeit zum Überlegen hat. Wenn ein Krankenhaus aus organisatorischen Gründen die Übung hat, den Patienten unmittelbar im Anschluss an die Aufklärung zur Unterschrift unter die Einwilligungserklärung zu bewegen, kann in einem solchen Fall nicht von einer wohl überlegten Entscheidung ausgegangen werden (Martis/Winkhart-Martis, MDR 2020, 1421, 1424; OLG Köln, Urteil vom 16. Januar 2019 – I-5 U 29/17 –, Rn. 21, juris). Sie wird vielmehr unter dem Eindruck einer großen Fülle von dem Patienten regelmäßig unbekannten und schwer verständlichen Informationen und in einer persönlich schwierigen Situation abgegeben (OLG Köln, a.a.O.).
So liegt der Fall hier. Unstreitig hat der Kläger unmittelbar nach dem Aufklärungsgespräch am 1.11.2013 über die teils erheblichen Risiken, die mit der Operation verbunden sind, auf Bitten der Zeugin A. die Einverständniserklärung betreffend die streitgegenständliche Operation unterschrieben und damit nicht lediglich einen Nachweis über das stattgehabte Aufklärungsgespräch unterzeichnet, sondern seine Einwilligungserklärung zum streitgegenständlichen Eingriff erteilt. Unbeachtlich ist insoweit, ob die Zeugin den Kläger zur Unterschrift gedrängt hat oder ob der Kläger bereits drei Tage zuvor mit dem Zeugen Prof. Dr. N. über den Eingriff gesprochen hatte. Letzteres ist bereits deshalb unbeachtlich, da Prof. Dr. N. unstreitig keine Risikoaufklärung durchgeführt hatte. Entscheidend ist vielmehr, dass dem Kläger die bereits nach dem Wortlaut des § 630e Abs. 2 Nr. 2 BGB vorgesehene (Wohl-) Überlegungszeit nicht eingeräumt wurde und die Einwilligung daher unwirksam war.
4.
Der Kläger hat auch nicht konkludent zu einem späteren Zeitpunkt erneut in die streitgegenständliche Operation eingewilligt. Der Umstand, dass der Kläger sich drei Tage nach dem Aufklärungsgespräch in die stationäre Aufnahme in der Klinik der Beklagten begeben hat, kann nicht als konkludente Einwilligungserklärung gewertet werden. Die Einwilligung kann ausdrücklich oder konkludent erklärt werden. Eine Form ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Aus Gründen der Nachweisbarkeit bietet sich – wie in der Praxis üblich – Schriftform an. Der Behandelnde hat die Einwilligung nach § 630f Abs. 2 Satz 1 BGB in der Patientenakte aufzuzeichnen (K. Schmidt in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 9. Aufl., § 630d BGB (Stand: 01.02.2020), Rn. 9; str.: a.A. OLG Hamm, Urteil vom 19. November 2018 – I-3 U 44/18 –, Rn. 35 juris). Eine Einwilligungserklärung hat der Kläger ausdrücklich am 1.11.2013 abgegeben, indem er das entsprechende Formular unterzeichnete. Es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass der Kläger diese Einwilligung widerrufen hat. Darüber hinaus ist weder vorgetragen noch davon auszugehen, dass die Beklagte als Erklärungsempfänger bei der stationären Aufnahme des Klägers davon ausging, dass der Kläger erst jetzt seine Einwilligung zur Operation erteilt. Etwas anderes könnte allenfalls dann gelten, wenn der Kläger bei der Aufnahme darauf hingewiesen worden wäre, dass seine vorausgehende schriftliche Einwilligung unwirksam war. Wenn der Kläger dann trotzdem die Aufnahme im Krankenhaus begehrt, könnte dies als (konkludente) Einwilligung gewertet werden (vgl. Karl Nußstein in VersR 2019, 1500 ff.). Dies war vorliegend jedoch nicht der Fall.
5.
Soweit sich die Beklagte auf eine hypothetische Einwilligung beruft, hat der Kläger diesen Einwand entkräftet. Der Einwand der hypothetischen Einwilligung, der um missbräuchlichem Vorbringen fehlerhafter Aufklärung zu begegnen grundsätzlich beachtlich ist, unterliegt strengen Anforderungen (Geiß/Greiner, Arzthaftpflichtrecht, 6. Auflage 2009, C IV. 137). Der Arzt muss darlegen und beweisen, dass der Patient bei rechtzeitiger ordnungsgemäßer Aufklärung in den identischen Eingriff eingewilligt hätte. Der Einwand der hypothetischen Einwilligung ist dem Arzt abgeschnitten, wenn sich der Patient bei ordentlicher Aufklärung in einem plausibel zu machenden Entscheidungskonflikt befunden hätte, insbesondere, wenn er ernsthaft vor der Frage der Erteilung einer Einwilligung gestanden hätte (BGH NJW 1994, 3009, 3011; NJW 2007, 217, 219; OLG Köln VersR 2009, 1119, 1120). Auf den Einwand der hypothetischen Einwilligung ist die Darstellung eines ernsthaften Entscheidungskonflikts plausibel, wenn die Patientin erklärt, sie hätte bei korrekter Aufklärung noch zugewartet, um sich in Ruhe über den Eingriff schlüssig zu werden, jedenfalls, wenn dieser nicht vital bzw. zwingend indiziert war (Martis/Winkhart-Martis, MDR 2020, 1421, 1426). Ein Entscheidungskonflikt ist auch dann plausibel, wenn die Patientin darauf hinweist, ihr Selbstbestimmungsrecht sei verkürzt worden, bei Einräumung einer Überlegungsfrist von jedenfalls mehreren Stunden hätte sie die Möglichkeit gehabt, mit einem ihr bekannten Arzt Rücksprache zu halten, sie hätte sich dann gegen die Operation entschieden (Martis/Winkhart-Martis, MDR 2020, 1421, 1424). Von diesen Grundsätzen ausgehend hat der Kläger plausibel einen Entscheidungskonflikt dargelegt. Es handelte sich vorliegend nicht um einen notfallmäßigen oder dringenden Eingriff. Der Vortrag des Klägers, bei ordnungsgemäßer Bedenkzeit hätte er Rücksprache mit seinem behandelnden HNO-Arzt gehalten und sich möglicherweise gegen die Operation entschieden, ist plausibel und reicht aus.
6.
Die Haftung der Beklagten entfällt auch nicht wegen fehlenden Verschuldens. Dabei kann dahinstehen, ob das Vorgehen der Beklagten einem bundesweiten Standard im Rahmen der Aufklärung entspricht. Sofern auch andere Kliniken unmittelbar nach dem Aufklärungsgespräch dem Patienten ein Einwilligungsformular zur Unterzeichnung vorlegen und ihm damit keine ausreichende Bedenkzeit zur wohlüberlegten Entscheidung über die Einwilligung gemäß § 630e Abs. 2 Nr. 2 BGB einräumen, kann dies die Beklagte nicht entlasten. Sofern der Kläger darauf verweist, dass der Sachverständige Dr. B. diese im Klinikalltag übliche Praxis nicht beanstandet habe, ergibt sich hieraus bereits deshalb nichts anderes, weil es sich insoweit um eine nicht vom Sachverständigen zu beurteilende Rechtsfrage handelt.
III.
Über die Kosten des Verfahrens ist im Schlussurteil zu entscheiden.
IV.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10 ZPO. Eine Sicherheitsleistung war mangels eines vollstreckungsfähigen Tenors der Entscheidung nicht zu bestimmen.
V.
Die Revision wird gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO im Hinblick auf die Frage einer ausreichenden Bedenkzeit zwischen Aufklärungsgespräch und Entscheidung über die Einwilligung gemäß § 630e Abs. 2 Nr. 2 BGB zugelassen.