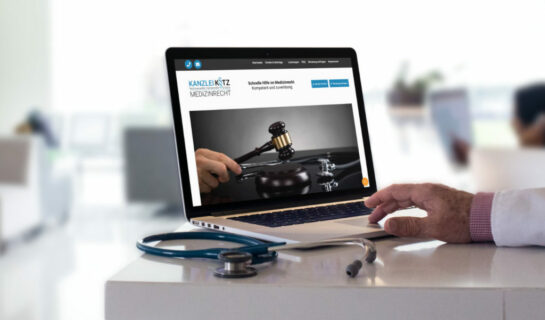Schockschaden-Grundsätze: Kein Schmerzensgeld bei psychischer Erkrankung durch Pflegefehler bei Angehörigen
Das Landgericht Dresden hat in seinem Urteil vom 07.11.2023, Az.: 4 U 1217/23, die Berufung der Klägerin abgewiesen. Die Klägerin konnte nicht nachweisen, dass die von ihr behaupteten Pflegefehler im Pflegeheim zu einer psychischen Erkrankung in Form einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) oder einer Anpassungsstörung mit depressiver Episode geführt haben. Das Gericht folgte der Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen, wonach die psychische Erkrankung der Klägerin nicht eindeutig auf die behaupteten Pflegefehler zurückgeführt werden kann.
Weiter zum vorliegenden Urteil Az.: 4 U 1217/23 >>>
✔ Das Wichtigste in Kürze
Die zentralen Punkte aus dem Urteil:
- Die Klägerin konnte nicht beweisen, dass die psychische Erkrankung durch die Pflegefehler verursacht wurde.
- Die Beweislast liegt bei der Klägerin, die diese nicht erfüllen konnte.
- Das Gericht stützt sich auf ein umfangreiches Sachverständigengutachten.
- Keine Revision gegen das Urteil zugelassen.
- Die psychische Erkrankung der Klägerin hat laut Gutachten keinen direkten Kausalzusammenhang mit den behaupteten Pflegefehlern.
- Die Klägerin hat frühere psychische Probleme, die eine Rolle spielen könnten.
- Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin.
- Das Gericht weist darauf hin, dass bei psychischen Schäden Mitursächlichkeit nicht ausreicht, wenn nicht klar ist, dass diese nur durch das behauptete Ereignis verursacht wurden.
Übersicht
- 1 Schockschaden-Grundsätze: Kein Schmerzensgeld bei psychischer Erkrankung durch Pflegefehler bei Angehörigen
- 2 ✔ Das Wichtigste in Kürze
- 3 ✔ FAQ: Wichtige Fragen kurz erklärt
- 4 Das vorliegende Urteil
Psychische Gesundheitsschäden: Haftungsansprüche und rechtliche Herausforderungen

Psychische Gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil unseres Wohlbefindens, doch leider sind psychische Störungen weit verbreitet. In Deutschland leiden Millionen von Menschen an psychischen Erkrankungen. Diese Erkrankungen können sowohl durch biologische als auch durch psychosoziale Faktoren verursacht werden. Auch äußere Einflüsse wie etwa ein Unfall oder eine schwere Erkrankung können psychische Probleme auslösen.
In jüngerer Zeit sind die rechtlichen Aspekte psychischer Gesundheitsschäden zunehmend in den Fokus gerückt. Insbesondere die Frage, ob und inwieweit Schädiger für psychische Gesundheitsschäden haftbar gemacht werden können, ist Gegenstand zahlreicher Gerichtsentscheidungen. In diesem Zusammenhang spielen die sogenannten Schockschaden-Grundsätze eine wichtige Rolle. Diese Grundsätze regeln die Haftung für psychische Gesundheitsverletzungen, die durch ein haftungsbegründendes Ereignis verursacht wurden.
Im Zentrum eines aufsehenerregenden Rechtsstreits stand eine Klage vor dem Landgericht Dresden, Az.: 4 U 1217/23, bei der es um die Folgen einer vermeintlich mangelhaften Pflege und deren psychische Auswirkungen auf Angehörige ging. Die Klägerin, Tochter einer verstorbenen Patientin, machte geltend, aufgrund der fehlerhaften Pflege ihrer Mutter, die zu deren Leiden und schließlichem Tod führte, selbst psychische Schäden erlitten zu haben. Sie forderte Schmerzensgeld und Schadensersatz für die erlebten Traumata und die daraus resultierende psychische Erkrankung.
Der Weg zur Klage: Ein dramatischer Pflegefall
Die Patientin, Mutter der Klägerin, litt nach einem Hirninfarkt unter schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen, darunter ein Locked-in-Syndrom und diverse andere schwerwiegende physische Beeinträchtigungen. Im Pflegeheim, das von den Beklagten betrieben wurde, verschlechterte sich ihr Zustand weiter, was unter anderem zu Krankenhausaufenthalten wegen Aspirationsverdachts und Darmentzündungen führte. Letztlich verstarb die Patientin, und eine Obduktion wies schwere Lungenentzündung als Todesursache aus. Die Klägerin, überzeugt davon, dass die unzureichende Pflege für das Leiden ihrer Mutter verantwortlich war, erstattete Strafanzeige und verlangte juristische Aufarbeitung.
Rechtliche Bewertung psychischer Schäden bei Angehörigen
Die rechtliche Auseinandersetzung drehte sich insbesondere um die Frage, inwiefern psychische Schäden, die Angehörige durch das Miterleben von Leid und Tod naher Familienmitglieder erfahren, entschädigungsfähig sind. Hierbei griff das Gericht auf die Rechtsprechung zu Schockschäden zurück, nach der psychische Störungen durchaus als Gesundheitsverletzungen angesehen werden können, sofern sie Krankheitswert besitzen. Die Herausforderung bestand jedoch im Nachweis der direkten Kausalität zwischen den behaupteten Pflegefehlern und der psychischen Erkrankung der Klägerin.
Das Gutachten entscheidet
Ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt des Verfahrens war das eingeholte psychiatrische Sachverständigengutachten. Dieses konnte keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen den Pflegefehlern und der psychischen Erkrankung der Klägerin feststellen. Während der Gutachter eine Anpassungsstörung und depressive Episoden bei der Klägerin diagnostizierte, ließ sich nicht sicher feststellen, dass diese direkt durch die Pflegemängel verursacht wurden. Vielmehr wurden alternative Ursachen wie vorherige traumatische Erfahrungen der Klägerin und der plötzliche Pflegefall der Mutter als mögliche Auslöser der psychischen Leiden identifiziert.
Urteil und seine Begründung
Das Landgericht Dresden folgte der Einschätzung des Sachverständigen und wies die Berufung der Klägerin ab. Es betonte, dass für eine Haftung der Beklagten der Nachweis erforderlich sei, dass die psychischen Beeinträchtigungen der Klägerin unmittelbar auf die beklagte Pflege zurückzuführen seien. Da dieser Nachweis nicht erbracht werden konnte und alternative Ursachen für die psychische Erkrankung der Klägerin plausibel waren, sah das Gericht keine Grundlage für eine Verurteilung der Beklagten zu Schmerzensgeld und Schadensersatz.
Fazit
Das Urteil des Landgerichts Dresden unterstreicht die Schwierigkeiten, die mit dem Nachweis psychischer Schäden in juristischen Auseinandersetzungen verbunden sind, insbesondere wenn es um die indirekten Auswirkungen auf Angehörige geht. Die Entscheidung verdeutlicht zudem, wie entscheidend sachverständige Gutachten in solchen Fällen sind.
✔ FAQ: Wichtige Fragen kurz erklärt
Was versteht man unter dem Schadenersatzanspruch gemäß § 823 Abs. 1 BGB?
Unter dem Schadenersatzanspruch gemäß § 823 Abs. 1 BGB versteht man die gesetzliche Verpflichtung einer Person, den Schaden zu ersetzen, der durch eine von ihr vorsätzlich oder fahrlässig begangene unerlaubte Handlung entstanden ist. Diese Handlung muss das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt haben.
Die Voraussetzungen für einen Schadenersatzanspruch nach § 823 Abs. 1 BGB sind:
- Eine Rechtsgutsverletzung, die Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder ein sonstiges Recht betrifft.
- Eine Verletzungshandlung, also ein Tun oder Unterlassen, das zu der Rechtsgutsverletzung geführt hat.
- Haftungsbegründende Kausalität zwischen der Handlung und der Rechtsgutsverletzung.
- Rechtswidrigkeit der Handlung, die nicht durch Rechtfertigungsgründe ausgeschlossen ist.
- Verschulden des Schädigers, entweder in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit.
Die Rechtsfolge eines solchen Anspruchs ist der Schadenersatz, der nach den §§ 249 ff. BGB zu bemessen ist. Dabei geht es primär um die Naturalrestitution, also die Wiederherstellung des Zustandes, der ohne das schädigende Ereignis bestehen würde. Ist dies nicht möglich oder unverhältnismäßig, kann der Schadenersatz auch in Form einer Geldleistung erfolgen.
Ein Schaden im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB ist jede unfreiwillige Einbuße an materiellen oder immateriellen Gütern. Der Schädiger hat den Zustand wiederherzustellen, der ohne das schädigende Ereignis bestehen würde. Ist dies nicht möglich oder unverhältnismäßig, kann der Geschädigte eine Geldentschädigung verlangen.
Bei der Bestimmung des Schadens und des Umfangs des Schadenersatzes sind auch mögliche Mitverschuldensanteile des Geschädigten nach § 254 BGB zu berücksichtigen. Der Anspruch unterliegt der Verjährung, die sich nach §§ 195, 199 BGB bemisst und in der Regel drei Jahre beträgt.
Wie wird eine psychische Störung rechtlich als Gesundheitsverletzung bewertet?
Psychische Störungen können rechtlich als Gesundheitsverletzungen bewertet werden, allerdings sind bestimmte Kriterien zu erfüllen. Nach § 823 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) gelten psychische Beeinträchtigungen nur dann als Gesundheitsverletzung, wenn sie pathologisch fassbar sind, also einen Krankheitswert haben, und über die gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinausgehen, denen Betroffene beim Tod oder einer schweren Verletzung eines nahen Angehörigen in der Regel ausgesetzt sind.
Eine psychische Störung, die auf einer vorangegangenen Körper- oder Gesundheitsverletzung beruht, kann dem Schädiger als weitere Schadensfolge zuzurechnen sein. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Schadensersatzpflicht durch den Schutzzweck der verletzten Norm begrenzt wird. Eine Schadensersatzpflicht besteht nur, wenn die Tatfolgen, für die Ersatz begehrt wird, aus dem Bereich der Gefahren stammen, zu deren Abwendung die verletzte Norm erlassen worden ist.
Grundsätzlich kann ein Anspruch auf Schmerzensgeld auch bei psychischen Beeinträchtigungen bestehen. Die Höhe des Schmerzensgeldes bei psychischen Schäden bemisst sich stets am Einzelfall und ist von der Schwere der Störung sowie sämtlichen Umständen abhängig.
Im Strafrecht kann eine psychische Störung auch zur Schuldunfähigkeit führen, wenn sie dazu führt, dass der Täter das Unrecht der Tat nicht einsehen oder nach dieser Einsicht handeln kann.
Insgesamt ist die rechtliche Bewertung von psychischen Störungen als Gesundheitsverletzungen ein komplexes Thema, das von vielen Faktoren abhängt, einschließlich der spezifischen Umstände des Einzelfalls und der Art und Schwere der psychischen Störung.
Was sind die rechtlichen Herausforderungen beim Nachweis von Schockschäden?
Die rechtlichen Herausforderungen beim Nachweis von Schockschäden liegen vor allem in der Notwendigkeit, bestimmte Kriterien zu erfüllen, um eine Haftung zu begründen. Schockschäden sind psychische Beeinträchtigungen, die eine Person infolge der Verletzung oder des Todes eines nahen Angehörigen erleidet. Diese psychischen Beeinträchtigungen müssen von Krankheitswert sein, um als Gesundheitsverletzung im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB anerkannt zu werden.
Zurechenbarkeit und Krankheitswert
Ein zentrales Problem bei Schockschäden ist die Zurechenbarkeit. Schockschäden sind nur dann zurechenbar, wenn sie bei Angehörigen entstehen, um eine Umgehung der §§ 844, 845 BGB zu vermeiden. Die psychische Beeinträchtigung muss pathologisch fassbar sein, also einen Krankheitswert haben. Dies bedeutet, dass die Beeinträchtigung über normale Reaktionen wie Trauer oder Niedergeschlagenheit hinausgehen muss.
Rechtsprechungsänderung und Gleichbehandlung
Eine Herausforderung besteht auch in der Anpassung der Rechtsprechung. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat seine Rechtsprechung zu Schockschäden geändert, um die Gleichbehandlung von physischen und psychischen Beeinträchtigungen zu gewährleisten. Diese Änderung erkennt an, dass psychische Störungen von Krankheitswert eine Gesundheitsverletzung darstellen können, auch wenn sie beim Geschädigten mittelbar durch die Verletzung eines Rechtsguts bei einem Dritten entstehen.
Beweisführung und Schmerzensgeld
Eine weitere Herausforderung ist die Beweisführung. Der Geschädigte muss nachweisen, dass die psychische Beeinträchtigung einen Krankheitswert hat und durch die Verletzung oder den Tod eines nahen Angehörigen verursacht wurde. Dies kann insbesondere dann schwierig sein, wenn die psychische Beeinträchtigung auf eine psychische Prädisposition des Geschädigten zurückzuführen ist. Zudem muss bei der Bemessung des Schmerzensgelds berücksichtigt werden, ob und inwieweit eine solche Prädisposition vorlag.
Die rechtlichen Herausforderungen beim Nachweis von Schockschäden umfassen die Notwendigkeit, die Zurechenbarkeit und den Krankheitswert der psychischen Beeinträchtigung zu beweisen, die Anpassung an geänderte Rechtsprechung zur Gleichbehandlung von physischen und psychischen Beeinträchtigungen sowie die Beweisführung und die Berücksichtigung von psychischen Prädispositionen bei der Bemessung des Schmerzensgelds.
Das vorliegende Urteil
LG Dresden – Az.: 4 U 1217/23 – Urteil vom 07.11.2023
I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Zwickau vom 17.05.2023 – Az. 1 O 172/20 – wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.
II. Das Urteil sowie das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.
Beschluss: Der Streitwert wird auf 43.657,11 € festgesetzt.
Gründe
I.
Die Klägerin ist Tochter der verstorbenen G…… M…… (im Folgenden: Patientin). Die Patientin befand sich im Zeitraum vom 31.08.2016 bis zu ihrem Tod am 07.01.2017 in vollstationärer Pflege des Pflegeheims K…… Domizil. Die Beklagte zu 1) ist Trägerin des von der Beklagten zu 2) geleiteten Heims. Mit der Behauptung, sie habe ab September 2016 eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und eine depressive Störung erlitten infolge einer den Beklagten anzulastenden grob fehlerhaften Pflege der Patientin, begehrt die Klägerin Zahlung von Schmerzensgeld, Schadensersatz in Form von Verdienstausfall, Rentenkürzungsschaden, Reisekosten, Kosten für Zuzahlungen zur Heilbehandlung und weiterer Kosten für Porto und Telefon sowie Kosten zur Ermittlung ihres Verdienstausfallschadens.
Die Patientin erlitt am 06.05.2016 einen Hirninfarkt und wurde bis zu ihrer Aufnahme im Pflegeheim der Beklagten zu 1) in verschiedenen Kliniken behandelt. In Folge des Infarktgeschehens litt die Patientin an einem sog. Locked-in-Syndrom, u. a. mit Tetraparese, faszialer Parese rechts, Dysphagie mit Zustand nach PEG Anlage (Magensonde) bei Schluckstörung, Harn- und Stuhlinkontinenz, intermittierendem Vorhofflimmern, arterieller Hypertonie, chronischer Hepatitis B sowie an präpylorischer Antrumgastritis mit Zustand nach frischer Ulcusnarbe.
Nach Aufnahme im Pflegeheim der Beklagten zu 1) wurde die Patientin am 02.09.2016 mit dem Verdacht auf Aspiration verlegt und stationär vom 02. bis 12.09.2016 im Krankenhaus behandelt. Zudem wurden dort Dekubitalulcera am Gesäß und dem rechten Unterschenkel dokumentiert. Ein erneuter Krankenhausaufenthalt wegen einer Darmentzündung erfolgte vom 16. bis 20.09.2016.
Die Patientin verstarb am 07.01.2027. Eine am 11.01.2017 durchgeführte Obduktion ergab beginnende Dekubitalulcera 1. – 2. Grades im Bereich beider Fersen und der Oberschenkelrückseite. Als Todesursache wurde eine schwere Lungenentzündung festgestellt.
Die Klägerin erstattete am 10.08.2017 Strafanzeige wegen unzureichender Pflege der Patientin. Im Rahmen des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens wurden zumindest Teile der Pflegedokumentation beschlagnahmt und nach Abschluss des Verfahrens, das gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt wurde, an das Pflegeheim zurückgesandt.
Die Klägerin hat in einem weiteren Prozess u. a. die Klinik, in der die Patientin vom 06. bis 07.05.2016 stationär behandelt wurde, wegen behaupteter Behandlungsfehler aus originär eigenem Recht auf Zahlung von Schmerzensgeld und Schadensersatz in Anspruch genommen. Diese sei für den schwerst pflegebedürftigen Zustand der Patientin verantwortlich und hätte damit eine Erkrankung der Klägerin in Form von wiederkehrenden depressiven Störungen ausgelöst. Die Berufung gegen die vom Landgericht Zwickau abgewiesenen Klage hat der Senat mit Beschluss vom 12.10.2023 nach § 522 ZPO zurückgewiesen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachvortrags wird auf den Tatbestand der angefochtenen Entscheidung ergänzend Bezug genommen.
Nach Verweisung des Rechtsstreits an das örtlich zuständige Gericht hat das Landgericht im vorliegenden Verfahren ein schriftliches psychiatrisches Sachverständigengutachten eingeholt. Die Beiziehung der Pflegedokumentation blieb erfolglos, da diese unauffindbar war. Nach mündlicher Erläuterung des Gutachtens durch den Sachverständigen im Verhandlungstermin am 17.05.2023 hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, im Ergebnis der sachverständigen Begutachtung habe die Klägerin eine im Zusammenhang mit einer – zu ihren Gunsten unterstellten – mangelhaften Pflege der Patientin stehende psychische Erkrankung in Form einer PTBS oder einer Anpassungsstörung mit anschließender mittelgradiger depressiver Episode nicht mit hinreichender Sicherheit nachgewiesen.
Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung, zu deren Begründung sie unter Wiederholung ihres erstinstanzlichen Vorbringens die Auffassung vertritt, das Landgericht sei aufgrund unzureichender Beweiserhebung und falscher Beweiswürdigung zu dem Ergebnis gekommen, dass das streitgegenständliche Pflegegeschehen nicht in einem kausalen Zusammenhang mit der psychischen Erkrankung der Klägerin stehe. Es habe sich nur unzureichend mit den von der Klägerin eingereichten ärztlichen Attesten und Stellungnahmen auseinandergesetzt und nicht berücksichtigt, dass die depressiven Beeinträchtigungen der Klägerin reaktive Depressionen seien, vorliegend ausgelöst durch die behaupteten Pflegefehler. Das Landgericht habe Beweisanträge der Klägerin zum Vorliegen eines Dekubitus 2. Grades, zu der falschen Lagerung und den von der Klägerin vorgetragenen Abhilfebemühungen hinsichtlich der von ihr festgestellten Pflegefehler, übergangen.
Sie beantragt zuletzt, unter Abänderung des am 17.05.2023 verkündeten Urteils des Landgerichts Zwickau, Az 1 O 172/20, die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin
1. ein angemessenes Schmerzensgeld nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.
2. 25,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5-Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.
3. 19.366,47 € nebst Zinsen in Höhe von 5-Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.
Die Beklagten beantragen, die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen die angefochtene Entscheidung.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, die Behandlungsunterlagen, das Gutachten des Sachverständigen und die Ermittlungsakten ergänzend Bezug genommen.
II.
Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. Die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB auf Schmerzensgeld und Schadensersatz wegen einer bei ihr originär infolge des Aufenthalts der Patientin im Pflegeheim aufgetretenen psychischen Erkrankung sind nicht begründet. Zu Recht hat das Landgericht eine Haftung der Beklagten verneint, da die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass das Mitansehenmüssen des durch – als zutreffend unterstellt – schwere Pflegefehler verursachten Leidens der Mutter bei ihr selbst zu einer psychischen Erkrankung geführt habe.
1.
Bei dem klägerischen Vorbringen handelt es sich um die Behauptung einer bei ihr eingetretenen psychischen Gesundheitsverletzung, die nach der Rechtsprechung zu den sog. „Schockschäden“ einen Schadenersatzanspruch gem. § 823 Abs. 1 BGB begründen kann. Danach stellt eine psychische Störung eine Gesundheitsverletzung im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB dar, auch wenn sie beim Geschädigten nur mittelbar durch die Verletzung eines Rechtsgutes bei einem Dritten verursacht wurde. Eine Haftung für psychische Beeinträchtigungen, die – wie hier – als Primärschaden geltend gemacht werden, kommt jedoch nur in Betracht, wenn die Beeinträchtigung selbst Krankheitswert besitzt; insoweit gilt das strenge Beweismaß des § 286 ZPO. Dagegen ist nicht erforderlich, dass die Störung über die gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinausgeht, denen Betroffene bei der Verletzung eines Rechtsgutes eines nahen Angehörigen in der Regel ausgesetzt sind (vgl. BGH, Urteil vom 06.12.2022 – VI ZR 168/21 –, BGHZ 235, 239 – 254; Ebert in: Erman BGB, Kommentar, 17. Aufl. 2023, Vorbemerkung vor § 249, Rn. 51, jeweils m.w.N.). Die zum „Schockschaden“ entwickelten Grundsätze sind auch in dem Fall anzuwenden, in dem das haftungsbegründende Ereignis kein Unfallereignis im eigentlichen Sinne, sondern eine fehlerhafte ärztliche Behandlung ist (BGH, Urteil vom 21.05.2019 – VI ZR 299/17 –, BGHZ 222, 125 – 133). Auch das Merkmal der Plötzlichkeit muss nicht zwingend erfüllt sein (vgl. BGH, a.a.O.). Um einer uferlosen Haftung des Schädigers zu begegnen, ist allerdings die Kausalität einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Danach muss mit dem strengen Beweismaßstab des § 286 ZPO feststehen, dass eine als pathologisch einzustufende, psychische Gesundheitsbeeinträchtigung gerade aufgrund des haftungsbegründenden Ereignisses eingetreten ist. Denkbare und mögliche Alternativursachen stehen der Feststellung des notwendigen mittelbaren Kausalzusammenhangs damit regelmäßig entgegen (vgl. BGH, a.a.O. – juris, Rn. 24, mit Anm. Hans-Joseph Scholten, ZfSch 2023, 136 – 142). Beweiserleichterungen, die bei schweren Behandlungsfehlern eingreifen können, sind zu Gunsten des nur mittelbar Geschädigten nicht anwendbar.
2.
Nach diesen Grundsätzen ist der Klägerin der ihr obliegende Beweis nicht gelungen, dass bei ihr eine als pathologisch anzusehende psychische Gesundheitsbeeinträchtigung im Zusammenhang mit dem Aufenthalt der Patientin im Pflegeheim der Beklagten zu 1) eingetreten ist.
a)
Zwar kann ein haftungsbegründendes Ereignis dem Grunde nach nicht nur aus einer ärztlichen Behandlung, sondern wegen des bestehenden Sachzusammenhangs auch aus dem Bereich der Pflege einer schwerstkranken Patientin in einem Pflegeheim hergeleitet werden. Es ist kein Grund erkennbar, denjenigen, der eine psychische Gesundheitsverletzung infolge einer durch eine fehlerhafte Pflege bedingten Schädigung eines Angehörigen erleidet, anders zu behandeln als denjenigen, bei dem eine Gesundheitsverletzung eintritt infolge einer auf einem behandlungsfehlerhaften ärztlichen Vorgehen beruhenden Schädigung des Angehörigen. Es kann auch nicht darauf ankommen, ob sich der Angehörige in einem bereits angegriffenen Gesundheitszustand befand, der durch einen ärztlichen Behandlungsfehler keine weitere wesentliche Verschlechterung erfahren hat, da auch dies noch vom Schutzzweck der Norm erfasst wird und eine Begrenzung des Haftungsbereichs über den Kausalzusammenhang erfolgen kann (vgl. BGH, a.a.O., mit Anm. Katzenmeier/Jansen, MedR 2020, 37 – 40; Oberlandesgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Urteil vom 22.08.2013 – 1 U 118/11 –, Rn. 26, juris). Im vorliegenden Fall spricht allerdings gegen die Annahme eines „Schockschadens“, dass die Klägerin das auch nach ihrem eigenen Vortrag qualitativ wechselnde Pflegegeschehen mit stetiger Zustandsverschlechterung der Patientin monatelang begleitet und intensiv auf das pflegerische Personal der Beklagten eingewirkt hat. Zwar kann auch durch das Miterleben des als grob unzulänglich empfundenen Pflegegeschehens eine seelische Erschütterung im Sinne eines „Schockschadens“ bewirkt werden; die vorliegende Fallgestaltung unterscheidet sich jedoch damit grundlegend von den üblicherweise der Annahme eines Schockschadens zugrundeliegenden Sachverhalten durch das Miterleben eines schwerwiegenden (Unfall-)geschehens betreffend einen nahen Angehörigen bzw. dem Anblick eines solchen oder der Nachricht hiervon.
b)
Letztlich kann dies aber ebenso offenbleiben wie die Frage, ob das Landgericht das Ausmaß der – als gegeben unterstellten – groben Pflegefehler zutreffend gewürdigt hat. Eine Beweisaufnahme hierzu war somit entgegen der Ansicht der Berufung nicht veranlasst.
aa)
Denn das Landgericht hat sich aufgrund psychiatrischen Begutachtung nicht davon überzeugt gesehen, dass die Klägerin durch das Miterleben von – unterstellt – schweren Pflegefehlern eine PTBS erlitten hat. Diese Würdigung der sachverständigen Ausführungen des psychiatrischen Gutachters Prof. Dr. S…… und der psychologischen Sachverständigen Dr. S…. in den Gutachten vom 13.12.2021 ist nicht zu beanstanden und wird von Berufungsbegründung auch nicht hinreichend konkret in Zweifel gezogen. Dem psychiatrischen Gutachter zufolge erfordert der Nachweis einer PTBS, die nach dem erstinstanzlichen Vortrag der Klägerin als Folge der behaupteten Pflegefehler aufgetreten sein soll, den Nachweis von Kernsymptomen, insbesondere der sog. A-Kriterien (vgl. Gutachten S. 23/24), die vorliegend nicht erfüllt seien. Entgegen der Ansicht der Klägerin ergibt sich auch aus dem klinisch-psychologischen Zusatzgutachten der Sachverständigen Dr. S…. nicht, dass die Klägerin eine PTBS erlitten hat. Vielmehr stellt auch die Gutachterin fest, dass sich das Vollbild der Symptomatik nicht gezeigt habe. Auch soweit die Sachverständige einige Besonderheiten festgestellt hat, wie sie im Rahmen einer PTBS zu finden seien, steht dies nicht im Widerspruch zu den Feststellungen des Sachverständigen Prof, Dr. S……, der ebenfalls einige der aufgeführten Kriterien – allerdings nicht die für die Annahme einer PTBS zu fordernden Kernkriterien – als gegeben angesehen hat.
bb)
Der Sachverständige Prof. Dr. S…… hat demgegenüber bestätigt, dass die Klägerin im haftungsrelevanten Zeitraum an einer psychischen Störung mit Krankheitswert in Form einer Anpassungsstörung bzw. einer reaktiven depressiven Störung gelitten hat. Danach habe im Zeitraum vom September bis Februar 2017 eine initiale Anpassungsstörung, ab März bis Dezember 2017 eine mittelgradig depressive Episode und ab Januar 2018 eine leichte depressive Episode mit Response/Vollremission bestanden. Entgegen der Ansicht der Beklagten steht dem nicht entgegen, dass die Feststellungen letztlich auf der subjektiven Beschwerdeschilderung der Klägerin beruhen, da der Sachverständige zu diesem Ergebnis auch unter Auswertung der vorliegenden umfangreichen (Vor- und Nach-)Behandlungsunterlagen der Klägerin gelangt ist und konkrete Anhaltspunkte, die dies in Zweifel ziehen, weder von der Klägerin noch von den Beklagten aufgezeigt werden.
cc)
Unter Zugrundlegung der oben ausgeführten Grundsätze ist aber die Feststellung des Landgerichts nicht zu beanstanden, die Klägerin habe nicht nach § 286 ZPO hinreichend sicher bewiesen, dass ihre psychische Gesundheitsbeeinträchtigung in einem kausalen Zusammenhang mit der streitgegenständlichen Pflege ihrer Mutter steht. Der Sachverständige hat vielmehr überzeugend ausgeführt, dass sich die Anpassungsstörung initial bereits mit der Hirnblutung am 06./07.05.2016 eingestellt habe und ab diesem Zeitpunkt eine schlüssige kausale Kette bis hin zu der später diagnostizierten mittelgradigen Depression in Gang gesetzt worden sei. Dagegen ließe sich nicht ermitteln, ob die von der Klägerin gerügten Pflegefehler für ihre Gesundheitsbeeinträchtigung ursächlich gewesen seien oder nicht. Hinzu komme, dass bei der Klägerin eine familiäre und auch eine individuelle Vorgeschichte bekannt sei, die von massiver häuslicher Gewalt im Zeitraum von 2008 – 2012, beruflichen Problemen mit Mobbing, und innerfamiliären Problemen mit ihrem Kind geprägt gewesen seien, mit der Folge, dass die Klägerin sich ab 2008 fortlaufend bis zumindest 2013 in psychologischer Behandlung befunden habe. Als weiterer Schicksalsschlag sei im Mai 2016 die Erkrankung der Mutter dazugekommen, die plötzlich und unerwartet zu einem Vollpflegefall geworden sei, was zu weiteren Konflikten mit ihrem Bruder geführt habe. Diese Umstände seien geeignet, um die Erkrankung der Klägerin zu erklären. Es sei daher nicht seriös festzustellen, ob die Pflegesituation eine selbständige oder mitwirkende Ursache für die mittelgradige Depression gewesen sei, es bestehe auch keine dahingehende Wahrscheinlichkeit für einen Ursachenzusammenhang, vielmehr sei eine solche Annahme rein spekulativ. Aufgrund der beschriebenen Gemengelage hat sich der Sachverständige somit außerstande gesehen zu beurteilen, ob und in welchem Ausmaß das Erleben des Pflegegeschehens eine Teilursache für die bei der Klägerin aufgetretene psychische Gesundheitsschädigung gesetzt habe. Zwar genügt bei psychisch vermittelten Schäden auch Mitursächlichkeit, um dem Schädiger den gesamten Schaden zuzurechnen, wenn nicht feststeht, dass sie nur zu einem abgrenzbaren Teil des Schadens geführt hat. Hiervon ausgenommen ist der Fall der Teilkausalität, bei dem das ärztliche Versagen und ein weiterer, der Behandlerseite nicht zuzurechnender Umstand abgrenzbar zu einem Schaden geführt haben (BGH, Urteil vom 01.10.1996, VI ZR 10/96, – juris; Senat, Urteil vom 20.07.2021, Az 4 U 2901/19 -, Rn. 56, – juris). Dem Sachverständigen zufolge ist aber bereits nicht nachgewiesen, dass die Verarbeitung der Pflegesituation überhaupt einen Beitrag zur Gesundheitsschädigung geleistet hat. Aus der Krankheitsvorgeschichte der Klägerin sei bekannt, dass es sich um rezidivierende depressive Episoden handele, d. h. um Depressionen, die jederzeit auch ohne einen konkreten schweren Anlass auftreten könnten.
Der hierauf bezogene Vorhalt der Berufung, der Sachverständige sei bei seiner Einschätzung und Beurteilung unzutreffend von einer endogenen Depression ausgegangen, wobei es sich überdies um einen veralteten Begriff handele, obwohl bei der Klägerin tatsächlich eine reaktive Depression aufgetreten sei, deren einzelnen Episoden jeweils kausal auf ein bestimmtes Ereignis zurückgeführt werden könnte, wird dagegen durch keine konkreten Anhaltspunkte belegt. Der Sachverständige hat vielmehr auf die beigezogenen Krankenunterlagen der Vor- und Nachbehandler verwiesen. Danach seien die behandelnden Ärzte über einen sehr langen Zeitraum hinweg jeweils von rezidivierenden Depressionen ausgegangen, die diese auch als endogene Depressionen kodiert hätten. Der Vorhalt der Klägerin, der Sachverständige habe selbst den veralteten Begriff einer „endogenen“ Depression verwendet, trifft dagegen nicht zu und ist schon aus diesem Grund nicht geeignet, die Qualifikation des Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. Der von ihr herangezogene Passus aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht belegt vielmehr, dass der Sachverständige insoweit lediglich aus Behandlungsunterlagen von Vorbehandlern zitiert hat. Der Sachverständige hat zwar auch darauf hingewiesen, dass bei der Klägerin teilweise auch reaktive Depressionen vorgelegen hätten, denen jeweils konkrete Ereignisse zugrunde gelegen hätten. Allerdings sei im Abschlussbericht der Uexküll Klinik vom 15.01.2013 noch einmal ausdrücklich eine rezidivierende depressive Störung als gegenwärtig mittelgradige Episode beschrieben. Hierzu passe auch, dass durch die Ärzte der nachbehandelnden F…… Klinik vom 16.03.2018 (K21) eine identische Diagnose „rezidivierende depressive Störungen“ gestellt worden sei. Diese Diagnose ziehe sich mithin wie ein roter Faden durch den Krankheitsverlauf der Klägerin. Schließlich könne auch nicht festgestellt werden, dass das subjektive Empfinden der Klägerin hinsichtlich der Pflegesituation zumindest zu einer Verstärkung oder einer schwerergradigen Einschätzung der mittelgradigen Depression geführt habe. Selbst bei einer Berücksichtigung der von ihr beschriebenen schweren Schuldgefühle seien diese zumindest nicht eigenständig deutlich zu machen bzw. würden sich nicht eigenständig im Krankheitsbild widerspiegeln.
Ohne Erfolg bleibt auch der Einwand der Klägerin, bei ihr habe es grundsätzlich keine Depression ohne konkreten Anlass gegeben, so dass aus diesem Grund die bei ihr 2016/2017 aufgetretene Depression auf das Pflegegeschehen zurückzuführen sei. Der Sachverständige hat für die von ihm festgestellte psychische Gesundheitsbeeinträchtigung – insoweit übereinstimmend mit der Klägerin – als konkreten Anlass die im Mai aufgetretene Erkrankung der Mutter angenommen, konnte diese aber angesichts der beschriebenen Gemengelage und der Vordiagnosen gerade nicht auf das streitgegenständliche Pflegegeschehen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zurückführen.
3.
Daher sei – so das Landgericht mit überzeugenden Erwägungen – ein Zurechnungszusammenhang zwischen dem Auftreten der Anpassungsstörung und den geltend gemachten Pflegefehlern frühestens im September 2016 nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachgewiesen. Dieser Würdigung schließt sich der Senat an. Konkrete Anhaltspunkte, die begründete Zweifel an der sachverständigen Einschätzung und den darauf beruhenden Feststellungen des Landgerichts rechtfertigen können, werden von der Klägerin nicht aufgezeigt.
Die bloße Behauptung einer fehlerhaften Beweiswürdigung entgegen den erstinstanzlichen Feststellungen auf der Grundlage eines nachvollziehbaren und gut begründeten Sachverständigengutachtens genügt nicht (vgl. Senat, Beschluss vom 11.12.2020 – 4 U 1885/20 – juris; vgl. Senat, Beschluss vom 07.08.2020 – 4 U 1285/20 – juris). Zwar ist eine Partei grundsätzlich nicht verpflichtet, bereits in erster Instanz ihre Einwendungen gegen ein Gerichtsgutachten auf die Beifügung eines Privatgutachtens oder auf sachverständigen Rat zu stützen oder selbst oder durch Dritte in medizinischen Bibliotheken Recherchen anzustellen, um Einwendungen gegen ein medizinisches Sachverständigengutachten zu formulieren (vgl. Senat, Beschluss vom 11.12.2020 – 4 U 1885/20 – juris). Anders ist es hingegen in der Berufungsinstanz. Würde man auch hier einem Patienten gestatten, ohne nähere Angaben seine eigene Meinung zu medizinischen Kausalzusammenhängen derjenigen eines gerichtlichen Sachverständigen entgegenzustellen, liefe dies auf eine Umgehung der in § 529 ZPO geregelten grundsätzlichen Bindungen an das erstinstanzliche Ergebnis einer Beweisaufnahme hinaus (so Senat, a.a.O.; vgl. Senat, Beschluss vom 07.08.2020 – 4 U 1285/20 – juris). Weil der Patient regelmäßig über keine medizinische Sachkunde verfügt, kann er konkrete Anhaltspunkte, die in medizinischer Hinsicht Zweifel an der erstinstanzlichen Beweiswürdigung wecken sollen, nur dadurch vortragen, dass er ein Privatgutachten vorlegt, zumindest aber selbst auf medizinische Fundstellen oder Leitlinien zurückgreift, die für seine Behauptung streiten (vgl. Senat, a.a.O.). Entspricht der Vortrag diesen Anforderungen nicht und fehlt es auch im Übrigen an Anhaltspunkten dafür, dass das Gutachten in sich widersprüchlich oder der Sachverständige erkennbar nicht sachkundig ist, kommt eine Wiederholung der Beweisaufnahme nicht in Betracht (vgl. Senat, Beschluss vom 11.12.2020 – 4 U 1885/20; Senat, Beschluss vom 07.08.2020 – 4 U 1285/20 – juris). Im vorliegenden Fall hat die Klägerin sich im Wesentlichen auf eine Wiederholung ihrer erstinstanzlichen medizinischen Behauptungen beschränkt. Ihrem Vortrag lassen sich auch keine zureichenden Anhaltspunkte für Widersprüchlichkeiten oder Lücken des Sachverständigengutachtens entnehmen. Dies genügt nicht, um die sachverständigen Feststellungen überzeugend in Zweifel zu ziehen.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Festsetzung des Streitwertes folgt aus § 3 ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.