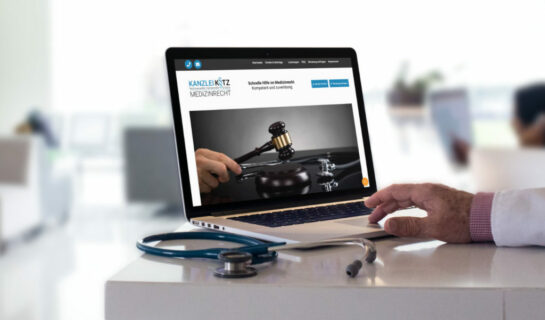Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- OLG Dresden: Kein Schadensersatz für Hundehalterin nach Bein-OP – Berufung gegen Tierarzt wegen Behandlungsfehler abgewiesen
- Ausgangslage: Streit um Tierarztfehler nach Hundeoperation und Schadensersatzklage
- OLG Dresden bestätigt: Berufung der Hundehalterin offensichtlich ohne Erfolgsaussicht (§ 522 ZPO)
- Kernpunkt Beweislast: Gutachten entlastet Tierärzte von Behandlungsfehlervorwurf nach Operation
- Berufungsangriffe unzureichend: Keine Zweifel am Gutachten begründet nach § 529 ZPO
- Weitere Vorwürfe zurückgewiesen: Postoperative Versorgung und angebliche Fehler-Eingeständnisse ohne rechtliche Relevanz
- Aufklärungspflicht des Tierarztes: Kein Schadensersatz wegen fehlender Alternativ-Info zur Operation
- Fazit und Empfehlung: Kostenrisiko bei Festhalten an der Berufung gegen Tierarztentscheidung
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Welche Rechte habe ich als Tierhalter, wenn ich einen Behandlungsfehler bei meinem Tierarzt vermute?
- Wie kann ich als Tierhalter einen Behandlungsfehler meines Tierarztes nachweisen?
- Welche Arten von Schäden kann ich bei einem Behandlungsfehler meines Tierarztes geltend machen?
- Was bedeutet es, wenn ein Gericht eine Berufung als „offensichtlich ohne Erfolgsaussicht“ einstuft?
- Welche Rolle spielt ein Sachverständigengutachten bei der Beurteilung eines tierärztlichen Behandlungsfehlers?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 4 U 1192/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: OLG Dresden
- Datum: 06.01.2025
- Aktenzeichen: 4 U 1192/24
- Verfahrensart: Beschlussverfahren im Rahmen einer Berufung
- Rechtsbereiche: Zivilrecht (Tierarzthaftung, Schadensersatz)
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Hat Schadensersatz wegen angeblicher fehlerhafter tierärztlicher Behandlung des Hundes gefordert und Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt.
- Beklagte: Wiesen die Vorwürfe der Klägerin zurück.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Der Fall betraf den Anspruch der Klägerin auf Schadensersatz wegen angeblich fehlerhafter tierärztlicher Behandlung ihres Hundes, bei dem ein Beinbruch operiert und das Implantat später entfernt wurde.
- Kern des Rechtsstreits: Zentral war die Frage, ob die tierärztliche Behandlung des Hundes fehlerhaft war und ob das erstinstanzliche Gericht den Schadensersatzanspruch der Klägerin nach Einholung eines Sachverständigengutachtens zu Recht abgewiesen hat.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Gericht hat entschieden, die Berufung der Klägerin gegen das erstinstanzliche Urteil zurückzuweisen.
- Begründung: Das Gericht begründete dies damit, dass das erstinstanzliche Urteil, welches auf einem Sachverständigengutachten beruhte, korrekt sei. Nach dem Gutachten lag kein Behandlungsfehler vor, und die Argumente der Klägerin gegen das Gutachten waren nicht ausreichend, um die erstinstanzlichen Feststellungen zu widerlegen.
- Folgen: Die Klage auf Schadensersatz bleibt abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hatte keinen Erfolg.
Der Fall vor Gericht
OLG Dresden: Kein Schadensersatz für Hundehalterin nach Bein-OP – Berufung gegen Tierarzt wegen Behandlungsfehler abgewiesen
Eine Hundehalterin, die nach einer Beinoperation ihres Hundes Schadensersatz von den behandelnden Tierärzten forderte, ist auch in der zweiten Instanz gescheitert.

Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden kam zu dem Schluss, dass die Berufung der Tierbesitzerin gegen das erstinstanzliche Urteil offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat. Ein Behandlungsfehler konnte nach Auffassung des Gerichts nicht nachgewiesen werden, wobei das Gutachten eines Sachverständigen eine zentrale Rolle spielte.
Ausgangslage: Streit um Tierarztfehler nach Hundeoperation und Schadensersatzklage
Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stand die tierärztliche Behandlung eines Hundes im Jahr 2022. Das Tier hatte einen Bruch erlitten, der am 21. März 2022 in einer ersten Operation mittels einer Metallplatte und Schrauben versorgt wurde. Eine zweite Operation folgte am 31. August 2022, bei der dieses Implantat, also die Platte samt aller Schrauben, wieder entfernt wurde.
Die Hundehalterin war der Ansicht, dass den Tierärzten bei beiden Eingriffen gravierende Fehler unterlaufen seien. Sie bemängelte bei der ersten Operation das angeblich fehlerhafte Anbringen der Platte, die Verwendung von zu vielen Schrauben und eine dadurch verursachte Fehlstellung des Hundebeins. Bei der zweiten Operation kritisierte sie, dass Platte und alle Schrauben gleichzeitig entfernt wurden, anstatt eines schonenderen, gestuften Vorgehens, bei dem die Schrauben nach und nach entfernt werden. Darüber hinaus machte sie Mängel bei der Nachsorge geltend, insbesondere die Unterbringung des Hundes in einer ihrer Meinung nach unzureichenden Box. Schließlich warf sie den Tierärzten vor, sie unzureichend über alternative Operationsmethoden aufgeklärt zu haben, namentlich über die Möglichkeit der stufenweisen Schraubenentfernung. Sie forderte daher Schadensersatz für die entstandenen Kosten und möglicherweise auch Schmerzensgeld für das Tier, auch wenn dies im Urteilstext nicht explizit als Schmerzensgeld beziffert wird.
Die beschuldigten Tierärzte wiesen sämtliche Vorwürfe zurück. Das Landgericht, als Gericht erster Instanz, hatte die Klage der Hundehalterin bereits abgewiesen. Grundlage dieser Entscheidung war ein umfangreiches Sachverständigengutachten des Experten Dr. Reif. Dieser kam zu dem Schluss, dass kein Nachweis für einen Behandlungsfehler vorliegt. Gegen dieses Urteil legte die Hundehalterin Berufung beim OLG Dresden ein und wiederholte ihre Anschuldigungen.
OLG Dresden bestätigt: Berufung der Hundehalterin offensichtlich ohne Erfolgsaussicht (§ 522 ZPO)
Das Oberlandesgericht Dresden teilte die Einschätzung des Landgerichts und kündigte an, die Berufung der Hundehalterin ohne mündliche Verhandlung durch einen einstimmigen Beschluss zurückzuweisen. Diese Vorgehensweise ist nach § 522 Absatz 2 der Zivilprozessordnung (ZPO) möglich, wenn das Berufungsgericht einstimmig davon überzeugt ist, dass die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, der Fall keine grundsätzliche Bedeutung aufwirft, die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung keine Entscheidung durch Urteil erfordert und eine mündliche Verhandlung nicht geboten ist. All diese Voraussetzungen sah der Senat als erfüllt an. Der bereits angesetzte Termin zur mündlichen Verhandlung wurde daher aufgehoben. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wurde auf 5.249,77 Euro festgesetzt.
Kernpunkt Beweislast: Gutachten entlastet Tierärzte von Behandlungsfehlervorwurf nach Operation
Das OLG Dresden betonte, dass das Landgericht die Klage zu Recht und mit zutreffender Begründung abgewiesen habe. Der Hundehalterin stehe kein Anspruch auf Schadensersatz gegen die Tierärzte zu, weder aus dem Behandlungsvertrag (§§ 611, 280 BGB) noch aus Deliktsrecht (§ 823 Abs. 1 BGB).
Entscheidend war die Frage der Beweislast. Im Arzthaftungsrecht, das auch für Tierärzte gilt, muss grundsätzlich der Patient – hier die Hundehalterin – beweisen, dass ein Behandlungsfehler vorliegt und dass dieser Fehler ursächlich für den entstandenen Schaden ist. Das Landgericht hatte auf Basis des Gutachtens von Dr. Reif festgestellt, dass die Hundehalterin diesen Beweis nicht erbringen konnte.
Das OLG sah sich an diese Feststellungen des Landgerichts gebunden (§ 529 ZPO). Eine erneute Beweisaufnahme oder eine andere Bewertung kommt im Berufungsverfahren nur in Betracht, wenn konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der erstinstanzlichen Feststellungen wecken. Solche Zweifel sah das OLG hier nicht.
Der Sachverständige Dr. Reif hatte in seinem Gutachten detailliert und nachvollziehbar dargelegt, warum aus seiner Sicht kein Behandlungsfehler vorlag:
- Erstoperation (Plattenanbringung): Die Anbringung der Platte am 21.03.2022 habe der gängigen chirurgischen Praxis entsprochen. Das verwendete Implantat sei gut dimensioniert gewesen. Auch die Anzahl von 12 Schrauben sei nicht zu beanstanden, da es keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür gebe, dass eine höhere Schraubenanzahl per se nachteilig sei (abgesehen von einer potenziell langsameren Knochenheilung, was aber keinen Fehler darstellt). Eine Fehlstellung des Beines sei durch die Operation nicht verursacht worden.
- Zweitoperation (Implantatentfernung): Die Entfernung der Platte samt aller Schrauben am 31.08.2022 sei ebenfalls nicht fehlerhaft gewesen. Der Knochenbruch sei zu diesem Zeitpunkt verheilt gewesen. Die Entscheidung, alle Implantate in einem Schritt zu entfernen, sei medizinisch korrekt gewesen, um eine sogenannte „Stress Protection“ zu vermeiden – ein Phänomen, bei dem der Knochen unter der stabilen Platte an Festigkeit verlieren kann. Ein gestuftes Vorgehen (sukzessive Schraubenentfernung) werde zwar diskutiert, aber überwiegend bei kleineren Hunden erwogen. Da der Hund der Klägerin groß war, sei die gewählte Methode vertretbar gewesen. Auch sei das Implantat nicht zu spät entfernt worden.
Das Gericht stellte klar, dass für die Beurteilung eines Behandlungsfehlers nicht entscheidend ist, ob eine andere Methode im Nachhinein vielleicht besser gewesen wäre. Maßgeblich ist allein der tierärztliche Facharztstandard zum Zeitpunkt der Behandlung (Ex-ante-Sicht). Es kommt darauf an, ob die durchgeführten Maßnahmen dem entsprachen, was von einem gewissenhaften und aufmerksamen Tierarzt des entsprechenden Fachgebiets erwartet werden konnte.
Berufungsangriffe unzureichend: Keine Zweifel am Gutachten begründet nach § 529 ZPO
Die Argumente der Hundehalterin gegen das Gutachten und die Beweiswürdigung des Landgerichts überzeugten das OLG nicht. Das Gericht führte aus, dass die bloße Wiederholung der Behauptung eines Behandlungsfehlers im Berufungsverfahren nicht ausreicht, wenn ein nachvollziehbares und gut begründetes Sachverständigengutachten vorliegt.
Während in der ersten Instanz möglicherweise einfache Einwände gegen ein Gutachten genügen können, gelten in der Berufungsinstanz strengere Anforderungen. Um die Bindungswirkung der erstinstanzlichen Tatsachenfeststellung (§ 529 ZPO) zu durchbrechen und Zweifel am Gutachten zu säen, muss die Partei, die die Beweislast trägt (hier die Hundehalterin), konkrete medizinische Anhaltspunkte vortragen. Dies kann beispielsweise durch die Vorlage eines Privatgutachtens, den Verweis auf spezifische medizinische Fachliteratur oder anerkannte Leitlinien geschehen. Der Vortrag der Hundehalterin im Berufungsverfahren erfüllte diese erhöhten Anforderungen jedoch nicht.
Auch die von der Hundehalterin benannten Tierärzte, die den Hund nachbehandelt hatten, mussten nicht als sogenannte sachverständige Zeugen vernommen werden. Eine solche Vernehmung dient laut § 414 ZPO dem Beweis vergangener Tatsachen oder Zustände, für deren Wahrnehmung spezielle Sachkunde nötig war. Die Frage aber, ob ein Behandlungsfehler vorliegt, ist eine rechtliche Bewertung, die das Gericht – gestützt auf das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen – selbst vornehmen muss. Es handelt sich nicht um eine reine Tatsachenfrage, die ein Zeuge beantworten könnte.
Weitere Vorwürfe zurückgewiesen: Postoperative Versorgung und angebliche Fehler-Eingeständnisse ohne rechtliche Relevanz
Auch die weiteren Vorwürfe der Hundehalterin wurden vom OLG als unbegründet angesehen. Hinsichtlich der postoperativen Versorgung und der angeblich unzureichenden Unterbringungsbox hatten die Tierärzte bereits in erster Instanz mit einem Privatgutachten und einem Foto (Anlage B1) zur Beschaffenheit der Box Stellung genommen. Damit hatten sie ihrer Darlegungslast genügt. Es wäre dann an der beweisbelasteten Hundehalterin gewesen, konkret darzulegen und zu beweisen, warum die Unterbringung dennoch unzureichend war, was sie jedoch unterließ.
Das Gericht sah auch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Hundehalterin. Ihre persönliche Anhörung sei nicht erforderlich gewesen, da die entscheidende Frage des Behandlungsfehlers primär auf Grundlage des objektiven Sachverständigengutachtens zu klären war und nicht auf Basis ihrer subjektiven Wahrnehmung.
Ebenso wenig musste eine Sprachnachricht einer der beteiligten Tierärztinnen vom 01.09.2022 angehört werden. Selbst wenn die Tierärztin darin subjektiv einen „Fehler“ eingeräumt hätte, wäre dies für die rechtliche Bewertung unerheblich. Maßgeblich ist allein der objektive tierärztliche Standard zum Behandlungszeitpunkt, nicht das subjektive Empfinden oder spätere Äußerungen einer Ärztin. Von einem rechtlich bindenden Schuldanerkenntnis könne ebenfalls keine Rede sein. Ein solches Anerkenntnis, das eine Haftung begründet, bedarf normalerweise der Schriftform (§ 781 BGB). Ein formloses (deklaratorisches) Schuldanerkenntnis setzt einen klaren Rechtsbindungswillen voraus. Dieser Wille konnte aus den zitierten Äußerungen der Tierärztin (Bedauern über den Verlauf, Erläuterungen zur Entscheidung bezüglich der Schraubenentfernung) nicht abgeleitet werden. Solche Äußerungen seien eher vergleichbar mit Bekundungen des Bedauerns nach einem Verkehrsunfall und stellten kein rechtlich relevantes Eingeständnis einer Pflichtverletzung dar.
Aufklärungspflicht des Tierarztes: Kein Schadensersatz wegen fehlender Alternativ-Info zur Operation
Schließlich blieb auch der Vorwurf der mangelnden Aufklärung über Behandlungsalternativen (stufenweise Schraubenentfernung) ohne Erfolg. Zwar trifft den Tierarzt laut Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Beratungspflicht. Diese bezieht sich auf Art, Erfolgsaussichten, Risiken und Alternativen des Eingriffs und berücksichtigt dabei auch die wirtschaftlichen Interessen des Tierhalters, den ideellen Wert des Tieres und den Tierschutz.
Anders als in der Humanmedizin dient diese Aufklärung beim Tierarzt aber nicht primär der Einholung einer rechtswirksamen Einwilligung in die Behandlung (da das Tier als Sache im Rechtssinne gilt und der Halter entscheidet), sondern soll dem Auftraggeber eine Abwägung ermöglichen, insbesondere auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Entscheidend ist jedoch: Selbst wenn eine Aufklärungspflichtverletzung vorgelegen hätte, muss die Hundehalterin beweisen, dass gerade diese fehlende Aufklärung ursächlich für den entstandenen Schaden war. Diesen Kausalitätsnachweis konnte sie nicht führen. Das Gericht führte aus, dass selbst bei einer Aufklärung über das stufenweise Vorgehen ein Schaden nicht plausibel dargelegt sei. Ein solches Vorgehen hätte mehrere weitere Operationen, Untersuchungen und Kontrollen bedeutet und somit erhebliche zusätzliche Kosten verursacht. Ein Schaden läge nur vor, wenn die tatsächlich entstandenen Kosten höher wären als die (hypothetischen) Kosten des alternativen, stufenweisen Vorgehens. Hierzu fehlte jeglicher Vortrag der Hundehalterin, und das Gericht hielt ein solches Szenario für unwahrscheinlich. Zudem hatte der Sachverständige Dr. Reif ausgeführt, dass eine erneute Fraktur auch bei einem stufenweisen Vorgehen nicht sicher hätte ausgeschlossen werden können.
Fazit und Empfehlung: Kostenrisiko bei Festhalten an der Berufung gegen Tierarztentscheidung
Zusammenfassend sah das OLG Dresden keine Anhaltspunkte für einen Behandlungsfehler oder eine andere Pflichtverletzung der Tierärzte. Die Entscheidung des Landgerichts, die Schadensersatzklage abzuweisen, wurde als korrekt bestätigt. Da die Berufung somit offensichtlich aussichtslos war, legte der Senat der Hundehalterin nahe, die Berufung zurückzunehmen. Dies hätte den Vorteil, dass sie zumindest zwei Gerichtsgebühren sparen würde, die ansonsten bei einer Zurückweisung durch Beschluss anfallen würden.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil verdeutlicht die hohen Hürden für Tierhalter bei Schadensersatzklagen gegen Tierärzte, da die Beweislast für einen Behandlungsfehler beim Halter liegt und durch wissenschaftlich fundierte Sachverständigengutachten widerlegt werden kann. Die Quintessenz ist, dass der tierärztliche Standard zum Zeitpunkt der Behandlung entscheidend ist, nicht nachträgliche Einschätzungen oder alternative Behandlungsmethoden. Bedeutsam ist auch die Erkenntnis, dass die Aufklärungspflicht bei Tierärzten primär dazu dient, dem Tierhalter eine wirtschaftliche Abwägung zu ermöglichen, und nicht – wie in der Humanmedizin – der rechtswirksamen Einwilligung in die Behandlung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Rechte habe ich als Tierhalter, wenn ich einen Behandlungsfehler bei meinem Tierarzt vermute?
Wenn Sie als Tierhalter den Verdacht haben, dass Ihr Tierarzt bei der Behandlung Ihres Tieres einen Fehler gemacht hat, haben Sie grundsätzlich Rechte, die sich aus dem Behandlungsvertrag zwischen Ihnen und dem Tierarzt ergeben. Dieser Vertrag verpflichtet den Tierarzt, Ihr Tier nach den anerkannten tiermedizinischen Standards zu behandeln.
Was bedeutet „Behandlungsfehler“ in der Tiermedizin?
Ein Behandlungsfehler liegt vor, wenn die Behandlung nicht den aktuellen und anerkannten Regeln der tierärztlichen Wissenschaft entspricht. Dies kann zum Beispiel eine falsche Diagnose, eine fehlerhafte Operation, die Gabe eines ungeeigneten Medikaments oder auch eine unzureichende Aufklärung über Risiken sein. Es geht also darum, ob der Tierarzt so gehandelt hat, wie es ein gewissenhafter und fachkundiger Tierarzt in der gleichen Situation getan hätte.
Welche Nachweise sind wichtig?
Um erfolgreich Ansprüche geltend zu machen, müssen Sie als Tierhalter nachweisen, dass tatsächlich ein Behandlungsfehler vorlag. Sie müssen also belegen, dass der Tierarzt von den üblichen Behandlungsstandards abgewichen ist. Zusätzlich müssen Sie nachweisen, dass dieser Fehler ursächlich für den Schaden an Ihrem Tier war. Der Schaden kann zum Beispiel in zusätzlichen Behandlungskosten, bleibenden Gesundheitsschäden oder im schlimmsten Fall im Tod des Tieres liegen. Die Beweisführung kann herausfordernd sein und erfordert oft detaillierte Kenntnisse des Behandlungsverlaufs und der tiermedizinischen Hintergründe.
Mögliche Ansprüche
Wenn ein Behandlungsfehler nachgewiesen werden kann und dieser ursächlich für einen Schaden war, können Sie Schadensersatzansprüche gegen den Tierarzt haben. Das Ziel ist es, den Zustand wiederherzustellen, der bestünde, wenn der Fehler nicht passiert wäre. Dies umfasst in der Regel die Erstattung der Kosten für die fehlerhafte Behandlung sowie der Kosten für notwendige Nachbehandlungen, die durch den Fehler entstanden sind. Unter bestimmten Umständen kann auch der Wert des Tieres eine Rolle spielen, insbesondere bei Nutz- oder Zuchttieren. Schmerzensgeld für das Tier selbst gibt es nach deutschem Recht nicht, da Tiere rechtlich als Sachen behandelt werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie als Tierhalter Rechte haben, wenn ein Behandlungsfehler vorliegt. Die Durchsetzung dieser Rechte hängt jedoch maßgeblich davon ab, ob Sie den Fehler und dessen Folgen beweisen können.
Wie kann ich als Tierhalter einen Behandlungsfehler meines Tierarztes nachweisen?
Der Nachweis eines Behandlungsfehlers bei Ihrem Tierarzt kann oft eine Herausforderung sein, da es um medizinische Fragen geht, die spezielle Fachkenntnisse erfordern. Ein Behandlungsfehler liegt im juristischen Sinne meist dann vor, wenn die Behandlung nicht den anerkannten tiermedizinischen Regeln und Standards entsprach.
Wichtige Anhaltspunkte für den Nachweis
Um zu beweisen, dass ein Fehler gemacht wurde und dieser Fehler den Schaden bei Ihrem Tier verursacht hat, sind in der Regel verschiedene Dinge entscheidend:
- Die Dokumentation der Behandlung: Die Aufzeichnungen des Tierarztes über den Zustand des Tieres, die vorgenommenen Untersuchungen, die Diagnose, die durchgeführte Behandlung, verabreichte Medikamente und den Verlauf sind sehr wichtig. Als Tierhalter haben Sie das Recht, diese Behandlungsunterlagen einzusehen oder Kopien zu erhalten. Fehlende oder unvollständige Dokumentation kann unter Umständen eine Rolle spielen.
- Sachverständigengutachten: Da es um komplexe medizinische Sachverhalte geht, ist oft die Meinung eines unabhängigen Sachverständigen (eines anderen Tierarztes oder Experten) nötig. Dieser Sachverständige beurteilt, ob die durchgeführte Behandlung nach den üblichen Standards korrekt war oder ob ein Fehler vorliegt. Gerichte stützen sich bei der Klärung solcher Fragen häufig auf solche Gutachten.
- Zeugenaussagen: Auch Beobachtungen, die Sie oder andere Personen (z.B. Familienmitglieder) gemacht haben, können relevant sein. Dazu gehören Feststellungen über den Zustand des Tieres vor der Behandlung, während des Aufenthalts in der Praxis oder Klinik und wie sich der Zustand nach der Behandlung entwickelt hat.
Die Frage der Beweislast
In rechtlichen Verfahren spricht man von der Beweislast. Das bedeutet, wer was beweisen muss. Grundsätzlich gilt im deutschen Recht: Wer einen Anspruch geltend macht (hier: Schadensersatz wegen eines Behandlungsfehlers), muss die Voraussetzungen dafür beweisen. Das bedeutet, als Tierhalter müssen Sie in der Regel beweisen, dass ein Behandlungsfehler vorlag und dieser Fehler ursächlich für den Schaden (z.B. bleibende Gesundheitsprobleme oder Tod des Tieres) war.
Es gibt jedoch bestimmte Situationen, in denen sich die Beweislast umkehren kann. Das bedeutet, dass dann der Tierarzt beweisen müsste, dass kein Fehler gemacht wurde oder dass der Schaden nicht auf den Fehler zurückzuführen ist. Solche Ausnahmen können zum Beispiel bei einem groben Behandlungsfehler oder bei einer mangelhaften oder fehlenden Dokumentation der Behandlung in Betracht kommen. Die Umstände des Einzelfalls sind hier entscheidend.
Welche Arten von Schäden kann ich bei einem Behandlungsfehler meines Tierarztes geltend machen?
Wenn bei der Behandlung Ihres Tieres ein Fehler durch den Tierarzt passiert, können Ihnen dadurch Kosten und Nachteile entstehen. Das deutsche Recht sieht vor, dass solche Schäden grundsätzlich vom Verursacher ersetzt werden müssen, wenn dieser den Schaden schuldhaft verursacht hat. Bei einem Behandlungsfehler eines Tierarztes kommen verschiedene Arten von Schäden in Betracht, die man geltend machen kann.
Kosten der ursprünglichen und weiteren Behandlung
Ein wesentlicher Schaden sind die Kosten, die Ihnen für die ursprüngliche Behandlung entstanden sind, wenn diese aufgrund des Fehlers nutzlos war. Hinzu kommen oft die Kosten für weitere Behandlungen, die notwendig werden, um den Schaden zu beheben oder die Gesundheit Ihres Tieres wiederherzustellen. Stellen Sie sich vor, eine Operation verläuft fehlerhaft und eine weitere Operation oder eine langwierige medikamentöse Nachbehandlung wird nötig – all diese zusätzlichen Ausgaben können unter Umständen als Schaden geltend gemacht werden. Dazu gehören auch Kosten für Medikamente, Verbandsmaterial oder spezielle Therapien.
Folgeschäden und weitere Aufwendungen
Über die direkten Behandlungskosten hinaus können auch weitere Schäden entstehen. Das können zum Beispiel Kosten für spezielles Futter, eine notwendige physiotherapeutische Behandlung oder auch Fahrtkosten sein, die durch zusätzliche Tierarztbesuche anfallen. Im schlimmsten Fall, wenn das Tier aufgrund des Behandlungsfehlers stirbt, können auch die Kosten für die Beseitigung oder Einäscherung des Tieres einen erstattungsfähigen Schaden darstellen.
Entgangener Gewinn bei Nutztieren
Haben Sie ein Tier, das gewerblich genutzt wird, wie zum Beispiel ein Zucht- oder Arbeitstier (etwa eine Milchkuh, ein Rennpferd oder ein Hütehund), kann ein Behandlungsfehler dazu führen, dass das Tier seine Leistung nicht mehr erbringen kann. In diesem Fall kann der entgangene Gewinn einen ersatzfähigen Schaden darstellen. Das bedeutet, der Verdienst, der Ihnen durch die Nutzung des Tieres entgangen ist, weil es wegen des Fehlers nicht einsatzfähig war, kann geltend gemacht werden. Dies gilt allerdings nur, wenn das Tier tatsächlich zur Gewinnerzielung diente.
Schmerzensgeld – eine Besonderheit bei Tieren
Bei Menschen ist es üblich, neben den materiellen Schäden auch Schmerzensgeld für erlittene körperliche oder seelische Leiden zu erhalten. Bei Tieren ist die rechtliche Lage in Deutschland anders. Obwohl Tiere laut Gesetz (§ 90a BGB) keine Sachen sind, werden sie in Bezug auf den Schadensersatz rechtlich oft ähnlich behandelt. Dies bedeutet, dass Schmerzensgeld im Sinne einer Entschädigung für das Leid des Tieres selbst oder für den emotionalen Schmerz des Halters über das Leid oder den Verlust des Tieres in Deutschland grundsätzlich nicht in gleicher Weise wie bei einem Personenschaden anerkannt ist. Die Rechtsprechung hierzu ist komplex, aber die Zahlung von Schmerzensgeld für das Tierleid oder den Halterschmerz ist rechtlich schwierig durchzusetzen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die möglichen Schadenspositionen bei einem tierärztlichen Behandlungsfehler vor allem die entstandenen Kosten und finanzielle Nachteile umfassen, während die Frage des Schmerzensgeldes bei Tieren nach deutschem Recht eine besondere und meist abschlägige Behandlung erfährt.
Was bedeutet es, wenn ein Gericht eine Berufung als „offensichtlich ohne Erfolgsaussicht“ einstuft?
Wenn ein Gericht eine Berufung (die Anfechtung eines Urteils der ersten Instanz vor einem höheren Gericht) als „offensichtlich ohne Erfolgsaussicht“ einstuft, bedeutet dies, dass das Gericht nach sorgfältiger Prüfung der vorgebrachten Argumente und Beweise zu der klaren Überzeugung gelangt ist, dass die Berufung keine realistische Chance auf Erfolg hat.
Für das Gericht liegt die Angelegenheit in diesem Stadium bereits so klar, dass eine weitere Verhandlung voraussichtlich nichts Wesentliches mehr ändern würde. Es sieht keine Grundlage dafür, das angefochtene Urteil zu ändern.
Die Einstufung als „offensichtlich ohne Erfolgsaussicht“ hat wichtige Folgen für das weitere Verfahren. Gemäß § 522 Absatz 2 der Zivilprozessordnung (ZPO) kann das Gericht die Berufung in einem solchen Fall ohne eine mündliche Verhandlung durch einen sogenannten „Beschluss“ zurückweisen. Das bedeutet, es findet kein weiterer Gerichtstermin statt, bei dem die Parteien ihre Standpunkte mündlich darlegen.
Bevor das Gericht diesen Beschluss erlässt, informiert es in der Regel die Partei, die die Berufung eingelegt hat, über seine Einschätzung und gibt ihr die Möglichkeit, die Berufung zurückzunehmen. Wenn die Berufung nicht zurückgenommen wird, wird sie vom Gericht durch Beschluss zurückgewiesen.
Diese Regelung dient dazu, das Gerichtsverfahren zu beschleunigen, wenn die Sach- und Rechtslage aus Sicht des Gerichts eindeutig ist und weitere Schritte des Verfahrens voraussichtlich keine Änderung des Ergebnisses bringen würden.
Welche Rolle spielt ein Sachverständigengutachten bei der Beurteilung eines tierärztlichen Behandlungsfehlers?
Wenn es darum geht, ob ein Tierarzt bei der Behandlung eines Tieres einen Fehler gemacht hat, der zu einem Schaden geführt hat, stehen oft medizinische Fragen im Raum. Juristische Laien können diese medizinischen Zusammenhänge und die tiermedizinischen Standards meist nicht beurteilen. Hier kommt das Sachverständigengutachten ins Spiel.
Die zentrale Bedeutung des Gutachtens
Ein Sachverständigengutachten ist in solchen Fällen oft entscheidend. Es wird von einem unabhängigen Fachexperten erstellt, meist einem spezialisierten Tierarzt. Die Aufgabe des Sachverständigen ist es, die Behandlung objektiv zu prüfen. Er beurteilt, ob die durchgeführten Maßnahmen dem anerkannten Stand der Wissenschaft und den tiermedizinischen Regeln entsprachen. Einfach gesagt: Hätte ein sorgfältiger Tierarzt in derselben Situation die Behandlung genauso durchgeführt oder gab es einen Fehler? Das Gutachten hilft dem Gericht, die medizinischen Fakten und den Behandlungsablauf zu verstehen und zu bewerten.
Feststellung des Behandlungsfehlers und des Schadenszusammenhangs
Das Gutachten klärt zwei wichtige Fragen:
- Gab es tatsächlich einen Behandlungsfehler? Der Sachverständige prüft, ob die Behandlung von dem abwich, was nach tiermedizinischen Standards geboten gewesen wäre.
- Gibt es einen Ursachenzusammenhang zwischen dem eventuellen Fehler und dem Schaden am Tier? Es muss festgestellt werden, ob der Schaden (z.B. Verschlechterung des Zustands, Tod des Tieres) aufgrund des Fehlers eingetreten ist oder ob er andere Ursachen hatte. Ohne diesen Zusammenhang – die sogenannte Kausalität – liegt auch bei einem festgestellten Fehler kein Anspruch auf Schadensersatz vor. Das Sachverständigengutachten ist hier oft der Schlüssel zur Beweisführung.
Beauftragung und Kosten
Ein Sachverständigengutachten wird in einem Gerichtsverfahren üblicherweise vom Gericht selbst in Auftrag gegeben. Das Gericht wählt den Sachverständigen aus und formuliert die Fragen, die das Gutachten beantworten soll. Auch private Gutachten, die eine Partei selbst beauftragt, können relevant sein, haben aber oft nicht dasselbe Gewicht wie ein gerichtlich bestelltes Gutachten.
Die Kosten für ein solches Gutachten können erheblich sein und hängen vom Umfang und der Komplexität des Falles ab. Sie werden vom Gericht festgelegt und sind zunächst von der Partei zu zahlen, die das Gutachten beantragt hat oder die laut Prozessrecht in Vorleistung treten muss. Im Falle eines gewonnenen Prozesses werden diese Kosten in der Regel der unterlegenen Partei auferlegt. Bei einem verlorenen Prozess trägt die Partei, die das Gutachten beantragt hat, die Kosten selbst.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – Fragen Sie unverbindlich unsere Ersteinschätzung an.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Behandlungsfehler
Ein Behandlungsfehler liegt vor, wenn ein Tierarzt bei der Behandlung eines Tieres nicht nach den anerkannten fachlichen Standards oder Regeln der tiermedizinischen Wissenschaft handelt. Dies bedeutet, dass die Behandlung von dem abweicht, was ein sorgfältiger und kompetenter Tierarzt in derselben Situation angemessen durchgeführt hätte. Entscheidend ist, ob die Fehlbehandlung kausal für den Schaden am Tier war. Ein Beispiel: Wird etwa eine Operation falsch durchgeführt, sodass ein vermeidbarer Schaden am Tier entsteht, kann dies ein Behandlungsfehler sein.
Sachverständigengutachten
Ein Sachverständigengutachten ist eine von einem unabhängigen medizinischen Experten (Sachverständigen) erstellte schriftliche Bewertung, ob und inwiefern ein Behandlungsfehler vorliegt. Das Gutachten klärt komplexe medizinische Fragen, die dem Gericht selbst nicht geläufig sind, und beurteilt, ob die Behandlung dem Facharztstandard entsprach und ob ein Zusammenhang zwischen Fehler und Schaden besteht. Dabei berücksichtigt der Sachverständige die zum Behandlungszeitpunkt gültigen medizinischen Standards (Ex-ante-Sicht). Beispielsweise prüft ein Tierarztgutachter, ob die Implantatentfernung ordnungsgemäß war.
Beweislast
Die Beweislast beschreibt im Zivilverfahren, wer welche Tatsachen beweisen muss. Im Tierarzthaftungsrecht trägt normalerweise der Tierhalter die Beweislast dafür, dass ein Behandlungsfehler vorliegt und dieser Fehler ursächlich für den Schaden am Tier war. Nur wenn der Tierhalter diese Voraussetzungen nicht beweisen kann, ist der Anspruch auf Schadensersatz abgewiesen. Beispiel: Die Hundehalterin musste durch Beweise zeigen, dass die falsche Implantatentfernung die Fehlstellung verursachte.
Berufung ohne Aussicht auf Erfolg (§ 522 ZPO)
Wenn ein Gericht eine Berufung als „offensichtlich ohne Aussicht auf Erfolg“ einstuft, bedeutet dies, dass die Beschwerde gegen ein Urteil von vornherein keine realistische Chance hat, zu einer Änderung zu führen. Gemäß § 522 Absatz 2 der Zivilprozessordnung (ZPO) kann das Berufungsgericht die Berufung dann ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss zurückweisen. Dies spart Zeit und Ressourcen, wenn der Fall aus Sicht des Gerichts klar entschieden ist. Beispiel: Das OLG Dresden hat so entschieden, weil das Sachverständigengutachten stichhaltig war.
tierärztlicher Facharztstandard (Ex-ante-Sicht)
Der tierärztliche Facharztstandard bezeichnet den anerkannten fachlichen Kenntnis- und Verfahrensstand, der von einem gewissenhaften Tierarzt zum Zeitpunkt der Behandlung erwartet wird. Die Beurteilung eines möglichen Behandlungsfehlers richtet sich stets nach diesem Standard aus der Sicht zum Zeitpunkt der Behandlung (ex-ante), nicht nach dem, was im Nachhinein besser gewesen wäre. Beispiel: Die Entscheidung, alle Schrauben in einer Operation zu entfernen, war nach dem gängigen Standard vertretbar, obwohl ein anderes Vorgehen heute diskutiert wird.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 280 BGB (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung): Dieser Paragraph regelt, dass ein Schuldner dem Gläubiger zum Ersatz Schadens verpflichtet ist, wenn er eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt. Wichtig ist hierbei der Nachweis eines Fehlers sowie eines daraus resultierenden Schadens. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Hundehalterin muss beweisen, dass die Tierärzte eine Pflicht aus dem Behandlungsvertrag verletzt haben und dass dieser Fehler ursächlich den Schaden am Hund bzw. an ihren Aufwendungen verursacht hat.
- § 611 BGB (Dienstvertrag, insbesondere Behandlungsvertrag): Regelt die Verpflichtungen und Rechte bei der Erbringung von Dienstleistungen, hier die tierärztliche Behandlung als Dienstleistung. Im konkreten Kontext umfasst der Vertrag die ordnungsgemäße medizinische Versorgung. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die tierärztlichen Leistungen gründen auf einem Dienstvertrag, dessen vertragsgemäße Erfüllung hier strittig ist; der Nachweis, dass die Behandlung den anerkannten medizinischen Standards entsprach, war entscheidend.
- § 823 Abs. 1 BGB (Deliktische Haftung): Diese Norm regelt die Schadensersatzpflicht bei unerlaubten Handlungen, wenn jemand vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper oder andere Rechtspositionen verletzt. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Klägerin konnte keinen deliktischen Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB geltend machen, da kein beweisbarer schuldhafter Behandlungsfehler oder eine Garantieverletzung vorlag.
- § 529 ZPO (Bindung an Tatsachenfeststellungen im Berufungsverfahren): Das Gericht ist im Berufungsrecht grundsätzlich an die erstinstanzlichen Tatsachenfeststellungen gebunden, außer es liegen neue, gewichtige Gründe vor. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG akzeptierte die umfassende Beweiswürdigung des Landgerichts und sah keine konkreten Anhaltspunkte, um die Bindungswirkung zu durchbrechen, weshalb die Berufung ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen wurde.
- § 522 Abs. 2 ZPO (Zurückweisung einer offensichtlichen Berufungsunzulässigkeit): Regelt, dass das Berufungsgericht ein Verfahren ohne mündliche Verhandlung beenden kann, wenn die Berufung keine Aussicht auf Erfolg hat und keine grundsätzliche Bedeutung besteht. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG wies die Berufung der Hundehalterin ohne mündliche Verhandlung zurück, da die Angelegenheit keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwarf und die Berufung offensichtlich aussichtslos war.
- Rechtsprechung zur Aufklärungspflicht bei Tierärzten (vergleichbar mit BGH-Urteilen zur Aufklärung im Medizinrecht): Tierärzte haben eine Beratungspflicht über Art, Risiken und Alternativen der Behandlung, allerdings dient diese nicht der Einwilligung, sondern der Entscheidungsgrundlage des Tierhalters. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Unterlassung einer detaillierten Aufklärung über alternative Operationsmethoden konnte keine Schadensersatzpflicht begründen, da kein Kausalzusammenhang zwischen Aufklärungsfehler und Schaden nachgewiesen wurde.
Das vorliegende Urteil
OLG Dresden – Az: 4 U 1192/24 – Beschluss vom 06.01.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.