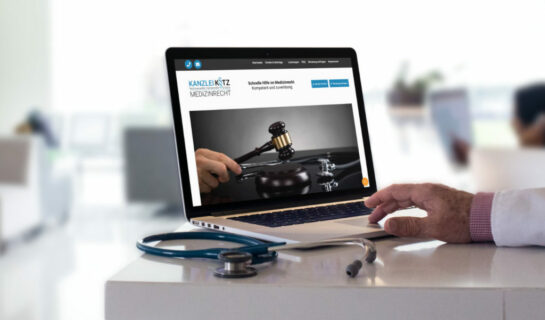Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt – Az.: 1 U 48/18 – Urteil vom 14.05.2019
Die Berufung des Klägers gegen das am 23. März 2018 verkündete Urteil des Einzelrichters der 6. Zivilkammer des Landgerichts Halle wird zurückgewiesen.
Der Kläger hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
Dieses und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund der Urteile zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.
Gründe
I
Der Kläger nimmt die Beklagten auf Schmerzensgeld in Anspruch und begehrt die Feststellung der Pflicht zum Ersatz weiterer Schäden. Dieses Begehren stützt er auf das Vorbringen, im April 2014 bei einer durch den Beklagten zu 5) durchgeführten Operation eines Hirntumors im Hause der Beklagten zu 1) fehlerhaft behandelt und durch die Beklagten zu 3) und 4) unzureichend aufgeklärt worden zu sein. Zusätzlich stützt er sein Begehren auf die Ansicht, dass die Operation bereits deswegen rechtswidrig gewesen sei, weil sie entgegen einer auf die Behandlung durch den Beklagten zu 2) als Chefarzt gerichteten Wahlleistungsvereinbarung durch den Beklagten zu 5) ausgeführt wurde.
Hinsichtlich der Einzelheiten und die erstinstanzlichen Anträge wird auf die tatsächlichen Feststellungen der angefochtenen Entscheidung verwiesen.
Das Landgericht, der Einzelrichter, hat, sachverständig beraten (vgl. das auf Grundlage des Beweisbeschlusses vom 4. April 2017 [Bl. 53 GA I] eingeholte Gutachten des Sachverständigen Dr. med. W. B. vom 11. September 2017 und die mündlichen Erläuterungen des Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung vom 21. Februar 2018 [Bl. 143 ff. GA I]), die Klage abgewiesen.
Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, dass dem Kläger ein Schadensersatzanspruch nicht schon deshalb zustehe, weil die unstreitig vom Kläger erteilte Einwilligung mangels vollständiger und zutreffender Aufklärung unwirksam gewesen wäre und zur Rechtswidrigkeit des operativen Eingriffs geführt hätte. Bei der Aufklärung sei auch auf Alternativen zur beabsichtigten Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können. Die Wahl der Behandlungsmethode sei primär Sache des behandelnden Arztes. Die Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten erfordere jedoch eine Unterrichtung über eine alternative Behandlungsmöglichkeit, wenn eine solche zur Verfügung stehe. Je weniger dringlich sich ein Eingriff darstelle, desto weitgehender seien das Maß und der Genauigkeitsgrad der Aufklärungspflicht. Der Patient, der eine Verletzung der nur ausnahmsweise bestehenden Pflicht zur Aufklärung über Behandlungsalternativen behaupte, habe darzulegen, über welche alternativen Behandlungsmethoden eine Aufklärung erforderlich gewesen sein solle.
Unter Anwendung dieser Grundsätze sei die Aufklärung des Klägers im vorliegenden Fall nicht zu beanstanden. Er sei darüber informiert worden, dass neben der relativ indizierten Operation ein Abwarten und weiteres Beobachten des Tumors in Betracht kamen. Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen stelle die Strahlentherapie keine alternative Behandlungsmethode dar, die gleichermaßen indiziert gewesen wäre. Der Sachverständige habe erläutert, dass die Strahlentherapie eine vorangegangene Biopsie voraussetze, die vom Aufwand her ähnlich sei wie bei einer Operation, im Ergebnis aber oft wenig aussagekräftig. Die von der Klägerseite angesprochene Gamma-Knife-Behandlung werde nur in wenigen hochspezialisierten Zentren angeboten. Danach stelle sich die Strahlentherapie nicht als echte Alternative dar.
Es sei auch nicht als fehlerhaft anzusehen, dass die Beklagten zu 3) und zu 4) im Rahmen der Aufklärungsgespräche dem Kläger nicht nahegelegt hätten, mit der Operation zunächst zu warten. Darüber, dass das Abwarten grundsätzlich in Betracht gekommen sei, sei der Kläger aufgeklärt worden. Es sei dagegen nicht als Aufklärungsfehler anzusehen, dass die Beklagten dem Kläger nicht von der Operation abgeraten haben. Das ergebe sich aus den vom Sachverständigen erläuterten Vorteilen einer frühzeitigen Operation des beim Kläger vorgefundenen Tumors und dem geringen Operationsrisiko. Eine womöglich von den Beklagten gehegte Präferenz zu Gunsten einer Operation sei nicht als fehlerhaft zu bewerten, denn diese Präferenz werde vom Sachverständigen geteilt. Dem Klägervorbringen sei nicht zu entnehmen, dass die Risiken der alternativen Methoden fehlerhaft dargestellt und die Risiken der Operation verharmlost oder deren Chancen überbewertet worden seien.
Die Aufklärung erweise sich auch nicht wegen des behaupteten Wechsels der Operationsmethode als fehlerhaft. Der Kläger sei im Ergebnis darüber aufgeklärt worden, dass der Eingriff minimalinvasiv erfolgen solle. Die verschiedenen gleichwertigen mikrochirurgischen Vorgehensweisen stellten keine Behandlungsmöglichkeiten der, die zu jeweils unterschiedlichen Belastungen des Patienten führten oder unterschiedliche Risiken und Erfolgschancen böten. Deshalb seien sie nicht aufklärungspflichtig.

Schließlich sei nicht über ein erhöhtes Risiko wegen einer vorangegangenen ASS-Medikation aufzuklären gewesen, denn ein solches Risiko habe nicht bestanden. Darüber hinaus scheide eine Haftung unter diesem Gesichtspunkt aus, weil die aufgetretenen Hirnblutungen nicht im Zusammenhang mit der Medikation gestanden hätten.
Der Eingriff sei nicht deshalb rechtswidrig, weil die Operation nicht durch den Chefarzt erfolgt sei. Abweichend von dem Sachverhalt, der der vom Kläger in Bezug genommene Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 19. Juli 2016 (VI ZR 75/15) zu Grunde lag, habe sich der Kläger nicht für einen bestimmten Arzt als Operateur entschieden, weil in der Wahlleistungsvereinbarung das Feld für die persönliche Behandlung durch den Chefarzt nicht angekreuzt gewesen sei.
Ein Schadensersatzanspruch stehe dem Kläger nicht wegen vermeintlicher weiterer Behandlungsfehler oder Befunderhebungsfehler zu. Der Sachverständige habe ausgeführt, dass ein weiteres Abwarten wegen der ASS-Medikation nicht erforderlich, die gewählte mikrochirurgische Vorgehensweise als Standard zu werten und als adäquat anzusehen sei. Ferner sei der Eingriff nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt worden. Die Reaktion auf die Komplikation sei rechtzeitig erfolgt und habe in ihrer Durchführung den Regeln der ärztlichen Kunst ebenfalls entsprochen. Schließlich könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Kläger zu früh von der Intensivstation in die Rehabilitation verlegt worden sei.
Mit seiner Berufung, die er form- und fristgerecht eingelegt und begründet hat, verfolgt der Kläger sein erstinstanzliches Ziel weiter.
Der Kläger hält die vom Landgericht gewonnene Einschätzung, dass die Strahlentherapie keine aufklärungsbedürftige Behandlungsalternative darstelle, für fehlerhaft. Den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, wonach dieser eigene Patienten zur Therapie mit dem Gamma-Knife nach K. schicke, sei zu entnehmen, dass eine echte und weniger invasive Behandlungsalternative bestanden habe. Der Strahlentherapie wäre eine histopathologische Sicherung der Diagnose im Wege der Biopsie vorausgegangen, die den Befund eines gutartigen Tumors geliefert hätte. Eine solche Biopsie stelle einen weniger schwerwiegenden Eingriff dar als eine umfassende Operation. Das mit der vorangehenden Biopsie verbundene Risiko sei daher kein Grund, die Strahlentherapie nicht als aufklärungspflichtige Behandlungsalternative zu der von den Beklagten gewählten Operation anzusehen. Hätte der Kläger von Beginn an, vor einer Operation oder Strahlenbehandlung, um die Qualität des Tumors gewusst, hätte der Kläger sich für das Abwarten oder eine Strahlentherapie entschieden.
Der Kläger hält an seinem erstinstanzlichen Vorbringen fest, wonach die Aufklärung auch deswegen unzureichend gewesen sei, weil ihm erst kurz vor dem Eingriff von der Beklagten zu 4) mitgeteilt worden sei, dass statt der ursprünglich vorgesehenen Operationsmethode ein mikrochirurgisches Vorgehen gewählt werde. Dieses Vorgehen sei im Hause der Beklagten zu 1) nicht gängig und werde daher nicht routinemäßig durchgeführt. Nach gehöriger Aufklärung über diesen Umstand hätte der Kläger sich nicht im Hause der Beklagten zu 1) operieren lassen.
Der Kläger wendet sich gegen die Eignung des Gerichtssachverständigen mit der Begründung, dass dieser in der mündlichen Anhörung erklärt habe, den Beklagten zu 5) und auch den Beklagten zu 2) persönlich zu kennen. Daraus ergäben sich Zweifel an der Unvoreingenommenheit des Sachverständigen.
Der Sachverständige verfüge über keine profunden Kenntnisse in der Strahlentherapie. Seine Ausführungen zur Notwendigkeit einer histopathologischen Untersuchung vor der Strahlentherapie seien daher nicht zuverlässig. Eine solche Untersuchung sei im Gegensatz zu den Ausführungen des Sachverständigen vor einer Strahlentherapie nicht erforderlich, was diese Behandlung zusätzlich als weniger belastend erscheinen lasse.
Der Kläger hält daran fest, dass eine Aufklärung über die von der ASS-Medikation ausgehenden Gefahren erforderlich gewesen sei. Der Zeitpunkt der Operation sei behandlungsfehlerhaft gewesen, weil diese zu früh nach dem Absetzen der Medikation durchgeführt worden sei.
Schließlich hält der Kläger daran fest, infolge der Wahlleistungsvereinbarung darauf vertraut zu haben, durch den Chefarzt behandelt zu werden. Der Eingriff sei daher rechtswidrig, weil er entgegen der Erwartung des Klägers nicht vom Beklagten zu 2) sondern vom Beklagten zu 5) durchgeführt wurde.
Der Kläger beantragt, unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung
die Beklagten zu verurteilen, an den Kläger gesamtschuldnerisch aus der fehlerhaften Behandlung ab April 2014 ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen, dessen Höhe in das pflichtgemäße Ermessen des Gerichts gestellt wird, mindestens jedoch 500.000,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16. Juli 2015,
festzustellen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, dem Kläger sämtliche künftigen und vorhersehbaren immateriellen sowie alle vergangenen und künftigen materiellen Schäden, die ihm infolge der fehlerhaften Behandlung ab April 2014 entstanden sind oder noch entstehen werden, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind oder übergehen werden.
Hilfsweise beantragt der Kläger, den Rechtsstreit unter Aufhebung des landgerichtlichen Urteils zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht Halle zurückzuverweisen.
Die Beklagten beantragen, die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen die angefochtene Entscheidung.
Unter Hinweis auf die Bemerkung des gerichtlichen Sachverständigen, wonach dieser niemals zu einer Strahlentherapie geraten hätte, verteidigen sie insbesondere die in der angefochtenen Entscheidung getroffene Feststellung, wonach die Strahlentherapie keine übliche und gleichermaßen indizierte Methode zur Behandlung des Meningeoms darstelle, über die der Kläger aufgeklärt werden musste.
Sie bestreiten, dass der Kläger den Wunsch gehegt habe, vom Beklagten zu 2) als Chefarzt operiert zu werden. Darüber hinaus erfülle der Beklagte zu 5) die Voraussetzungen, die die in der Wahlleistungsvereinbarung vorgesehene Möglichkeit der Delegation des Eingriffs rechtfertigten, weil er als Oberarzt dem Beklagten zu 2) unmittelbar unterstellt und seiner fachlichen Weisungshoheit unterworfen sei.
Der Senat hat den gerichtlichen Sachverständigen Dr. med. W. B. ergänzend angehört. Hinsichtlich des Ergebnisses der ergänzenden Beweisaufnahme wird auf die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vom 11. April 2019 (Bl. 17 ff. GA II) verwiesen.
II
Die zulässige Berufung ist nicht begründet.
Das Landgericht hat die Klage mit zutreffender Begründung, auf die zunächst uneingeschränkt verwiesen wird, abgewiesen.
Ergänzend ist im Hinblick auf das Berufungsvorbringen folgendes auszuführen:
1. Aufklärung
Die Beklagten zu 3) und 4) haben den Kläger in ausreichendem Umfang über die Risiken des an ihm vorgenommenen Eingriffs und über die Existenz der in Betracht kommenden Behandlungsalternativen aufgeklärt.
a) Behandlungsalternativen
Obgleich primär die Ärzte die Wahl der Behandlungsmethode treffen, sind gleichwertige echte Behandlungsalternativen immer darzustellen, um dem Patienten in diesen Fällen nach entsprechend vollständiger ärztlicher Aufklärung die Entscheidung darüber zu überlassen, auf welchem Wege die Behandlung erfolgen soll und auf welches Risiko er sich einlassen will (vgl. BGH, Urteil vom 15.03.2005; VI ZR 313/03, MDR 2005, 988). Die Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten erfordert dabei dann eine Unterrichtung über eine alternative Behandlungsmöglichkeit, wenn für eine medizinisch sinnvolle und indizierte Therapie mehrere gleichwertige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die zu jeweils unterschiedlichen Belastungen des Patienten führen oder unterschiedliche Risiken und Erfolgschancen bieten (BGH Urt. v. 22.09.1987 – VI ZR 238/86, MDR 1988, 216; BGH Urt. v. 06.12.1988 – VI ZR 132/88, MDR 1989, 437; BGH Urt. v. 11.05.1982 – VI ZR 171/80, MDR 1982, 1009; BGH Urt. v. 15.03.2005 – VI ZR 313/03, MDR 2005, 988).
Gemessen an diesen Grundsätzen ist der Kläger ausreichend über Behandlungsalternativen aufgeklärt worden.
aa) Abwarten
Unstreitig ist zwischen den Parteien, dass der Eingriff nur relativ indiziert war. Es bestand also die Möglichkeit des weiteren Abwartens, das sich zumindest zunächst als gleichwertige Behandlungsalternative darstellte. Darauf ist der Kläger unstreitig hingewiesen worden. Mit dem bestrittenen Vorbringen des Klägers, er sei zu der Operation gedrängt worden, hat sich das Landgericht zutreffend auseinandergesetzt. Gestützt auf die Ausführungen, mit denen der Sachverständige die Vorteile einer frühzeitigen Operation des beim Kläger vorgefunden Tumors und das geringe Operationsrisiko erläutert hat, ist das Landgericht zutreffend davon ausgegangen, dass die Aufklärung nicht deswegen fehlerhaft war, weil dem Kläger nicht von einer Operation abgeraten wurde.
Diese Feststellung greift der Kläger nicht ausdrücklich an. Sie ist auch nicht deswegen in Zweifel gezogen, weil der Sachverständige, auf dessen Ausführungen sich die landgerichtliche Feststellung stützt, infolge seiner Bekanntschaft mit dem Beklagten zu 5) dem Beklagten zu 2) in seiner Unvoreingenommenheit zu Zweifeln Anlass gibt. Abgesehen davon, dass diese Argumentation nur im Rahmen eines vom Kläger nicht angebrachten Ablehnungsantrages geltend gemacht werden kann, rechtfertigt sie auch inhaltlich keine Zweifel an der Verwendbarkeit der vom Sachverständigen getroffenen Feststellungen für die gerichtliche Entscheidung. Das Vorbringen des Klägers rechtfertigt die Besorgnis der Befangenheit nicht. Bloße berufliche Kontakte und ein beruflich bedingter wissenschaftlicher und fachlicher Erfahrungsaustausch von Experten unter Wissenschaftlern können bei der gebotenen vernünftigen Betrachtungsweise die Besorgnis der Befangenheit eines Sachverständigen regelmäßig nicht begründen. Um eine solche Besorgnis rechtfertigen zu können, müssen vielmehr darüber hinausgehende persönliche oder enge fachliche Beziehungen des Sachverständigen zu einem Berufskollegen bestehen (Martis/Winkhart, Arzthaftungsrecht, 4. Aufl., Anmerkung S 87, Seite 1290). Solch eine Beziehung ergibt sich aus der vom Sachverständigen angegebenen und vom Kläger in Bezug genommenen Bekanntschaft nicht.
Allerdings macht der Kläger im Zusammenhang mit seiner Argumentation, dass die Aufklärung deswegen unvollständig gewesen sei, weil ihm die Möglichkeit der Strahlentherapie nicht aufgezeigt wurde, geltend, dass eine zur Vorbereitung der Strahlentherapie durchgeführte histopathologische Untersuchung die gutartige Natur des Tumors offengelegt hätte. Diese Information hätte dem Kläger nach seiner Darstellung Anlass gegeben, sich gegen die Operation zu entscheiden und dem Abwarten oder der Strahlentherapie den Vorzug zu geben. Dieses Vorbringen hat der Senat in dem Sinne aufgefasst, dass der Kläger die Einwilligung deswegen für unwirksam erachtet hat, weil ihm die Abwägung der für und gegen die Operation sprechenden Gesichtspunkte infolge der Unkenntnis über die Natur des Tumors nicht möglich gewesen sei. Das wäre der Fall, wenn nicht nur vor einer Strahlentherapie, sondern auch vor der von den Beklagten vorgesehenen Operation eine histopathologische Abklärung des Befundes angezeigt gewesen wäre. Stellte das Ausbleiben der histopathologischen Abklärung der Diagnose auch vor einer Operation einen Befunderhebungsfehler dar, entbehrte die Einwilligung des Klägers der ausreichenden tatsächlichen Abwägungsgrundlage und wäre deshalb unbeachtlich.
So liegt es im Streitfall jedoch nicht. Das Ausbleiben der Biopsie vor der durchgeführten Operation beeinträchtigt die Wirksamkeit der Einwilligung in den durchgeführten Eingriff nicht. Zum einen macht der Kläger schon nicht ausdrücklich geltend, dass die Natur des Tumors auch vor einer Operation durch Biopsie und histopathologische Untersuchung aufgeklärt hätte werden müssen. Vielmehr stellt er das Vorbringen in den Zusammenhang mit der vermissten Aufklärung über die Strahlentherapie. Zum anderen entwertet er das Vorbringen dadurch, dass er an anderer Stelle die Notwendigkeit der Biopsie und damit der histopathologischen Untersuchung gänzlich bestreitet, mithin bezweifelt, dass die in Form der GammaKnife-Behandlung durchzuführende Strahlentherapie eine solche Biopsie vorausgesetzt hätte (Seite 7 des Schriftsatzes vom 14. Mai 2018, Bl. 218 f. GA I). Sein Vorbringen zur Notwendigkeit der histopathologischen Untersuchung vor einer weiteren therapeutischen Maßnahme, sei es Operation, sei es Gamma-Knife-Behandlung, ist widersprüchlich.
Eine Biopsie war im Streitfall auch tatsächlich nicht erforderlich, um die Indikation des beabsichtigten Eingriffs abzusichern und dem Kläger eine tragfähige Grundlage für die Entscheidung zwischen einer Einwilligung in die Operation einerseits und dem weiteren Abwarten andererseits zu ermöglichen. Der Sachverständige hat in der mündlichen Anhörung vor dem Senat ausgeführt, dass zur Sicherung der Diagnose eine Gewebeentnahme nicht erforderlich gewesen sei. Die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines Meningeoms hat der Sachverständige als hoch bezeichnet. Der Sachverständige hat dieser Wahrscheinlichkeit die Nachteile einer Biopsie gegenübergestellt. Er hat ausgeführt, dass die in Form der Gewebeentnahme durchzuführende Biopsie ebenfalls die Gefahr der Nachblutung heraufbeschworen hätte. Er hat darauf hingewiesen, dass eine Biopsie nur dann angebracht gewesen wäre, wenn es Zweifel an der Diagnose gebe oder der Tumor ohnehin in inoperabel wäre (Seite 2 f. des Protokolls vom 11. April 2019, Bl. 18 f. GA II). Diesen überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen schließt der Senat sich an.
bb) Strahlentherapie
Auch die Feststellung des Landgerichts, wonach die Aufklärung nicht deshalb fehlerhaft war, weil dem Kläger die Möglichkeit der Strahlentherapie (in Form der Gamma-Knife-Therapie) nicht aufgezeigt wurde, begegnet keinen Bedenken. Diese Therapie stellte keine zur Operation gleichermaßen indizierte Behandlung dar, die wegen unterschiedlicher (hier niedrigerer) Risiken dem Kläger erläutert werden musste.
Der Sachverständige hat im Gutachten vom 11. September 2017 ausgeführt, dass der operativen Behandlung die erste Priorität zukomme (Seite 16) und dass eine Strahlentherapie ohne Kenntnis der Histopathologie nicht akzeptabel sei (Seite 17). Die vom Kläger zur Unterstützung seiner Auffassung von der Unzuverlässigkeit dieser Einschätzung der Strahlentherapie als nicht aufklärungsbedürftige Behandlungsalternative in Bezug genommene Bemerkung des Sachverständigen, wonach der Sachverständige seine Patienten gegebenenfalls zur Gamma-Knife-Behandlung nach K. schicke (Seite 3 des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 21. Februar 2018, Bl. 144 GA I), entkräftet die Zuverlässigkeit der Feststellung nicht. Der Sachverständige hat nämlich zuvor ausgeführt, dass eine solche Behandlung niemals ohne vorangegangene Biopsie durchgeführt werde, wenn nicht eine Ausnahmesituation vorliege, wie etwa eine hohe Komorbidität des Patienten oder ein völliger Verschluss gegenüber jedweder Operation (ebenfalls Bl. 144 GA I). Auch das mit der Berufungsbegründung vorgelegte Informationsmaterial über die Gamma-Knife-Behandlung (Bl. 223 ff. GA I) legt die Gleichwertigkeit der Indikation dieser Behandlungsform zur Operation nicht nahe. So heißt es dort: „Die Behandlung von Meningeomen ist in erster Linie chirurgisch, aber bei Patienten mit nicht zu großen Tumoren in empfindlichen Hirnarealen oder bei Patienten mit erhöhtem Operationsrisiko kann die Behandlung mit dem Gamma Knife eine schonende und vergleichbar effektive Behandlungsoption sein.“ Dieses Informationsmaterial weist auf die Vorrangigkeit der chirurgischen Behandlung hin und stellt darauf ab, ob der Tumor in einem empfindlichen Hirnareal liegt oder das Operationsrisiko erhöht ist. In diesen Fällen beschreibt es die Gamma-Knife-Behandlung als schonende Alternative. Diese Voraussetzungen waren beim Kläger nicht erfüllt, weil weder die Lokalisation des Tumors noch ein erhöhtes Operationsrisiko die Einstellung der Strahlentherapie in den Abwägungsprozess gegenüber der vorgesehenen Operation geboten. Der Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat dazu ausgeführt, dass die Strahlentherapie in solchen Fällen angezeigt sein könne, bei denen es von vornherein klar sei, dass eine chirurgischer Eingriff entweder überhaupt nicht in Betracht komme, oder nicht zu einem dauerhaften Erfolg führen werde. Es könne sich dabei um Tumore handeln, die sich an Stellen befinden, die man mit chirurgischen Mitteln schlecht oder überhaupt nicht mit Erfolg erreichen könne. In einem solchen Falle werde man dann allenfalls die Biopsie vornehmen, um dann eine der möglichen Strahlentherapieformen in Vorschlag zu bringen. In Betracht kämen die Strahlenbehandlungen auch dann, wenn schon der allgemeine Zustand des Patienten einen größeren operativen Eingriff überhaupt nicht zulasse. Eine solche Lage habe beim Kläger, dessen Tumor chirurgisch leicht erreichbar und der Entfernung zugänglich sei, nicht vorgelegen. Der Sachverständige hat zusammenfassend ausgeführt, dass das konkrete Krankheitsbild des Klägers keinen Anhaltspunkt dafür geliefert habe, an eine Strahlentherapie zu denken (Seite 3 des Protokolls vom 11. April 2019, Bl. 19 GA II).
Gestützt auf diese überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen ist der Senat im Einklang mit dem Landgericht davon überzeugt, dass die Strahlentherapie, so auch die vom Kläger in besonderer Weise ins Feld geführte Behandlung mit dem Gamma-Knife, keine Alternative darstellte, auf die im Rahmen der Aufklärung über den beabsichtigten Eingriff hingewiesen werden musste. Sie stellte keine gleichwertige Behandlungsmethode dar, weil sie mit dem Risiko der unbeherrschbaren Folgen der Strahlenbelastung verbunden war, das der Sachverständige plastisch mit der Formulierung beschrieben hat, man müsse sich das wie eine kleine Atombombe im Kopf vorstellen (ebenfalls Seite 3 des Protokolls vom 11. April 2019, Bl. 19 GA II). Zusätzlich ist die Strahlentherapie mit der regelhaften Notwendigkeit einer vorangegangenen Biopsie verbunden, wie der Sachverständige ebenfalls überzeugend bekundet hat. Diese Therapieform ist daher im Wesentlichen den chirurgisch schlecht oder überhaupt nicht zugänglichen Tumoren vorbehalten, wie der Senat den Ausführungen des Sachverständigen zusammenfassend entnommen hat.
Die Zuverlässigkeit der Ausführungen des Sachverständigen zu diesem Gesichtspunkt leidet nicht darunter, dass der Sachverständige kein Facharzt auf dem Gebiet der Strahlentherapie ist. Aus diesem Grund bestand für den Senat kein Anlass, dem klägerischen Beweisantrag, gerichtet auf die Einholung eines strahlentherapeutischen Gutachtens, zu entsprechen. Wie eingangs ausgeführt, hängt die Pflicht zur Aufklärung über eine alternative Behandlungsmethode davon ab, ob diese alternative Behandlungsmethode zu der vom behandelnden Arzt erwogenen Therapie gleichwertig erscheint und wegen unterschiedlicher Belastungen, Risiken und Heilungschancen gegen die vorgeschlagene Therapie abgewogen werden sollte. Daraus ergibt sich, dass die Beurteilung von Gleichwertigkeit, Belastungen, Risiken und Heilungschancen im Hinblick darauf, ob diese die Aufklärungspflichtigkeit der alternativen Behandlungsmethode herbeiführen, primär Sache des aufklärenden Arztes darstellt. Damit fällt die Einschätzung der Belastungen, Risiken und Heilungschancen im Hinblick darauf, ob die alternative Behandlungsmethode im Aufklärungsgespräch erwähnt werden muss, in die Kompetenz des behandelnden und demzufolge auch aufklärenden Arztes. Der Kläger litt unter einem Tumor des Gehirns und befand sich daher zu Recht in neurochirurgischer Behandlung. Die Aufklärung wurde folgerichtiger Weise aus neurochirurgischer Sicht vorgenommen. Der behandelnde Arzt schuldete eine Aufklärung, die auf Grundlage von Kenntnissen, die dem neurochirurgischen Standard entsprachen, erteilt wurde. Zur Einschätzung der Frage, ob die Strahlentherapie eine ernsthaft in Betracht kommende Behandlungsalternative darstellte, waren Kenntnisse über die Einzelheiten der Strahlentherapie nicht erforderlich. Vielmehr konnte der Kläger lediglich die Kenntnisse erwarten, über die ein Neurochirurg verfügen muss, um die Indikation einer Strahlentherapie gegenüber der Operationsindikation abzuwägen. Nach dem Grundsatz der fachgleichen Begutachtung konnte das Landgericht und kann auch der Senat deswegen auf die Kenntnisse des neurochirurgischen Sachverständigen zurückgreifen, um die im Streitfall erteilter Aufklärung darauf zu beurteilen, ob sie den Hinweis auf die Strahlentherapie enthalten musste, um dem Kläger eine sachgerechte Abwägung zu ermöglichen.
Gestützt auf die dargestellten Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, der auf eine Frage der Prozessbevollmächtigten des Klägers ausgeführt hat, die Strahlentherapie hätte für ihn bezogen auf den Fall des Klägers überhaupt nicht zur Debatte gestanden, weil sie eine Übertherapie dargestellt hätte, gelangt der Senat zu dem Ergebnis, dass die dem Kläger erteilte Aufklärung die in seinem Falle sinnvollerweise zur Verfügung stehenden Behandlungsalternativen (Entfernung des Tumors oder Abwarten) erschöpfend aufgezeigt hat. Der Umstand, dass der Sachverständige auch ausgeführt hat, dass er gegenüber dem Kläger die Strahlentherapie zwar benannt aber davon abgeraten hätte, gebietet keine andere Betrachtungsweise. Vor dem Hintergrund der übrigen und bereits näher in Bezug genommenen Ausführungen des Sachverständigen ist deutlich, dass die Erwähnung der Strahlentherapie als Alternative zur Operation im Streitfall nicht geboten war. Die vom Sachverständigen als eigene hypothetische Vorgehensweise geschilderte Gestaltung konnte fakultativ Inhalt des Aufklärungsgesprächs sein, war jedoch nicht erforderlich, um dem Kläger eine sachgerechte Entscheidung zu ermöglichen.
b) Risikoaufklärung
aa) vermeintlicher Wechsel der Operationstechnik
Der Einwand des Klägers, die Aufklärung sei deswegen unzureichend gewesen, weil ihm die tatsächlich gewählte Operationsmethode (minimalinvasives Vorgehen mit Zugang über der Augenbraue) erst kurz vor dem Eingriff und ohne Hinweis auf die vermeintlich fehlende Routine im Hause der Beklagten zu 1) mitgeteilt worden sei, bleibt ebenfalls ohne Erfolg.
Der Sachverständige hat dazu ausgeführt (Seite 9 des Gutachtens vom 11. September 2017):
„Prinzipiell ist jede (!) neurochirurgische Hirntumoroperation eine minimalinvasive-mikrochirurgische Operation. Allenfalls das Ausmaß der einzusetzenden Technik bei einer sehr strengen Indikation für bestimmte hirnkammernahe Eingriffe mit dem Endoskop können als minimalinvasiv-endoskopisch bezeichnet werden. Hirntumoren werden nahezu ausschließlich durch Eröffnung des Kopfes mittels eines von einem Bohrloch ausgehenden Knochendeckels durchgeführt.
Je nach Lokalisation, je nach Ausmaß der Raumforderung ist die Eröffnung des Kopfes, ist die Größe des Knochendeckels analog. Dementsprechend ist die Argumentation in der Klägerschrift in keiner Weise nachvollziehbar, es hat natürlich keine Änderung der Operationstechnik zwischen den beiden genannten Aufklärungsgesprächen, wie sie in der Klägerschrift genannt sind ergeben, allenfalls ist es vorstellbar, dass eine zunächst auch intendierte, sogenannte frontolaterale/pterionale Kraniotomie zu Gunsten eines kleiner angelegten Augenbrauenschnittes gemeint war.“
Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass die tatsächlich durchgeführte Operation gegenüber der Methode, die dem Kläger im ersten Aufklärungsgespräch dargestellt wurde, nicht in der Weise abwich, dass eine erneute grundlegende Aufklärung erforderlich wurde. Abweichend waren lediglich der Zugang und damit die Lokalisation der zu erwartenden Operationsnarbe. Darüber ist der Kläger aufgeklärt worden. Dazu hat der Sachverständige in der Anhörung vor dem Senat zunächst auf die Ausführungen seinem schriftlichen Gutachten und damit auch auf die soeben zitierte Äußerung Bezug genommen und ergänzend ausgeführt, dass die Änderung der Operationsmethode lediglich den Zugang betroffen habe. Der letztlich gewählte Zugang über die Augenbraue habe einen kleineren Schnitt erfordert und die schonendere Variante dargestellt. Das Operationsfeld sei bei dem in jedem Fall über ein Mikroskop durchgeführten Eingriff in beiden Fällen ausreichend ausgeleuchtet, weshalb die bei dem kleineren Schnitt über die Augenbraue verengte Sicht keinen Nachteil darstelle. Der Sachverständige hat die Frage des Zugangs letztlich als Marginalie bezeichnet und ausgeführt, dass die ursprünglich vorgesehene größere Öffnung gegenüber dem kleineren Zugang über der Augenbraue Nachteile mit sich bringe (Seite 4 des Protokolls vom 11. April 2019, Bl. 20 GA II). Diesen überzeugenden Ausführungen schließt der Senat sich an. Der Wechsel der Operationstechnik hat das Risikospektrum des tatsächlich durchgeführten Eingriffs gegenüber demjenigen, der Gegenstand der ursprünglichen Aufklärung war, nicht maßgeblich verändert. Der Kläger bedurfte keiner erneuten Aufklärung über die zu berücksichtigenden Risiken. Der ihm erteilte Hinweis darauf, dass ein anderer als der ursprünglich geplante Zugang gewählt werden würde, reichte aus, um die Wirkung des vom Kläger erteilten Einverständnisses auf den durchgeführten Eingriff zu erstrecken.
Auch die im Zusammenhang mit dem von ihm behaupteten Wechsel der Operationstechnik erhobene Beanstandung des Klägers, er sei unzureichend über das Fehlen der Routine im Hause der Beklagten zu 1) aufgeklärt worden, berührt die Wirksamkeit der Einwilligung des Klägers in die ihm zuteil gewordene Therapie nicht. Nach nicht unumstrittener Auffassung des OLG Karlsruhe kann es allerdings eine Pflicht zur Aufklärung auslösen, wenn die Operationsrisiken bei einer minimal invasiven Operation wegen der geringen Erfahrung des Operateurs mit der gewählten Technik signifikant höher sind als bei der herkömmlichen Operationsmethode (Urteil vom 23. März 2011 zu 7 U 79/10, referiert in Martis/Winkhart, Arzthaftungsrecht, 4. Aufl., RN A 132a, Seite 32). Diese Voraussetzungen sind im Streitfall weder vom Kläger dargetan noch ersichtlich. Das ergibt sich ebenfalls aus den zitierten Ausführungen des Sachverständigen. Danach ist jede Hirntumoroperation eine minimalinvasive Operation, stellt also das minimalinvasive Vorgehen keine Besonderheit in der Operationstechnik bei der Entfernung eines Hirntumors dar. Die Behandlung des Klägers ist in der Abteilung für Neurochirurgie im Hause der Beklagten zu 1) durchgeführt worden. Das Vorbringen des Klägers, dort bestehe keine Routine in der Durchführung minimalinvasiver Operationen entbehrt einer tragfähigen Grundlage, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass den Mitarbeitern der neurochirurgischen Abteilung der Beklagten zu 1) die Kompetenz für die Durchführung der zum Kerngebiet ihres Faches gehörenden Eingriffe fehlt. Der Kläger stützt sein Vorbringen darauf, dass seine Tochter, Mitarbeiterin im Hause der Beklagten zu 1), sich umgehört habe. Auf diese subjektive Einschätzung lässt sich die Feststellung eines niedrigen Erfahrungsstandes mit risikoerhöhenden Potenzial für die durchgeführte Operation nicht stützen.
bb) ASS-Medikation
Soweit der Kläger die geltend gemachte Unzulänglichkeit der Aufklärung weiterhin auf die vorangegangene Einnahme des Medikamentes ASS (Acetylsalicylsäure oder auch Aspirin) stützt, vermag dies der Berufung ebenfalls nicht zum Erfolg zu verhelfen. Die vom Landgericht getroffene Feststellung, dass ein weiteres Abwarten wegen der ASS-Medikation nicht erforderlich gewesen sei, begegnet keinen Bedenken und ist vom Kläger nicht in einer Weise angegriffen worden, die eine erneute Feststellung gemäß § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO gebietet. Der Sachverständige hat dazu ausgeführt, dass die Therapie mit ASS fünf Tage vor einem geplanten und elektiven Eingriff abgesetzt sein sollte. Jedenfalls sei die Wirksamkeit von ASS in der Regel nach einer Woche beendet. Dies begründe sich aus der Lebensdauer der Thrombozyten, deren Wirkungsweise von dem Medikament beeinträchtigt wird. Zusätzlich hat er das gewonnene Ergebnis mit der bei der Revisionsoperation aufgefunden Blutungsquelle, nämlich einer Hirnrindenarterie, begründet (Seite 10 f. und 14 des Gutachtens vom 11. September 2017).
2. Fehlen der Einwilligung in die Durchführung der Operation durch den Beklagten zu 5)
Zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass der durch den Beklagten zu 5) durchgeführte Eingriff nicht deswegen rechtswidrig war, weil die Einwilligung des Klägers auf die Behandlung durch den Beklagten zu 2) als Chefarzt der neurochirurgischen Klinik der Beklagten zu 1) beschränkt gewesen wäre. Der Abschluss einer Wahlleistungsvereinbarung, die darauf gerichtet ist, dem Kläger eine Chefarztbehandlung zuteilwerden zu lassen, ist nicht feststellbar.
Das Landgericht hat es als nicht feststellbar erachtet, dass die Einwilligung des Klägers darauf beschränkt war, dass er durch den Beklagten zu 2) operiert werde. Es hat dies damit begründet, dass mit der Wahlleistungsvereinbarung keine Chefarztbehandlung vereinbart worden sei, weil das Feld für die persönliche Behandlung durch den Chefarzt nicht angekreuzt wurde. Der Kläger habe sich gerade nicht für einen bestimmten Arzt als Operateur entschieden. Dieses Ergebnis ist durch das Vorbringen der Berufung nicht infrage gestellt.
Der Kläger hat mit der Beklagten zu 1) einen einheitlichen, so genannten totalen Krankenhausaufnahmevertrag geschlossen. Dies stellt die Regelform der stationären Krankenhausbehandlung dar (Martis-Winkhart, Arzthaftungsrecht, 4. Aufl., RN K 132e, Seite 1180, BGH, Urteil vom 11. Mai 2010, VI ZR 252/08, zitiert nach juris, RN 5). Das gilt nicht nur für Kassenpatienten, vielmehr wird auch beim privat krankenversicherten Patienten davon ausgegangen, dass dieser bei stationärer Aufnahme in eine Klinik im Regelfall den totalen Krankenhausvertrag abschließt (OLG München, Urteil vom 7. August 2000 8,1 U 4979/07, zitiert nach juris, RN 40 und 3). Davon ist auch im Streitfall auszugehen. Die Parteien haben die über die eigentliche stationäre Behandlung des privat krankenversicherten Klägers im Hause der Beklagten zu 1) errichtete Vertragsurkunde nicht vorgelegt. Die vom Kläger eingereichte Urkunde über eine am 24. April 2014 unterzeichnete Wahlleistungsvereinbarung (Anlage zum Schriftsatz vom 27. April 2017, Bl. 51 des Anlagenbandes) liefert jedoch einen deutlichen Hinweis darauf, dass die grundlegende Vereinbarung über die stationäre Behandlung des Klägers dem Regelfall des totalen Krankenhausvertrages entsprach. Unter anderem sieht diese vom Kläger eingereichte Urkunde die Möglichkeit der Vereinbarung einer wahlärztlichen Leistung in Form der persönlichen Behandlung durch den Chefarzt vor. Das erlaubt die Schlussfolgerung darauf, dass die zu Grunde liegende Vereinbarung über die stationäre Behandlung dem Regelfall entsprach, nämlich vorsah, dass der Beklagten zu 1) die Auswahl des behandelnden Arztes vorbehalten bleiben sollte.
Bei dem totalen Krankenhausvertrag hat der Patient grundsätzlich keinen Anspruch darauf, von einem bestimmten Arzt behandelt und operiert zu werden. Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Behandlungsvertrag kann sich der Krankenhausträger vielmehr grundsätzlich seines gesamten angestellten Personals bedienen. Es verbleibt dem Patienten allerdings unbenommen zu erklären, er wolle sich nur von einem bestimmten Arzt operieren lassen. In diesem Fall darf ein anderer Arzt den Eingriff nicht vornehmen. Einen Anspruch darauf, dass der gewünschte Operateur tätig wird, hat der Patient jedoch nicht. Die beim totalen Krankenhausaufnahmevertrag bestehende Situation ist von den Fällen zu unterscheiden, in denen der Patient aufgrund eines Zusatzvertrages Wahlleistungen, insbesondere die sogenannte Chefarztbehandlung, in Anspruch nimmt. In diesen Fällen ist der Arzt gegenüber dem Patienten aus einer ausdrücklichen Wahlleistungsvereinbarung verpflichtet und muss seine Leistungen gemäß § 613 S. 1 BGB grundsätzlich selbst erbringen. Insbesondere muss der als Wahlarzt verpflichtete Chirurg die geschuldete Operation grundsätzlich selbst durchführen, sofern er mit dem Patienten nicht die Ausführung seiner Kernleistungen durch einen Stellvertreter wirksam vereinbart hat (BGH, Urteil vom 11. Mai 2010, VI ZR 252/08, zitiert nach juris, RN 5 bis 7).
Die über die Wahlleistungsvereinbarungen errichtete Urkunde (Anlage zum Schriftsatz des Klägers vom 27. April 2017, Anlagenband hinter Anlage K 18) ist vom Kläger und einem Mitarbeiter der Beklagten zu 1) unterzeichnet. Es ist jedoch keines der für die jeweilige Art der vereinbarten Wahlleistung vorgesehenen Felder angekreuzt. Vor diesem Hintergrund trägt das Vorbringen des Klägers die Beschränkung seines Einverständnisses auf die Durchführung der Operation durch einen bestimmten Arzt nicht.
Der Kläger hat dazu vorgebracht, er sei davon ausgegangen, als Privatpatient selbstverständlich vom Chefarzt operiert zu werden. Auf Grundlage der Wahlleistungsvereinbarung vom 24. April 2014 sei es zum Abschluss eines privaten Behandlungsvertrages zwischen dem Beklagten zu 2) und dem Kläger gekommen. In der Berufungsbegründung wendet sich der Kläger gegen die vom Landgericht gewonnene Einschätzung mit dem Argument, dass der Wahlleistungsvereinbarung im Wege der Auslegung eine Beschränkung auf die Behandlung durch den Beklagten zu 2) zu entnehmen sei, weil diese Urkunde keinen anderen Sinn haben könne als die Vereinbarung einer Chefarztbehandlung.
Diese Sichtweise vermag nicht zu überzeugen. Abweichend von dem vom Kläger vertretenen Verständnis kann nicht davon ausgegangen werden, dass die bloße Unterzeichnung des Formulars über die Wahlleistungsvereinbarung eine Vereinbarung der Chefarztbehandlung herbeiführt, ohne dass das entsprechende Feld angekreuzt war. Die Urkunde zählt vier verschiedene Formen der Wahlleistung (Einbettzimmer, Zweibettzimmer, Unterbringung einer Begleitperson und „wahlärztliche Leistung“ in Form der Chefarztbehandlung) auf. Zwischen diesen Formen der Wahlleistung besteht kein Rangverhältnis. Es gibt keine hinreichenden Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass die Unterzeichnung einer Wahlleistungsvereinbarung auch ohne Auswahl einer der dort angebotenen Wahlleistungen nur auf die Behandlung durch den Chefarzt gerichtet sein konnte. Der Kläger beruft sich in diesem Zusammenhang auf seine Stellung als Privatpatient. Wie bereits ausgeführt, kann auch bei Privatpatienten der Abschluss des totalen Krankenhausvertrages, also die Einwilligung des Patienten in die Behandlung durch einen vom Krankenhausträger bestimmten Arzt aus seinem Personalbestand, als Regelfall bezeichnet werden. Die Stellung des Privatpatienten begründet also keine Vermutung dafür, dass der Patient die „wahlärztliche Leistung“, also die Chefarztbehandlung, wählt (vgl. auch OLG München, Urteil vom 7. August 2008,1 U 4979/07, zitiert nach juris, RN 44, wonach auch ein Privatpatient sich nicht für die Inanspruchnahme wahlärztlicher Leistungen entscheiden muss). Dementsprechend kann auch aus der Unterzeichnung einer Urkunde, die neben der Chefarztbehandlung weitere Wahlleistungen aufführt, nicht ohne weiteres und insbesondere auch ohne die ausdrücklich auf der Urkunde erklärte Auswahl gerade dieser Form der Wahlleistung entnommen werden, dass der Privatpatient die Chefarztbehandlung in Anspruch nehmen wollte.
Der Kläger hat zur Unterstützung seines Vorbringens, die Inanspruchnahme einer wahlärztlichen Leistung vereinbart zu haben, sich auf die Liquidation berufen. Die Art der Liquidation kann gerade auch im Bereich des ärztlichen Behandlungsvertrages ein wichtiges Indiz für die Bestimmung des Vertragspartners liefern (BGH, Urteil vom 31. Januar 2006, VI ZR 66/05, zitiert nach juris, RN 14). Wäre der die Blutung auslösende Eingriff vom 25. April 2014 vom Beklagten zu 2), dem Chefarzt der neurochirurgischen Abteilung der Beklagten zu 1), abgerechnet, könnte dies ein Indiz dafür liefern, dass zwischen dem Kläger und der Person, die das Formular über die Wahlleistungen für die Beklagte zu 1) unterzeichnete, Klarheit darüber herrschte, dass durch den Abschluss der Wahlleistungsvereinbarung die Inanspruchnahme der wahlärztlichen Leistung (Chefarztbehandlung) vereinbart werden sollte. Dieses Indiz liefert die vom Kläger zur Unterstützung seines Vorbringens vorgelegte Schlussrechnung vom 14. November 2014 (Anlage zu Seite 3 des Schriftsatzes vom 27. April 2017 [Bl. 49 GA I], Bl. 52-54 des Anlagenbandes) indessen nicht. Die dort abgerechnete Vergütung wird im Namen der Beklagten zu 1) geltend gemacht. Sie lässt nicht erkennen, dass der Beklagte zu 2) die Operation in Ausübung eigener Berechtigung zur Liquidation abgerechnet hat.
Weder das Formular über die Wahlleistungen noch die Schlussrechnung der Beklagten zu 1) liefern tragfähige Grundlagen für die Feststellung, dass der Kläger eine Vereinbarung über die wahlärztliche Leistung der Chefarztbehandlung abgeschlossenen hat.
Schließlich kann das Vorbringen, der Kläger habe als Privatpatient selbstverständlich erwartet, vom Chefarzt operiert zu werden, die Beschränkung der Einwilligung darauf, ausschließlich durch den Beklagten zu 2) behandelt zu werden, nicht unabhängig von einer hier nicht abgeschlossenen Wahlleistungsvereinbarung über die Chefarztbehandlung begründen. Wie bereits ausgeführt, kann der Patient bei einem totalen Krankenhausaufnahmevertrag nicht erwarten, von einem bestimmten Arzt behandelt zu werden. Wenn der Patient ausschließlich in die Operation durch einen bestimmten Arzt einwilligen will, obgleich er keinen entsprechenden Arztzusatzvertrag abgeschlossen hat, muss er eindeutig zum Ausdruck bringen, dass er nur von einem bestimmten Arzt operiert werden will. Der von einem Patienten geäußerte Wunsch oder seine subjektive Erwartung von einem bestimmten Arzt operiert zu werden, reichen nicht für die Annahme einer auf eine bestimmte Person beschränkten Einwilligung aus. Selbst wenn ein Krankenhausarzt auf Bitten des Patienten in einem Vorgespräch erklärt, er werde die Operation, sofern möglich, selbst durchführen, beschränkt sich die Einwilligung des Patienten nicht auf diesen Arzt (BGH, Urteil vom 11. Mai 2010, VI ZR 252/08, zitiert nach juris, RN 9 und 10). Im Streitfall hat sich der Kläger auf eine subjektive Erwartung berufen, die er aus seiner Stellung als Privatpatient hergeleitet hat. Eine verbindliche Zusage, die darauf gerichtet war, dass der Kläger durch den Beklagten zu 2) operiert werde, hat er nicht erreicht. Dementsprechend ist seine auf Grundlage des totalen Krankenhausaufnahmevertrages erteilte Einwilligung in die Behandlung durch einen von der Beklagten zu 1) dazu bestimmten Arzt nicht darauf eingeschränkt gewesen, ausschließlich durch den Beklagten zu 2) behandelt zu werden.
2. Behandlungsfehler
Der Kläger hält den Vorwurf des Behandlungsfehlers aufrecht, soweit es den vermeintlich unzureichenden zeitlichen Abstand der Operation zum Abbruch der vorangegangenen Medikation mit ASS betrifft. Die dazu vom Landgericht getroffene Feststellung, dass ein Behandlungsfehler nicht vorliege, hat der Kläger indessen nicht in einer Weise angegriffen, die eine erneute Feststellung gemäß § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO gebietet. Aus den bereits ausgeführten Gründen beruht die landgerichtliche Feststellung auf tragfähiger Grundlage, nämlich den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen dazu, dass der Abstand ausreichend war, die aus der Medikation folgenden Risiken nicht aufklärungsbedürftig waren und dementsprechend der Zeitpunkt der Operation im Verhältnis zum Ende der Medikation dem ärztlichen Standard entsprach.
Zusätzlich hat der Sachverständige vor dem Senat noch einmal erläutert, dass der unauffällige Verlauf der Operation und das Fehlen einer Blutungsneigung während der Operation das gewonnene Ergebnis, die vorangegangene ASS-Medikation stehe in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der schadensbegründenden Nachblutung, bestärkt. Diesen Ausführungen schließt der Senat sich an.
Im Übrigen greift die Berufungsbegründung das zu den erstinstanzlich geltend gemachten Behandlungsfehlern (so die minimalinvasive Vorgehensweise, die Reaktion auf die Komplikation und die Verlegung von der Intensivstation in die Rehabilitation) zutreffend gewonnene Ergebnis nicht an.
III
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Revision war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 543 Abs. 1 ZPO nicht vorliegen.
Die Wertfestsetzung ergibt sich aus den §§ 39 Abs. 1, 48 Abs. 1, 47 Abs. 1 GKG, 3 ZPO.