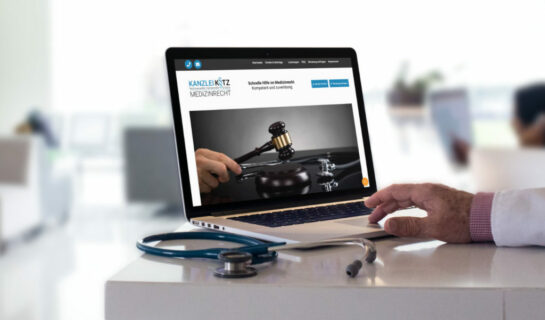Keine Schmerzensgeldzahlung für behauptete Behandlungsfehler bei Geburt
Das Gericht wies die Klage eines Patienten, der Schmerzensgeld wegen vermeintlicher Behandlungsfehler nach einem Blasensprung seiner Mutter vor der Geburt forderte, ab. Die Entscheidung begründete sich darauf, dass die geburtshilfliche Behandlung dem fachärztlichen Standard entsprach und keine Behandlungsfehler festgestellt werden konnten. Der Sachverständige bestätigte, dass die Vorgehensweise der Beklagten einschließlich der Entscheidung gegen einen Liegendtransport und die Dosierung der Periduralanästhesie standardgerecht waren. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass kein ursächlicher Zusammenhang zwischen den angeblichen Behandlungsfehlern und dem Gesundheitsschaden des Klägers bestand.
Weiter zum vorliegenden Urteil Az.: 3 O 313/20 >>>
✔ Das Wichtigste in Kürze
- Die Klage auf Schmerzensgeld wegen vermeintlicher Behandlungsfehler wurde abgewiesen.
- Die geburtshilfliche Behandlung entsprach dem fachärztlichen Standard, Behandlungsfehler wurden nicht festgestellt.
- Der Sachverständige bestätigte die Angemessenheit der Periduralanästhesie und des Verzichts auf einen Liegendtransport.
- Es wurde kein ursächlicher Zusammenhang zwischen den behaupteten Behandlungsfehlern und dem Gesundheitsschaden des Klägers erkannt.
- Die Entscheidungen des medizinischen Personals, einschließlich der Reaktion auf CTG-Werte und die Indikation zur Sectio, waren fachgerecht.
- Hinweise auf einen Infarkt des Klägers wurden nicht übersehen; ein solcher Zusammenhang wurde als unwahrscheinlich eingestuft.
- Die Behandlung und Überwachung des Klägers und seiner Mutter hielten sich an die S3-Leitlinie und aktuelle medizinische Standards.
- Das Gericht folgte den detaillierten Ausführungen des Sachverständigen und wies die Klage mit einer umfassenden Begründung ab.
Übersicht
- 1 Keine Schmerzensgeldzahlung für behauptete Behandlungsfehler bei Geburt
- 2 ✔ Das Wichtigste in Kürze
- 2.1 Fehlerhafter Umgang mit Blasensprüngen: Rechtliche Folgen
- 2.2 Der Weg zum Kreißsaal: Kein Liegendtransport vorgesehen
- 2.3 Fachärztlicher Standard und die Bewertung durch das Gericht
- 2.4 Die Diagnose und Interventionen der medizinischen Fachkräfte
- 2.5 Kein nachweisbarer Zusammenhang zwischen Behandlung und Gesundheitsschaden
- 3 ✔ FAQ: Wichtige Fragen kurz erklärt
- 4 Das vorliegende Urteil
Fehlerhafter Umgang mit Blasensprüngen: Rechtliche Folgen
Vorzeitige Blasensprünge stellen in der Geburtshilfe eine ernstzunehmende Herausforderung dar. Verabsäumt es das medizinische Personal, einen angemessenen Transport der betroffenen Patientin in die Klinik zu veranlassen, können sich daraus erhebliche Behandlungsfehler ergeben. Die Rechtsprechung hat in mehreren Fällen die Bedeutung eines unverzüglichen Liegendtransports nach Blasensprung hervorgehoben.

Dabei unterstreichen die Gerichte die Notwendigkeit, Patientinnen umfassend über die Risiken eines nicht umgehenden Klinikaufenthalts aufzuklären. Wird diese Aufklärung unterlassen und kommt es zu Komplikationen, können grobe Behandlungsfehler vorliegen. Diese können hohe Schmerzensgeldzahlungen nach sich ziehen.
Am 24. Oktober 2016 begann eine rechtliche Auseinandersetzung, die das LG Flensburg unter dem Aktenzeichen 3 O 313/20 zu entscheiden hatte. Im Zentrum des Falls stand die Klage eines Neugeborenen, vertreten durch seine Eltern, das Schmerzensgeld wegen vermeintlicher Behandlungsfehler nach einem Blasensprung seiner Mutter forderte.
Der Weg zum Kreißsaal: Kein Liegendtransport vorgesehen
Die erstgebärende Mutter wurde nach Selbsteinweisung und mit Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen in die Klinik aufgenommen. Nachdem der Blasensprung erfolgte, riet die zuständige Hebamme bei einem nächtlichen Anruf gegen einen Liegendtransport, obwohl unklar blieb, ob die niedergelassene Frauenärztin zuvor einen solchen bei Blasensprung wegen der Schädellage empfohlen hatte. Der Transport der Mutter erfolgte stehend, was später im Mittelpunkt der rechtlichen Bewertung stand.
Fachärztlicher Standard und die Bewertung durch das Gericht
Die Behandlung der Mutter und die Entscheidungen des medizinischen Personals wurden intensiv geprüft. Insbesondere die Anwendung einer Periduralanästhesie mit Ropivacain und der Verzicht auf einen Liegendtransport wurden hinterfragt. Ein Sachverständiger bestätigte jedoch, dass sowohl die Dosierung der PDA als auch die Entscheidung gegen einen Liegendtransport dem fachärztlichen Standard entsprachen und somit keine Behandlungsfehler vorlagen.
Die Diagnose und Interventionen der medizinischen Fachkräfte
Die medizinische Betreuung und Überwachung, insbesondere die Auswertung der CTG-Aufzeichnungen und die Reaktionen auf Anzeichen eines Amnioninfektionssyndroms, standen ebenfalls auf dem Prüfstand. Trotz einiger Lücken in der CTG-Aufzeichnung und der späten Diagnose eines beginnenden Amnioninfektionssyndroms folgte das Gericht der Einschätzung des Sachverständigen, dass die Handlungen des medizinischen Personals fachgerecht waren. Die Indikation für die notfallmäßige Sectio wurde als zeitgerecht und angemessen bewertet.
Kein nachweisbarer Zusammenhang zwischen Behandlung und Gesundheitsschaden
Ein wesentlicher Punkt der rechtlichen Auseinandersetzung war die Frage, ob ein direkter Zusammenhang zwischen den behaupteten Behandlungsfehlern und dem Gesundheitsschaden des Klägers, insbesondere dem festgestellten Infarkt, besteht. Das Gericht folgte der Argumentation der Beklagten und des Sachverständigen, dass kein solcher Kausalzusammenhang nachgewiesen werden konnte. Insbesondere wurde festgestellt, dass die erhobenen medizinischen Befunde keinen Hinweis auf eine präpartale Schädigung des Klägers boten.
Das LG Flensburg wies die Klage ab und betonte, dass die geburtshilfliche Behandlung den gebotenen fachärztlichen Standards entsprach und somit keine Grundlage für Schadensersatzansprüche bestand. Der Kläger wurde zur Tragung der Kosten des Rechtsstreits verpflichtet.
Das Urteil des LG Flensburg unterstreicht die Bedeutung fachärztlicher Standards und die Notwendigkeit, einen direkten Kausalzusammenhang zwischen behaupteten Behandlungsfehlern und einem Gesundheitsschaden nachzuweisen.
✔ FAQ: Wichtige Fragen kurz erklärt
Was definiert einen Behandlungsfehler im medizinischen Kontext?
Ein Behandlungsfehler im medizinischen Kontext ist definiert als eine medizinische Behandlung, die nicht nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen Standards erfolgt ist. Der medizinische Standard entspricht dabei dem gesicherten Stand der Wissenschaft auf dem jeweiligen medizinischen Fachgebiet. Ein Behandlungsfehler kann sowohl durch aktives Tun als auch durch Unterlassen entstehen und umfasst verschiedene Formen wie Diagnosefehler, Therapiefehler, Aufklärungsfehler und Organisationsfehler.
Ein ärztlicher Fehler liegt vor, wenn der Arzt vom geltenden Behandlungsstandard abweicht, der durch den Stand der Medizin zum Zeitpunkt der jeweiligen Behandlung definiert wird. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine gebotene medizinische Untersuchung oder Behandlung unterlassen oder mit mangelnder Sorgfalt ausgeführt wird, oder wenn ein Eingriff vorgenommen wird, der medizinisch nicht indiziert war.
Die Bewertung, ob ein Behandlungsfehler vorliegt, erfolgt anhand der Krankenunterlagen und weiterer Dokumente, die den aktuellen Stand der Medizin widerspiegeln. Bei der Begutachtung eines Behandlungsfehlers wird auch geprüft, ob ein Schaden entstanden ist und ob dieser kausal auf den Behandlungsfehler zurückzuführen ist.
Patienten haben das Recht, die Behandlung juristisch und medizinisch auf mögliche Fehler überprüfen zu lassen. Bei Verdacht auf einen Behandlungsfehler kann ein medizinisches Gutachten durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen erstellt werden, das interessenneutral und für die Versicherten kostenfrei ist.
Welche Rolle spielt die fachärztliche Einschätzung bei der Bewertung medizinischer Maßnahmen?
Die fachärztliche Einschätzung spielt eine zentrale Rolle bei der Bewertung medizinischer Maßnahmen, insbesondere im Kontext von Begutachtungen und Beurteilungen. Fachärzte bringen ihre Expertise ein, um den medizinischen Sachverhalt zu klären und eine fundierte Beurteilung der Situation eines Patienten zu ermöglichen.
Rolle des Gutachters
Medizinische Sachverständige, wie sie in den Dokumenten beschrieben werden, haben die Aufgabe, objektive und wissenschaftlich fundierte Einschätzungen zu liefern. Sie unterstützen damit Gerichte, Versicherungen und andere Institutionen bei der Entscheidungsfindung in medizinischen Fragen. Die Gutachter müssen dabei die medizinischen Fakten für Laien verständlich darstellen und dürfen keine therapeutischen Leistungen verordnen oder erbringen.
Qualitätssicherung und Objektivität
Die Qualität und Objektivität der fachärztlichen Einschätzung wird durch Leitlinien und Standards gesichert, die eine willkürliche und wissenschaftlich nicht hinreichend begründete Einschätzung verhindern sollen. Gutachter müssen sich an diese Normen halten und ihre Einschätzungen nach den Regeln der medizinischen Kunst erstellen, sodass sie sowohl rechtlichen als auch medizinischen Ansprüchen genügen.
Entscheidungsfindung
Die fachärztliche Einschätzung ist entscheidend für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit, der Notwendigkeit von Rehabilitationsmaßnahmen oder der Erwerbsminderung. Sie beeinflusst somit maßgeblich die Entscheidungen von Sozialversicherungsträgern und anderen Institutionen.
Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist wichtig, um eine umfassende Beurteilung zu gewährleisten. Fachärzte arbeiten dabei oft mit anderen Spezialisten zusammen, um ein ganzheitliches Bild der medizinischen Situation zu erhalten.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Fachärzte müssen sich bei der Begutachtung an rechtliche Vorgaben halten und dürfen beispielsweise nicht in die ärztliche Behandlung eingreifen oder therapeutische Maßnahmen anordnen. Sie müssen auch die Entscheidungskompetenz der Durchführungsstellen im medizinischen Abklärungsprozess beachten.
Auswirkungen auf Patienten
Die fachärztliche Einschätzung hat direkte Auswirkungen auf die Patienten, da sie über die Gewährung von Sozialleistungen oder die Notwendigkeit weiterer medizinischer Maßnahmen entscheidet. Sie trägt damit zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit und zur Verbesserung der Lebensqualität der Patienten bei.
Zusammenfassend ist die fachärztliche Einschätzung ein unverzichtbarer Bestandteil der medizinischen Begutachtung und Bewertung, der auf fundiertem Fachwissen basiert und nach strengen Qualitätsstandards erfolgt. Sie dient als Grundlage für rechtliche und soziale Entscheidungen und hat somit eine weitreichende Bedeutung für das Gesundheitssystem und die betroffenen Individuen.
Das vorliegende Urteil
LG Flensburg – Az.: 3 O 313/20 – Urteil vom 16.12.2022
Die Klage wird abgewiesen.
Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Der Kläger begehrt Schmerzensgeld und die Feststellung einer Schadensersatzpflicht wegen einer vermeintlich fehlerhaften geburtshilflichen Behandlung.
Am 24.10.2016 (37+4 SSW) wurde die damals 37jährige erstgebärende Mutter des Klägers, Frau J S (im Folgenden auch: die Mutter) nach Selbsteinweisung wegen Übelkeit, Erbrechen und Wehen mittels Rettungswagens erstmals bei der Beklagten aufgenommen. Der errechnete Geburtstermin war der 10.11.2016. Die Untersuchungen ergaben einen Blutdruck von 125/90 mmHg, einen Puls von 66/min, eine Temperatur von 37,1 Grad, das Kardiotokogramm (CTG, im Folgenden auch für Kardiotokografie) zeigte unregelmäßige Wehen, die fetale Herzkurve war unauffällig. Die Sonografie zeigte eine zeitgerecht entwickelte Schwangerschaft mit einem Fetus in II. Schädellage, Vorderwandplazenta und Fruchtwassermenge waren unauffällig. Das Labor ergab eine leichte Leukozytose (13,15 Tsd./µl), eine leichte Anämie (11,0 g/dl) und einen CRP-Wert von 11,3 mg/l. Die Mutter wurde zunächst auf die Quarantäne-Station 1 aufgenommen, da initial eine Infektion nicht auszuschließen war. Weitere CTG waren unauffällig, die Mutter wurde am Folgetag zunächst entlassen.
Zwischen dem 25.10.2016 und dem 05.11.2016 erfolgten mehrere Untersuchungen der Mutter bei der Beklagten, unter anderem durch CTG. Am 01.11.2016 wurden die Eltern des Klägers in die Unterkunft für Insulaner im Schwesternwohnheim auf dem Krankenhausgelände der Beklagten aufgenommen. An diesem Tag wurde die Mutter zudem durch die niedergelassene Frauenärztin Dr. T in N untersucht. Diese Untersuchung ergab keine Auffälligkeiten. Ob Dr. T den Rat gab, die Mutter im Fall eines Blasensprungs liegend zu transportieren, weil eine Schädellage bestehe, ist zwischen den Parteien streitig.
Am 06.11.2016 (39+2 SSW) zwischen 00:30 und 01:00 Uhr erfolgte der Sprung der Fruchtblase. Bei einem Anruf im Kreißsaal der Beklagten erklärte die Hebamme, die Eltern sollten sich langsam auf den Weg machen, der Transport müsse aber nicht liegend erfolgen, es sei nur ein Fußweg von 10 min. Nach Ankunft der Eltern erfolgten Eingangsuntersuchungen, CTG und Labor. Einzelheiten des weiteren Ablaufs sind zwischen den Parteien streitig. CTG-Kontrollen erfolgten von jeweils ca. 02:44 bis 04:10 Uhr, 06:40 bis 07:10 Uhr, 09:30 bis 11:20 Uhr, 11:24 bis 11:30 Uhr, 11:40 bis 13:17 Uhr und 13:50 bis 15:15 Uhr. Gegen 11:50 Uhr wurde der Mutter eine Periduralanästhesie (PDA) angelegt bei einer Dosierung des verwendeten Lokalanästhetikums Ropivacain von 8 mg. Die Körpertemperatur der Mutter wurde um 13:50 Uhr mit 36,7 Grad Celsius, um 15:00 Uhr mit 38,9 Grad Celsius und um 15:08 Uhr mit 39 Grad Celsius gemessen. Blutwerte der Mutter von Entnahmen um 03:41 Uhr und 14:40 Uhr wurden im Labor ausgewertet; wegen der Ergebnisse wird auf den als Anlage (Blatt 86 der Akte) eingereichten „Kumulativ-Bericht“ Bezug genommen. Nach einer Untersuchung um 15:08 Uhr traf der Oberarzt F wegen des eingeengten CTG und eines Amnioninfektionssyndroms die Entscheidung für eine umgehende Kaiserschnittentbindung (Sectio caesarea). Wegen der weiteren Einzelheiten der erfolgten Untersuchungen und ihrer Ergebnisse wird auf deren Darstellung im schriftlichen Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. L vom 07.03.2022 (Seiten 5 ff., 19 f. des Gutachtens) Bezug genommen.
Um 15:38 Uhr wurde der Kläger aus Schädellage mit einem Geburtsgewicht von 3.610 g entbunden. Die Bewertung nach APGAR erfolgte mit 6/8/9, der pH-Wert des arteriellen Nabelschnurbluts betrug 7,27, beschrieben wurde eine zweimalige Nabelschnurumschlingung um den Hals.
Wegen Fiebers, leichten Anpassungsstörungen und Apnoen bei Sauerstoffsättigung wurde der Kläger unter dem Verdacht eines Amnioninfektionssyndroms in die Kinderklinik des W…klinikums H verlegt. Um 17:15 Uhr traf das neonatologische Team des W…klinikums ein und übernahm den Kläger in die weitere Betreuung. Im W…klinikums erfolgten weitere Untersuchungen des Klägers, unter anderem eine Eingangsblutuntersuchung. Wegen der Ergebnisse dieser Untersuchungen wird auf den auf den 07.11.2016 datierten Entlassungsbericht des W…klinikums Bezug genommen. Am 09.11.2016 (4. LT) erfolgte eine craniale Magnetresonanztomografie (MRT), diagnostiziert wurde ein „frischer Infarkt im Versorgungsgebiet des Ramus calcarinus und Ramus parietooccipitalis rechts“, die Ärzte führten die rezidivierenden Apnoen hierauf zurück. Am 28.11.2016 wurde der Kläger aus der stationären Behandlung entlassen.
Der Kläger rügt das Geburtsmanagement der Beklagten als fehlerhaft.
Er behauptet, bereits der Umstand, dass seiner Mutter am 06.11.2016 nach dem Blasensprung kein Liegendtransport vom Schwesternwohnheim auf dem Krankenhausgelände zum Kreißsaal angeboten worden sei, sei behandlungsfehlerhaft. Die niedergelassene Frauenärztin Dr. T habe deshalb den Rat gegeben, die Mutter im Fall eines Blasensprungs liegend zu transportieren, weil eine Schädellage bestehe. Fehlerhaft sei zudem, dass nach dem Eintreffen kein Kreißsaal und keine Liege zur Verfügung gestanden habe.
Der Kläger behauptet weiter, die Dosierung von 8 mg Ropivacain zur PDA seiner Mutter sei zu hoch gewesen.
Behandlungsfehlerhaft sei weiter, dass eine diensthabende Hebamme mehrere Schwangere gleichzeitig behandelt habe, weshalb die Mutter des Klägers zeitweise nicht betreut worden sei.
Darüber hinaus rügt der Kläger eine unzureichende Befunderhebung: Zum einen sei die Befunderhebung mittels CTG unzureichend gewesen. Hierzu behauptet der Kläger, nach Anlegen der PDA seien wegen eines verrutschten CTG über einen Zeitraum von 30 min überhaupt keine Herztöne aufgezeichnet worden, es sei keine Wehentätigkeit mehr erkennbar gewesen. Zum anderen seien Anzeichen für ein Amnioninfektionssyndrom verkannt bzw. zu spät erkannt worden, die für die Diagnosestellung eines Amnioninfektionssyndroms erforderlichen Befunde seien nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden.
Schließlich rügt der Kläger die Reaktion der Ärzte und Hebammen der Beklagten auf die erhobenen Befunde als fehlerhaft: Das Personal der Beklagten habe unzureichend auf die Werte der kindlichen Herzkurve, die Laborwerte (Leukozyten und CRP) und die Körpertemperatur der Mutter reagiert. Die Indikation für eine umgehende sekundäre Sectio sei angesichts der Gesamtsituation (relativer Geburtsstillstand, Verdacht auf ein relatives Missverhältnis, beginnende fetale Tachykardie, ansteigende Körpertemperatur und ansteigende Infektparameter) bei dringendem Verdacht auf ein beginnendes Amnioninfektionssyndrom zu spät gestellt worden. Darüber hinaus habe das Personal der Beklagten bei der peripartalen Überwachung des Klägers und seiner Mutter Hinweise auf einen Infarkt des Klägers verkannt.
Der Kläger führt seinen Gesundheitsschaden, den Infarkt und dessen Folgen, auf die gerügten Behandlungsfehler zurück. Jedenfalls habe der Gesundheitsschaden bei fehlerfreier Behandlung, etwa durch eine frühere Kaiserschnittentbindung, in einem erheblichen Maß reduziert werden können. Er meint, der behauptete Ausfall des CTG, die fehlende Behandlung seiner Mutter und die verzögerte Indikation zur Sectio seien grobe Behandlungsfehler, weshalb die Ursächlichkeit dieser Fehler für seinen primären Gesundheitsschaden vermutet werde. Der Kläger trägt vor, aufgrund des Infarkts leide er unter Atemaussetzern mit dauerhaften Einschränkungen. Wegen dieser drohenden Atemaussetzer habe er dauerhaft eine Sauerstoffflasche nebst dazugehörigen Instrumenten (Monitor, Beatmungsbeutel, Gerät zum Befüllen der Flasche) bei sich tragen müssen, um weitere Schlaganfälle zu verhindern. Zwischenzeitlich sei er in einem erstaunlich guten Zustand, dürfe allerdings keine Körpertemperatur über 38,5 Grad über mehr als 48 Stunden haben oder sonst direkter Hitze ausgesetzt sein, es bestehe ein erhöhtes Thromboserisiko. Hierfür hält der Kläger ein Schmerzensgeld von mindestens 150.000 € für angemessen.
Der Kläger beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger zu Händen der Kindeseltern ein angemessenes Schmerzensgeld, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, den Betrag von 150.000 € indes nicht unterschreiten sollte, nebst 5 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen;
2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger zu Händen der Kindeseltern jedweden weiteren unvorhersehbaren immateriellen wie auch materiellen Schaden, der dem Kläger aus dem schadensstiftenden Ereignis im Zeitraum vom 25. Oktober bis 06. November 2016 entstanden ist, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht bereits auf Sozialversicherungsträger oder andere Dritte übergegangen sind.
Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.
Die Beklagte bestreitet Behandlungsfehler bei der geburtshilflichen Behandlung des Klägers und seiner Mutter.
Nach der S3-Leitlinie der DGGG „Vaginale Geburt am Termin“ werde gerade keine Empfehlung für oder gegen das Hinlegen nach vorzeitigem Blasensprung gegeben. Auch zum Zeitpunkt der Behandlung sei der Hinweis, der Transport vom Wohnheim in den Kreißsaal müsse nicht liegend erfolgen, standardgerecht gewesen.
Auch die als fehlerhaft gerügte Dosierung von 8 mg Ropivacain zur Periduralanästhesie der Mutter entspreche der regulären Dosis.
Organisationsfehler seien der Beklagten nicht vorzuwerfen. Eine diensthabende Hebamme könne durchaus mehrere Schwangere gleichzeitig betreuen. Unabhängig davon sei die Mutter des Klägers im Kreißbett häufig und regelmäßig betreut worden. Eine durchgehende medizinische Betreuung durch eine Hebamme sei medizinisch nicht notwendig gewesen.
Auch die Befunderhebung sei nicht fehlerhaft gewesen. Nur für 13:36 bis 13:47 Uhr (und 14:43 Uhr bis 14:48 Uhr wegen vaginaler Untersuchung) liege keine CTG-Aufzeichnung vor, die Ursache hierfür sei unbekannt. Allerdings bestehe kein Zusammenhang mit der Indikationsstellung zur Sectio, zumal sich die Muster der fetalen Herzfrequenzkurve vor und nach diesem Zeitraum relativ exakt entsprächen. Ohnehin bestehe keine medizinische Notwendigkeit zur Durchführung einer ununterbrochenen Herztonaufzeichnung. Alle erforderlichen Befunde seien standardgerecht erhoben, Anzeichen für ein Amnioninfektionssyndrom nicht verkannt worden.
Auf die erhobenen Befunde habe das Personal der Beklagten auch fach- und zeitgerecht reagiert. Insbesondere sei die Indikation für die Sectio fach- und zeitgerecht gestellt worden. Bei der peripartalen Überwachung des Klägers und seiner Mutter seien auch keine Hinweise auf einen Infarkt des Klägers verkannt worden. Aus den erhobenen Befunden habe sich kein Hinweis auf eine präpartale Schädigung des Klägers ergeben. Dies sei nach dem postpartalen Befund auch nicht zu erwarten gewesen: Durch den Hirninfarkt sei vermutlich das kindliche Atemzentrum betroffen worden, darauf gebe es peripartal keinen Hinweis, weil das Kind naturgemäß intrauterin nicht atme.
Jedenfalls bestehe kein Ursachenzusammenhang zwischen den angeblichen Behandlungsfehlern und dem Hirninfarkt des Klägers als primärem Gesundheitsschaden.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Die Kammer hat aufgrund des Beweisbeschlusses vom 17.12.2021 (Blatt 58 der Akte) Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens. Wegen des Ergebnisses wird auf das schriftliche Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. L vom 07.03.2022 (Sonderband) Bezug genommen. Der Sachverständige hat sein Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt. Wegen des Ergebnisses wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung am 01.12.2022 (Blatt 97 der Akte) Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
I. Die Klage ist nicht begründet.
1. Der Kläger hat bereits dem Grunde nach keinen Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgelds gegen die Beklagte. Ein solcher Anspruch folgt nicht aus § 280 Abs. 1, § 630a Abs. 1, §§ 278, 253 Abs. 2 BGB.
a) Zwischen der Mutter des Klägers und der Beklagten bestand ein Behandlungsvertrag iSd. § 630a Abs. 1 BGB über die Leistung der Geburtshilfe. Bei Behandlungsverträgen über die Geburtshilfe ist immer auch das Kind, hier der Kläger, in den Schutzbereich des Behandlungsvertrags mit der Mutter einbezogen (statt vieler BGH, Urteil vom 08.11.2005 – VI ZR 319/04, juris).
b) Die Mitarbeiter der Beklagten haben keine Pflicht aus dem Behandlungsvertrag verletzt. Die geburtshilfliche Behandlung des Klägers und seiner Mutter entsprach dem gebotenen fachärztlichen Standard. Behandlungsfehler sind nicht festzustellen. Dies steht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur Überzeugung der Kammer iSd. § 286 Abs. 1 ZPO fest. Die Kammer stützt sich insoweit auf die durchweg nachvollziehbaren und überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. L in seinem schriftlichen Gutachten vom 07.03.2022 und dessen Erläuterung und Ergänzung in der mündlichen Verhandlung am 01.12.2022. Der Sachverständige ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Chefarzt der Frauenklinik des …klinikums in H. An seiner Sachkunde bestehen keine Zweifel. Im Einzelnen:
aa) Ohne Erfolg rügt der Kläger als behandlungsfehlerhaft, dass seiner Mutter am 06.11.2016 nach dem Blasensprung kein Liegendtransport vom Schwesternwohnheim auf dem Krankenhausgelände zum Kreißsaal angeboten worden sei. Hierzu hat der Sachverständige auf die aktuelle S3-Leitlinie „Vaginale Geburt am Termin“ von 2020 hingewiesen, in der eine solche Empfehlung nicht ausgesprochen werde, und erklärt, dass dies auch dem geburtshilflichen Standard im Jahr 2016 entsprochen habe. Hintergrund des früher oft gegebenen Rates eines Liegendtransports nach Blasensprung sei die theoretische, praktisch aber extrem seltene Komplikation eines Nabelschnurvorfalls, also eines Verrutschens der Nabelschnur am führenden Teil des Kindes vorbei in den Geburtskanal – wegen der drohenden Kompression der Nabelschnur sei dies ein geburtsmedizinischer Notfall. Der Sachverständige hat ausgeführt, dass es bei einem Blasensprung einer Erstgebärenden in der Nähe des errechneten Geburtstermins, bei der ohne Wehen der Muttermund noch geschlossen oder nur leicht geöffnet sei und der führende kindliche Teil den Ausgang der Gebärmutter am Muttermund verschließe, keinen triftigen medizinischen Grund gebe, der Patientin einen Liegendtransport zu empfehlen. Die Kammer hat dies nachvollzogen und ist hiervon überzeugt. Im Übrigen hat der Sachverständige ausgeführt, dass es bei dem Kläger auch zu keinem Nabelschnurvorfall gekommen war – die bei der Entbindung festgestellte Nabelschnurumschlingung sei etwas anderes und praktisch ohne Bedeutung, weil sie nicht zu einer Sauerstoffunterversorgung des Kindes geführt habe.
bb) Ebenfalls ohne Erfolg rügt der Kläger, die Dosierung von 8 mg Ropivacain zur PDA seiner Mutter sei zu hoch gewesen. Nach den unmissverständlichen Ausführungen des Sachverständigen entsprach die Dosierung von 8 mg Ropivacain zur PDA der Mutter dem ärztlichen Standard und lag sogar eher im unteren Bereich der üblichen Spanne der Dosierung
cc) Der Umstand, dass die diensthabende Hebamme mehrere Schwangere gleichzeitig und nicht die Mutter des Klägers allein behandelte, stellt ebenfalls keine Unterschreitung des geburtshilflichen Standards dar. Der Sachverständige hat überzeugend dargestellt, dass in der aktuellen S3-Leitlinie „Vaginale Geburt am Termin“ von 2020 zwar erste Hinweise auf eine interventionsarme Geburt bei einer 1:1-Betreuung ausgewertet worden seien. Gleichwohl gebe es weder 2016 noch heute einen festgeschriebenen Standard zu einem genauen Hebammen- oder Arztschlüssel im Kreißsaal. Es entspreche sowohl 2016 als auch heute dem geburtshilflichen Standard und der Realität in der Geburtsmedizin, wenn eine diensthabende Hebamme mehrere Schwangere gleichzeitig betreue.
dd) Soweit der Kläger eine unzureichende Befunderhebung rügt, bleibt dies ebenfalls ohne Erfolg. Weder ist eine unzureichende Befunderhebung mittels CTG festzustellen noch eine unzureichende Befunderhebung für die Diagnosestellung eines aufkommenden Amnioninfektionssyndroms (AIS):
(1) Der Sachverständige hat in seinem schriftlichen Gutachten die dokumentierten CTG-Aufzeichnungen vom 24.10.2016 bis 06.11.2016 genau dargestellt. Die Behauptung des Klägers, nach Anlegen der PDA und der Gabe von Ropivacain sei auf dem CTG keine Wehentätigkeit mehr erkennbar gewesen, hat der Sachverständige dabei nicht bestätigt. Er hat das CTG nach dem FIGO-Score (Parameter: fetale Herzgrundfrequenz, Frequenzbandbreite, Vorhandensein und Art von Dezelerationen und Akzelerationen) in drei Klassen (normal, suspekt, pathologisch) ausgewertet. Nach den Feststellungen des Sachverständigen gibt es eine Aufzeichnungslücke zwischen 13:37 Uhr und 13:50 Uhr am 06.11.2016, die Aufzeichnung endet gegen 15:15 Uhr mit der Fahrt der Mutter in den OP. Nach den Erläuterungen des Sachverständigen entspricht diese Befunderhebung mittels CTG in Dauer und Häufigkeit der Durchführung dieser Untersuchung dem geburtsmedizinischen Standard.
(2) Nach den Ausführungen des Sachverständigen sind auch die zur Diagnose eines aufkommenden AIS erforderlichen Befunde in ausreichendem Maß erhoben worden. Hierzu hat der Sachverständige zunächst erläutert, dass ein AIS die Entzündung der Gebärmutterfruchthülle beschreibe, was nicht selten sei. Ein solches AIS werde etwa festgestellt anhand des Fiebers der Mutter, der Erhöhung des Pulses der Mutter oder auch der Erhöhung des Pulses des Kindes. Der Sachverständige hat anschließend die Befundergebnisse im Zusammenhang der Diagnose eines AIS beim Kläger und seiner Mutter dargestellt. Den Verlauf dieser Befunderhebung hat der Sachverständige als zeitlich und qualitativ nicht standardunterschreitend beurteilt. Zwar fehle eine Körpertemperaturmessung zu Beginn der Kreißsaalaufnahme, eine spätere Messung habe jedoch noch einen normalen Befund ergeben, weshalb davon auszugehen sei, dass die Eingangstemperatur auch normal gewesen wäre. Insbesondere sei der Umstand, dass bei der Bestimmung der Blutwerte bei Aufnahme in den Kreißsaal um 03:41 Uhr nur die Basiswerte, nicht aber der CRP-Wert bestimmt worden seien, nicht fehlerhaft. Der Blasensprung habe zu diesem Zeitpunkt erst wenige Stunden zurückgelegen, sonstige Hinweise auf eine Infektion habe es nicht gegeben. Ohne solche Hinweise gebe es keinen fachärztlichen Standard, den CRP-Wert bei Aufnahme in den Kreißsaal automatisch mitzubestimmen, auch wenn dies unterschiedlich gehandhabt werde. Demgegenüber habe es für die Bestimmung der Blutwerte einschließlich des CRP um 14:40 Uhr einen Grund gegeben – um 14:35 Uhr sei die Mutter tachykard gewesen und habe gefroren. Der Sachverständige hat weiter ausgeführt, dass auch vor 14:40 Uhr eine Blutentnahme möglich gewesen wäre und vorstellbar sei, dass bereits eine Stunde früher ebenfalls ein CRP-Anstieg festzustellen gewesen wäre. Allerdings habe nach dem vorliegenden, auf Seite 25 f. des schriftlichen Gutachtens dargestellten Ablauf kein Grund bestanden, vor 14:35 Uhr eine Blutentnahme zu veranlassen. Zwar sei bereits ab 13:50 Uhr eine beginnende Herzfrequenztachykardie des Kindes festzustellen gewesen – dies begründe aber grundsätzlich keine akute Gefahr für das Kind, anders als wenn die Herzfrequenz abfiele. Zwar sei auch die Tachykardie auffällig und bedürfe der Abklärung, es habe aber kein unmittelbarer Handlungsbedarf bestanden. Eine Blutentnahme zur Prüfung des CRP-Wertes vor 14:35 Uhr sei medizinisch nicht geboten gewesen. Insgesamt unterschreite die Befunderhebung in Bezug auf die Diagnose eines AIS den geburtshilflichen Standard nicht. Die Kammer hat die klaren Ausführungen des Sachverständigen nachvollzogen und ist von der Richtigkeit seiner Einschätzung überzeugt.
ee) Schließlich ist auch ein Behandlungsfehler bei der Reaktion der Ärzte und Hebammen der Beklagten auf die erhobenen Befunde nicht festzustellen.
(1) Der Sachverständige hat erläutert, das Personal der Beklagten habe behandlungsfehlerfrei auf die Werte der kindlichen Herzkurve, die Laborwerte (Leukozyten und CRP) und die Körpertemperatur der Mutter reagiert, die Entscheidung für eine Kaiserschnittentbindung sei nicht zu spät gestellt worden. Hierzu hat der Sachverständige erklärt, im Fall der Diagnose eines aufkommenden AIS sollte die Geburt baldigst stattfinden, um das Kind und die Mutter behandeln zu können. Es handele sich aber nicht um einen Notfall. Ein AIS führe nicht zu einer Notfallsectio, es komme nicht auf Minuten an. Man solle die Geburt aber innerhalb von 30-60 min anstreben. Der Sachverständige hat das CTG nach dem FIGO-Score (Parameter: fetale Herzgrundfrequenz, Frequenzbandbreite, Vorhandensein und Art von Dezelerationen und Akzelerationen) ausgewertet. Nach der gutachterlichen Beurteilung sei das CTG ab ca. 14:40 Uhr als pathologisch (fetale Tachykardie) zu bezeichnen. Neben dem Labor der Blutentnahme um 14:35 Uhr (Erhöhung des CRP-Werts) sei dann um 15:00 Uhr ein weiterer Hinweis auf ein AIS dokumentiert, nämlich beginnendes Fieber mit 38,9 Grad. Diese Hinweise seien erkannt und bei der Untersuchung um 15:08 Uhr als beginnendes Amnionsinfektionssyndrom eingestuft worden. Da der Muttermund zu diesem Zeitpunkt nur ca. 7 cm geöffnet gewesen und mit einer unmittelbaren Geburt des Kindes nicht zu rechnen gewesen sei, sei richtigerweise die Entscheidung zur Geburtsbeendigung durch sekundäre Sectio getroffen worden. Die Entscheidung zur Kaiserschnittentbindung sei dann sofort getroffen worden, die Entbindung des Klägers um 15:38 Uhr sei im genannten Zeitfenster erfolgt. Insgesamt seien bei diesem Verlauf keine Abweichungen vom ärztlichen Standard und keine vorwerfbaren Fehler erkennbar. Die Ausführungen des Sachverständigen hierzu waren ebenfalls nachvollziehbar und für die Kammer überzeugend.
(2) Es ist auch nicht festzustellen, dass das Personal der Beklagten bei der peripartalen Überwachung des Klägers und seiner Mutter Hinweise auf einen Infarkt des Klägers verkannt hat. Der Sachverständige hat hierzu erläutert, dass nicht festzustellen sei, ob der Kläger den Infarkt überhaupt vor der Entbindung erlitt. Ein etwaiger intrauteriner Infarkt führe jedenfalls nicht zu maternalen Symptomen. Dies sei ein extrem seltenes Ereignis, verlässliche Aussagen zu Veränderungen fetaler Parameter (etwa im CTG) gebe es nicht. Prinzipiell sei es vorstellbar, dass sich ein solcher Infarkt in utero im CTG gar nicht bemerkbar mache, weil die Herz-Kreislauffunktionen hiervon nicht zeitnah betroffen würden. Es sei aber auch vorstellbar, dass sich je nach Ausmaß des Infarktgeschehens pathologische Zeichen im CTG fänden, aber in erster Linie fetale Bradykardien oder schwere Dezelerationen oder ein deutlicher Oszillationsverlust bis hin zur silenten Herzfrequenzkurve. Derartige hochgradig pathologische Veränderungen im Geburts-CTG seien hier aber nicht aufgetreten. Bei der Überwachung des Klägers und seiner Mutter habe es also keine Hinweise auf einen fetalen Infarkt in utero gegeben, welche das Personal der Beklagten hätten verkennen können. Auch von dieser Einschätzung des Sachverständigen ist die Kammer überzeugt.
c) Mangels eines Behandlungsfehlers bei der geburtshilflichen Behandlung des Klägers und seiner Mutter bedarf es keiner Feststellungen zur Ursache der primären Gesundheitsbeeinträchtigung des Klägers, des Infarkts im Versorgungsgebiet des Ramus calcarinus und Ramus parietooccipitalis rechts, durch Einholung eines neuropädiatrischen Gutachtens.
Nur der Vollständigkeit halber soll hier festgehalten werden, dass der Sachverständige ausgeführt hat, eine Infektion (hier das AIS) könne grundsätzlich durch Beeinflussung der Blutgerinnung eine Thrombosierung herbeiführen; dies sei aber eine absolute Rarität sei, eine weitere Ursache sei zu vermuten, normalerweise sei ein solcher Infarkt nicht mit einem AIS verknüpft. Allerdings weise das Labor des Blutes des Klägers vom 06.11.2016 um 20:16 Uhr (ca. 5 Stunden nach der Geburt) keine erhöhten CRP-Werte auf. Der Vergleich der Blutwerte des Klägers nach der Geburt mit den Blutwerten der Mutter widerspreche der Annahme, dass auch der Kläger eine Infektion gehabt habe. Eine solche ergebe sich auch nicht aus den Behandlungsunterlagen des WKK: Hier laute die Diagnose zwar AIS. Dies betreffe allerdings die Infektion der Mutter, nicht des Klägers. Bei der Mikrobiologie und einer Blutuntersuchung seien keine Keime festgestellt worden, der Kläger sei wegen der Infektion der Mutter – also vorsorglich – antibiotisch behandelt worden. Auch nach diesen Behandlungsunterlagen werde keine Infektion des Klägers beschrieben.
2. Mangels Schadensersatzanspruchs dem Grunde nach hat der Kläger auch weder einen Anspruch auf die begehrten Rechtshängigkeitszinsen noch auf die Feststellung einer Pflicht der Beklagten zum Ersatz weiterer immaterieller und materieller Schäden.
II. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.