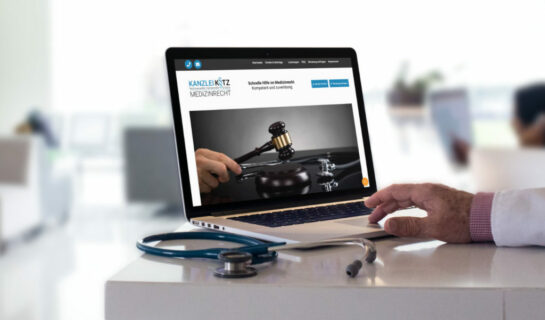Ein medizinischer Behandlungsfehler und seine juristischen Folgen
In einem Fall, der sowohl das medizinische als auch das juristische Fachwissen auf die Probe stellt, befasst sich das Oberlandesgericht Braunschweig mit einer Klage gegen eine Allgemeinmedizinerin. Die Klägerin, eine Frau mit dem Gilles-de-la-Tourette-Syndrom und einer Vorgeschichte von Herzproblemen, wirft der Medizinerin vor, sie zwischen dem 10. und 20. September 2004 fehlerhaft behandelt zu haben. Sie fordert Schmerzensgeld und Schadensersatz. Die zentrale Frage, die das Gericht zu beantworten hat, ist, ob die Ärztin ihren professionellen Pflichten nachgekommen ist und die geeigneten Schritte unternommen hat, um die Gesundheit der Klägerin zu schützen.
Direkt zum Urteil Az: 9 U 67/18 springen.
Übersicht
Die Vorwürfe und der Hintergrund
Die Klägerin behauptet, dass die Ärztin nachlässig gehandelt hat, als sie die Klägerin nach einer Selbstverletzung behandelte. Dieser Vorfall ereignete sich während eines Anfalls des Gilles-de-la-Tourette-Syndroms, einer neurologischen Erkrankung, bei der die Patientin sich unkontrolliert auf die Lippe schlug und beißte. Die Klägerin behauptet, dass die Ärztin trotz ihrer Kenntnis von der Selbstverletzung und dem geschwollenen Zustand der Lippe keine klinische Untersuchung durchführte und den Herzpass der Klägerin ignorierte, der auf ein erhöhtes Endokarditis-Risiko hinwies.
Die ärztliche Behandlung und ihre Folgen
Einige Tage später besuchte die Klägerin, erneut unterstützt von zwei Betreuern, die Praxis der Beklagten. Die Ärztin impfte sie gegen Tetanus und Diphtherie und verschrieb ein Lokalanästhetikum für die Lippe und ein Medikament gegen Durchfall, leitete jedoch keine weitere Therapie ein. Kurze Zeit später wurde die Ärztin darüber informiert, dass die Klägerin sich an der Hand selbst verletzt hatte, woraufhin sie die Patientin an einen Facharzt für Chirurgie überwies.
Das Urteil und seine Auswirkungen
Das OLG Braunschweig bestätigte in seinem Urteil die Entscheidung des Landgerichts Braunschweig und wies die Berufung der Klägerin zurück. Die Klägerin wurde zudem angewiesen, die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. Trotz der rechtlichen Niederlage hat dieser Fall wichtige Fragen zur Verantwortung von Medizinern bei der Behandlung von Patienten mit besonderen Bedürfnissen aufgeworfen und das Bewusstsein für die Notwendigkeit sorgfältiger medizinischer Praxis geschärft.
Das vorliegende Urteil
OLG Braunschweig – Az.: 9 U 67/18 – Urteil vom 18.11.2021
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Braunschweig vom 13. September 2018 – 4 O 2628/13 – wird zurückgewiesen.
Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
Dieses und das vorbezeichnete Urteil des Landgerichts Braunschweig sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung eines Betrages in Höhe von 110% des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Der Streitwert des Berufungsrechtszuges wird auf die Wertstufe bis 700.000,00 € festgesetzt.
Gründe
I.
Die Klägerin nimmt die Beklagte – eine Allgemeinmedizinerin – wegen einer angeblich fehlerhaften Behandlung in der Zeit vom 10. September 2004 bis zum 20. September 2004 auf Schmerzensgeld und Schadensersatz in Anspruch.
Wegen des Sach- und Streitstands I. Instanz wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils, S. 2-8 (Bl. 364-370 d.A.) Bezug genommen.
Folgendes ist erst- und zweitinstanzlich unstreitig:

/123RF.COM)
Die aus B. stammende Klägerin war zu diesem Zeitpunkt seit kurzem in einer Betreuungseinrichtung in W. untergebracht. Zuvor war bei ihr das Gilles-de-la-Tourette-Syndrom diagnostiziert worden. Sie besaß als Risikopatientin für eine Endokarditis einen sog. Herzpass. Hierbei handelt es sich um einen Gesundheitspass, aus welchem sich unter anderem Herzvorerkrankungen und -behandlungen ergeben. Seit einer Herzoperation im Jahr 1992 hat die Klägerin außerdem eine sichtbare Sternotomie-Narbe (= Narbe auf der Brust von einer operativen Öffnung des Brustkorbes).
Am 9.9.2004 biss sich die Klägerin bei einem Tourette-Anfall ein Stück aus der Lippe heraus. Nachdem sie sich zusätzlich am 10.9.2004 nochmals auf die geschädigte Lippe geschlagen hatte und diese deshalb stark geschwollen war, wurde von den Betreuern die Beklagte telefonisch gerufen, welche die Klägerin noch am selben Tag in den Räumen der Betreuungseinrichtung aufsuchte. Während des Eintreffens der Beklagten hielt sich die Klägerin unbekleidet in der Badewanne auf. Die Klägerin musste sodann beim Stehen von zwei Betreuern gestützt werden. Die Beklagte führte keine klinische Untersuchung durch, der Herzpass wurde ihr nicht vorgelegt und von ihr nicht abgefragt. Sie ordnete eine Fortführung der bestehenden Medikation an und wies auf die Notwendigkeit eines Impfschutzes hin. Die Betreuer teilten der Beklagten mit, dass eine Vorstellung in einer psychiatrischen Klinik für den 24.9.2004 geplant war.
Am 13.9.2004 suchte die Klägerin – erneut durch zwei Betreuer gestützt – die Praxis der Beklagten auf. Der Beklagten wurde der Impfpass der Klägerin übergeben. Die Verletzung der Lippe war mindestens nicht ausgeheilt. Die Klägerin litt ferner zumindest unter Diarrhö. Die Beklagte impfte die Klägerin gegen Tetanus und Diphtherie und verschrieb ein Lokalanästhetikum für die Lippe, sowie ein Medikament gegen die Diarrhö. Sie leitete keine weitere Therapie – insbesondere keine antibiotische Behandlung – ein; sie nahm ebenfalls keine klinische Untersuchung vor. Der Zustand der Lippenverletzung ist zwischen den Parteien streitig.
Am 16.9.2004 wurde die Beklagte darüber informiert, dass sich die Klägerin an der Hand selbst verletzt hatte. Die Beklagte überwies die Klägerin an einen Facharzt für Chirurgie, der eine Fraktur der Hand ausschließen konnte. Eine weitergehende Behandlung der Lippenverletzung wurde nicht eingeleitet.
Ab dem 17.9.2004 begann die Klägerin, die Mo.-Schule zu besuchen, wobei es ihr anfangs noch möglich war, auf den Treppen allein und ohne Unterstützung zu gehen.
Am 20.9.2004 telefonierte eine Mitarbeiterin der Betreuungseinrichtung der Klägerin mit der Beklagten und teilte mit, dass sich die Gangstörungen erneut verschlechtert hätten. Die Äußerungen der Beklagten und die weitere Reaktion sind streitig.
Am 23.9.2004 verspürte die Klägerin stechende Schmerzen und sackte beim Aufstehen zusammen. Die Klägerin wurde daraufhin in das Klinikum Braunschweig eingeliefert, in welchem im weiteren Verlauf eine Entzündung der Wirbelsäule festgestellt und eine hochdosierte antibiotische Therapie eingeleitet wurde.
Die Klägerin leidet bis heute unter eine Paraparese beider Beine sowie Blasen- und Darmentleerungsstörungen. Sie ist auf einen Rollstuhl und einen D.erkatheter angewiesen.
Das Landgericht hat die Klage nach Einholung mehrerer Gutachten des erstinstanzlichen Sachverständigen Prof. Dr. A. sowie dessen Anhörung abgewiesen. Die Klägerin habe zwar beweisen können, dass der Beklagten seit dem 13.9.2004 ein einfacher Behandlungsfehler in Form unzureichender Befunderhebung unterlaufen sei, indem sie nicht dem Gangbild durch anamnestische Befragung von Kontaktpersonen nachgegangen sei. Der Klägerin sei aber nicht gelungen zu beweisen, dass dies ursächlich für die später eingetretenen Schäden sei. Die unterlassene Befunderhebung sei kein grober Fehler. Sie habe nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen so deutlichen und gravierenden Befund ergeben, dass sich die Verkennung dieses Befundes als fundamental oder die Nichtreaktion hierauf als grob fehlerhaft darstelle. Sonstige Behandlungsfehler seien nicht festzustellen. Wegen der Einzelheiten wird auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils (S. 8-23 = Bl. 371-385 d.A.) verwiesen.
Mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten sowie ebenso mit einer Begründung versehenen Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Ziel in vollem Umfang weiter.
Die Ausführungen des erstinstanzlichen Sachverständigen seien widersprüchlich und nicht dem Schlichtungsgutachten vereinbar. Das Landgericht habe die Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. A. unkritisch übernommen. Das Landgericht habe auch keine ausreichenden Anknüpfungstatsachen festgestellt Es habe insbesondere versäumt, die Größe und die LokaL.tion des Lippendefektes und das sich daraus ableitende klinische Bild der Klägerin trotz angebotenen Beweises zu ermitteln.
Hinsichtlich der Behandlung am 10. September 2004 seien sehr wohl eine ausführliche Anamnese und eine klinische Untersuchung erforderlich gewesen, gerade weil die Beklagte die Klägerin nicht gekannt habe. Es habe sich auch nicht um eine bloße Notfallbehandlung gehandelt. Die Beklagte sei nicht nur wegen der Lippenverletzung, sondern auch wegen der Medikamente gerufen worden. Dies sei dem als Anlage K3 (Band I, Bl. 25 d.A.) vorgelegten Betreuungsbericht und der eigenen Stellungnahme der Beklagten im Schlichtungsverfahren, die als Anlage K2 (Band I, Bl. 24 d.A.) vorgelegt wurde, zu entnehmen. Es handele sich damit um einen normalen hausärztlichen Besuch bei einer neuen Bewohnerin der Betreuungseinrichtung, in der die Klägerin untergebracht war. Die für die Beklagte ersichtliche Sternotomienarbe hätte ihr Anlass geben müssen, aus Gründen der Endokarditisprophylaxe eine Antibiose einzuleiten. Insoweit hätten auch die Sachverständigen im Schlichtungsverfahren festgestellt, dass sich bei Einleitung einer antibiotischen Behandlung die Infektion nicht ausgebreitet hätte.
Der Sachverständige Prof. Dr. A. sei zudem unzutreffend von einer Verletzung im Mundinnenraum ausgegangen. Sie – die Klägerin – habe aber substantiiert vorgetragen, dass sie nicht nur eine einfache Lippenverletzung gehabt habe, sondern vielmehr ein Stück herausgebissen worden sei. Aus diesem Grund fehle ihr bis heute auch noch ein Stück der Lippe. Vor diesem Hintergrund überzeuge nicht, dass der Sachverständige ausgeführt habe, dass es unerheblich sei, wie genau sich die Lippenverletzung dargestellt habe.
In jedem Fall hätte die Beklagte am 13. September 2004 eine klinische Untersuchung durchführen müssen. Auch hier überzeuge die fachliche Auffassung des gerichtlich bestellten Sachverständigen, wonach eine Anamnese nicht zwingend erforderlich sei, in keiner Weise. Eine hypothetische klinische Untersuchung hätte die gleichen Folgen gehabt, wie eine klinische Untersuchung am 10. September 2004.
Für die behauptete Vorlage des Herzpasses bietet die Klägerin nunmehr das Zeugnis der Frau K. an (Band III, Bl. 435 d.A.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte die Beklagte wegen des Risikos einer Endokarditis eine antibiotische Behandlung einleiten müssen. Dass eine antibiotische Behandlung von der Beklagten zumindest in Erwägung gezogen worden sei, folge aus dem Betreuerbericht (Anlage K3, Band I, Bl. 25 d.A.). Die Beklagte habe sich nur gegen eine antibiotische Behandlung entschieden, weil sie wegen des Durchfalls keine Wirkung erwartet habe. Insoweit habe die Beklagte bereits nicht ermittelt, welche Genese der Durchfall gehabt hätte. Bei pflichtgemäßer Anamnese hätte die Beklagte außerdem festgestellt, dass die Klägerin (auch) einnässte, was auf eine Erkrankung des Rückenmarks hingedeutet hätte.
Das Landgericht habe ebenfalls ungewürdigt gelassen, dass die Klägerin immer schlechter habe gehen können und die Gangstörungen zugenommen hätten. Die Beklagte habe dies für eine medikamenteninduzierte, motorische Schwächung der Klägerin gehalten. Auf diesen Befund habe sie jedoch nicht reagiert. Hätte die Beklagte die Vorbefunde eingeholt, so hätte sie erkannt, dass die von ihr diagnostizierte medikamenteninduzierte Schwächung nicht dokumentiert sei. Dann hätte sie neurologische Ursachen in Betracht ziehen müssen. Hätte die Beklagte sich mit neurologischen Ausfällen befasst, so hätte sie erkennen müssen, dass nach dem MRT und der Liquoruntersuchung nur wenige Wochen vor dem Eintreffen in W. keine Befunde festgestellt werden können. Deswegen hätte sie dann die Gangstörungen als neue Erkrankung einstufen müssen. Diese Auffassung entspreche der Auffassung der Gutachter im Schlichtungsverfahren. Dies habe das Landgericht unberücksichtigt gelassen.
Das Landgericht habe außerdem fehlerhaft nicht zwischen den „Gangauffälligkeiten“ durch das Tourette-Syndrom und den später aufgetretenen „Gangstörungen“ unterschieden. Auch der gerichtlich bestellte Sachverständige habe am 23. August 2018 erklärt, dass er sich die Unterscheidung mangels Expertise nicht zutrauen würde (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 23. August 2018, Seite 4 = Band II, Bl. 358 d.A.). Da die Beklagte ebenfalls Allgemeinmedizinerin ist, sei davon auszugehen, dass eine derartige fachliche Unsicherheit auch bei ihr bestanden habe. Sie hätte deswegen am 13. September 2004 umgehend eine fachärztliche Behandlung einleiten müssen. Sie hätte insbesondere in Erwägung ziehen müssen, ob die Symptome nicht neurologischer Natur sein könnten.
Soweit das Landgericht hinsichtlich der Behandlung am 20. September 2004 meine, die darlegungs- und beweisbelastete Klägerin habe keinen Beweis dafür angeboten, dass die Anweisung an Heimleitung oder Betreuungspersonal nicht hinreichend deutlich bzw. gar nicht erteilt worden sei, verkenne das Landgericht, dass das Bestreiten mit Nichtwissen hier zulässig gewesen sei. Die Klägerin sei nicht dabei gewesen, als die angebliche Anweisung gegeben wurde. Die Beklagte habe ihre Behauptung außerdem nicht substantiiert.
Die Klägerin meint, die Beklagte habe zumindest eine große Anzahl kleinerer Fehler begangen, sodass im Gesamten grober Behandlungsfehler vorliege.
Die Klägerin beantragt, das Urteil des Landgerichts Braunschweig vom 13. September 2018 – 4 O 2628/13 – abzuändern und die Beklagte zu verurteilen,
1. an die Klägerin ein in das Ermessen des Gerichtes gestelltes Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 150.000,- € wegen sorgfaltswidriger ärztlicher Behandlung in der Zeit vom 10. September 2004 bis 23. September 2004 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 21. April 2012 zu zahlen,
2. an die Klägerin eine der Höhe nach in das Ermessen des Gerichts gestellte monatliche Schmerzensgeldrente in Höhe von mindestens 200,- € zu zahlen, beginnend mit dem 1. Oktober 2013, zahlbar im Voraus bis zum 3. eines jeden Kalendermonats und der Abänderungsmöglichkeit des § 323 ZPO unterliegend,
3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 263.943,54 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 21. April 2012 zu zahlen,
4. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche zukünftigen materiellen sowie immateriellen Schäden der grob fehlerhaften Behandlung in der Zeit vom 10. September 2004 bis zum 23. September 2004 zu ersetzen soweit ein öffentlich-rechtlicher Forderungsübergang nicht stattfindet oder stattgefunden hat und
5. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin außergerichtliche Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 6.379,95 € zu zahlen.
Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil im Ergebnis. Das Landgericht sei fehlerhaft zur Überzeugung gelangt, dass die Beklagte vom medizinischen Standard abgewichen sei. Ein Fehler der Beklagten könne allenfalls in einem – vertretbaren – Diagnosefehler liegen, woraus das Landgericht nicht den richtigen Schluss der fehlenden Vorwerfbarkeit gezogen habe. Anschließend habe das Landgericht allerdings die richtigen Schlüsse gezogen.
Die Beklagte rügt die von der Klägerin nunmehr behauptete Vorlage des Herzpasses als verspätet. Ein Herzpass sei der Beklagten zu keinem Zeitpunkt vorgelegt worden. Die Klägerin habe auch nicht unter Urin- und Stuhlinkontinenz gelitten. Der Beklagten sei nur von Durchfall berichtet worden, nicht aber von Inkontinenz.
Der Senat hat mit Verfügung vom 29.5.2019 (Bl. 465 f. d.A.) auf fehlende Entscheidungsreife und unzureichende landgerichtliche Tatsachenfeststellung hingewiesen sowie darauf, dass zum „Gangbild“ und „Lippenbissdefekt“ weiterer Vortrag im Sinne wahrnehmbarer Tatsachen seitens der Klägerin erforderlich sei, worauf das Landgericht schon hätte hinwirken müssen. Die Parteien haben daraufhin ihren Sachvortrag zu den streitigen Anknüpfungstatsachen ergänzt und präzisiert.
Die Klägerin behauptet insoweit, im Frühling und Sommer 2004 vor ihrem Ortswechsel von B. nach W. habe sie außerhalb kurzer Tics, die sie u. a. dann über 30 sec zu Trippelschritten gezwungen hätten, normal gehen, Fahrrad fahren und das Freibad besuchen können, auch unter der regelmäßigen Einnahme von Tavor®. Als Verschlimmerung sein nur die Neigung hinzugekommen, mit der Faust gegen die Wand zu schlagen.
Zum Beweis für den behaupteten Verlauf von April 2004 bis 9.9.2004 beruft sich die Klägerin auf das Zeugnis ihrer Mutter, Frau M. R., ihrer Schwester, Frau C. R., ihres so bezeichneten Ziehvaters, Herrn T. R., der Frau S. K., ihrer Freundin L. Bo., der Frau Y. K. sowie der Frau F.-Be. sowie auf eigene Parteivernehmung, hilfsweise Anhörung (Bl. 480R d.A.).
Ab dem 13.9.2004 habe sie – die Klägerin – nicht nur (unstreitig) unter Diarrhö gelitten. Sie habe vielmehr auch den Urin nicht mehr halten können. Bei ihrer Wiedervorstellung am 13.9.2004 sei neben dem unstreitig überreichten Impfpass auch ihr Herzpass der Beklagten übergeben worden (Beweis: Zeugnis Y. K., Bl. 434 d.A.), aus dem – inhaltlich unstreitig – eine stattgehabte Herzoperation zu entnehmen gewesen sei.
Am 15.9.2004 habe sie – die Klägerin – versucht mit ihrer Mutter, Frau M. R., zu telefonieren. Wegen ihrer verwaschenen Sprache habe ihre Mutter sie aber nicht verstehen können und habe deshalb das Gespräch mit ihrem Betreuer F fortgesetzt, der der Mutter von dem Unterlippenbissdefekt sowie davon berichtet habe, dass die Klägerin begonnen habe, einzunässen und einzukoten. Die Mutter habe daraufhin erklärt, die Klägerin müsse ernsthaft krank sein, weil diese ansonsten aufgrund großen Schamgefühls auch nicht aus Trotz einnässen oder einkoten würde. Zum Beweis für die Abläufe und Äußerungen am 15.9.2004 beruft sich die Klägerin auf das Zeugnis ihrer Mutter, Frau M. R. (Bl. 481 d.A.).
Die Klägerin sei der Beklagten am 16.9.2004 deshalb erneut vorgestellt worden, weil die Lippenbisswunde entzündet und geschwollen gewesen sei und sich gerade keine Besserung eingestellt habe. Schon spätestens ab 16.9.2004 habe sie – die Klägerin – anhaltend unter verwaschener Sprache bei massiv verkrusteten, schmierig belegtem Unterlippendefekt rechts sowie einer trocken-weißbraun belegten Zunge mit ausgedehnte Soor-Belägen bei den Wangentaschen gelitten, wie dies auch für den 23.9.2004 ärztlich festgestellt worden sei (Arztbericht vom 1.11.2004, K4). Zum Beweis für die Abläufe und Zustände am 16.9.2004 ruft sich die Klägerin auf das Zeugnis von Frau Y. K. sowie auf eigene Parteivernehmung, hilfsweise Anhörung (Bl. 482 d.A.).
In der Zeit nach dem 17.9.2004 sei es ihr zunehmend schwerer gefallen, die Schultreppen allein zu laufen. Es sei immer anstrengender geworden. Ihre Beine hätten sich schwer angefühlt. Zunehmend schwerer sei es ihr gefallen, aus dem Bett oder von einem Stuhl aufzustehen. Die Schmerzen hätten in Höhe der Brustwirbel begonnen, dann nach und nach in den Rücken und schließlich bis in die Beine ausgestrahlt. Wegen zunehmender Gangschwäche habe sie bei der Körperpflege gestützt Hilfe benötigt. Zum Beweis für die vorstehenden Abläufe beruft sich die Klägerin auf den Betreuerbericht der Zeugin Y. K. (Anlage K3 = Bl. 25 d.A.) sowie auf eigene Parteivernehmung, hilfsweise Anhörung (Bl. 481 d.A.). In den letzten Tagen ihres Schulbesuches habe ihr bei der Bewältigung der Treppen geholfen werden müssen. Zum Beweis hierfür beruft sich die Klägerin auf eigene Parteivernehmung, hilfsweise Anhörung (Bl. 481 d.A.).
Als Anlage BK1 legt die Klägerin Gesichtsfotos aus dem Jahre 2004, die sie vor und nach der Lippenverletzung (Bl. 483 d.A.) sowie aktuell (Bl. 484 f. d.A.) zeige.
Die Beklagte bestreitet die vorstehenden Behauptungen der Klägerin auch in deren jetziger Fassung und beruft sich dafür auf die bei den Akten vorliegende Dokumentation sowie auf eigene Parteivernehmung der Beklagten, hilfsweise Anhörung.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Berufungsvorbringens der Parteien wird auf die Berufungsbegründung der Klägerin (Band III, Bl. 430-439 d.A.), auf die Berufungserwiderung der Beklagten vom 08.03.2019 (Band III, Bl. 450-455 d.A.) auf den Schriftsatz der Klägerin vom 5.8.2019 nebst Anlagen (Bl. 479-485 d.A.) sowie den Schriftsatz der Beklagten vom 8.10.2019 (Bl. 493-497 d.A.) Bezug genommen.
Der Senat hat ergänzend Beweis erhoben durch Einholung des weiteren allgemeinmedizinischen Sachverständigengutachtens (§ 412 ZPO) gemäß Beweisbeschluss vom 5.11.2019 (Bl. 500-504R d.A.) der Sachverständigen Frau Prof. Dr. Ku. vom 13.4.2020 (Bl. 521-555 d.A.) sowie Einholung eines Ergänzungsgutachtens gemäß Beweisbeschluss vom 19.11.2020 (Bl. 604-610R d.A.) derselben Sachverständigen vom 9.3.2021 (Bl. 622-635 d.A.). Wegen des Ergebnisses wird auf die Inhalte der vorgenannten Gutachten verwiesen. Der Senat hat ferner Beweis erhoben durch Anhörung der Sachverständigen Prof. Dr. Ku. sowie Vernehmung der Zeuginnen M. R. und Y. K. gemäß prozessleitender Verfügung vom 21.5.2021 (Bl. 654-656 d.A.). Außerdem sind die Parteien persönlich angehört worden (§ 141 ZPO). Wegen des Ergebnisses der weiteren Beweisaufnahme und der persönlichen Anhörung der Parteien wird auf das Protokoll der Sitzung vom 7.10.2021 (Bl. 678-703 d.A.) Bezug genommen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Berufungsvorbringens der Parteien wird auf die Schriftsätze der Klägerin vom 18.10.2018 (Bl. 430-440R d.A.), 5.8.2019 (Bl. 479-485 d.A.), 5.8.2020 (Bl. 583-597 d.A.) und 19.5.2021 (Bl. 658-660 d.A.) sowie die der Beklagten vom 8.3.2019 (Bl. 450-455 d.A.), 8.10.2019 (Bl. 493-497 d.A.), 17.6.2020 (Bl. 566f. d.A.), 29.9.2020 (Bl. 602f. d.A.) und 17.6.2021 (Bl. 670 d.A.) verwiesen.
II.
Die zulässige Berufung bleibt im Ergebnis ohne Erfolg.
Nach dem Ergebnis der vom Senat wiederholten (§ 412 ZPO) und ergänzten Beweisaufnahme stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche nicht zu. Diese wären allein nach den §§ 280 Abs. 1, 611, 249 Abs. 2, 253 Abs. 1 und 2, 843 Abs. 1 BGB bzw. 823 Abs. 1 BGB in Betracht gekommen. Die §§ 630a ff. BGB sind ohnehin nicht einschlägig, da diese Vorschriften erst für Behandlungen ab dem 26.2.2013 gelten.
Die Ausführungen im erstinstanzlichen Sachverständigengutachten sowie die des Schlichtungsgutachtens basieren in weiten Teilen jeweils auf streitigen, seinerzeit ungeprüften Anknüpfungstatsachen und sind damit nicht tragfähig. Inwieweit diese Gutachten darüberhinausgehend jeweils selbst Widersprüche enthalten oder einander widersprechen, bedarf nach dem Ergebnis der weiteren Beweisaufnahme keiner Aufklärung mehr. Die wesentlichen Anknüpfungstatsachen, die nach den überzeugenden Erläuterungen der zweitinstanzlichen Sachverständigen allein Behandlungsfehler hätten begründen können, sind streitig, ohne dass für deren Vorliegen der Klägerin der ihr obliegende Beweis gelungen ist.
Für die Beurteilung des Haftungsgrundes kommt es im Arzthaftungsrecht allein auf den Zeitpunkt der Behandlungs- bzw. Aufklärungssituation an; eine rückwirkende Betrachtung ist unzulässig (vgl. BGH, Urt. v. 10.3.1987 – VI ZR 88/86 – [NJW 1987, 2291ff.] und 13.10.1992 – VI ZR 201/91 – [MDR 1993, 123f.], jeweils Rn. 13 zit. n. juris; OLG Braunschweig, Urteil v. 24.6.2009 – 1 U 16/08, S. 7 [n.v.]; Beschl. v. 12.11.2010 – 1 U 23/10, S. 7 [n.v.]).
Im Einzelnen:
1. Ein Behandlungsfehler am 10.9.2004 ist nicht festzustellen.
a) Die Behandlung der Lippenverletzung ist nicht zu beanstanden.
Dass ein Zustand vorlag, der die Einleitung einer Antibiose erfordert hätte, ist nicht bewiesen.
Die Beklagte hat persönlich angegeben, die Lippenverletzung untersucht zu haben. Es habe sich um eine schmale, V-förmige und 3-4 mm tiefe Verletzung gehandelt, die nicht entzündet gewesen sei und keine chirurgische Behandlung erfordert habe. Deshalb habe sie Kühlung verordnet.
Die persönlich angehörte Klägerin hat das nicht anders dargestellt, zumal sie sich nur noch daran erinnert konnte, eine offene Lippenverletzung gehabt zu haben.
Die Aussagen der Zeuginnen K. und R. sind hierzu unergiebig geblieben. Insbesondere haben beide nach jeweils eigenem Bekunden die Klägerin im gesamten streitgegenständlichen Zeitraum (10.-20.9.2004) nicht gesehen.
Auf dieser Grundlage musste die Beklagte nach den überzeugenden Erläuterungen der angehörten Sachverständigen Frau Prof. Dr. Ku. keine andere Behandlung, insbesondere keine Antibiose vornehmen. Das gilt auch unter Berücksichtigung der kardialen Krankengeschichte der Klägerin. Ohne Anzeichen einer Verschlimmerung durch Entzündung der Lippenwunde war eine Antibiose nicht indiziert.
Die Sachverständige hat das einleuchtend mit der generell denkbaren Entzündungsabfolge begründet. Es könne sich nicht so entwickeln, dass aus einer Lippenverletzung eine Endokarditis hervorgehe, ohne dass sich an der Lippenverletzung zuvor selbst eine Entzündung gezeigt habe. Die Existenz von Erregern im und am Mundbereich gehöre ohnehin zur normalen Mundflora, weshalb im Übrigen auch ein Keimabstrich im Bereich des Mundes einschließlich einer äußeren Lippenverletzung keinen Aussagewert habe. Erst infolge einer lokalen Entzündung einer Wunde sei die Gefahr gegeben, dass eine Verschleppung in entsprechend großer Zahl von Erregern in die Blutbahn auftrete, welcher der Körper selbst nicht ausreichend begegnen könne. Es sei deshalb rechtzeitig, im Falle des Auftretens von Anzeichen einer lokalen Wundentzündung mit Beginn der Antibiose zu reagieren. Auch aus den Unterlagen seien für den streitigen Behandlungszeitraum solche Anzeichen nicht zu entnehmen. Ohne solche Anzeichen sei die – dann unnötige – Gabe von Antibiotika wegen des Risikos der Entwicklung von dagegen resistenten Keimen zu vermeiden.
b) Eine ausführliche Anamnese oder eigene klinische Untersuchung war am 10.9.2004 nach allgemeinmedizinischem Standard nicht erforderlich.
aa) Dass es um mehr als eine Notfallbehandlung wegen der Lippenbissverletzung ging, ist nicht bewiesen.
Die persönlich angehörte Klägerin hatte keine weiteren konkreten Erinnerungen mehr an ihre Kontakte mit der Beklagten als diejenige, dass sie zunächst eine offene Lippenverletzung gehabt habe, die Beklagte zu ihr in die Einrichtung gekommen sei, als sie – die Klägerin – sich in der Badewanne befunden habe. Darüber hinausgehend meinte sie sich daran zu erinnern, von der Beklagten mit einem Stethoskop abgehört worden zu sein. Weitere konkrete Erinnerungen an einzelne Kontakte mit der Beklagten hatte sie nicht.
Aus den Angaben der persönlich angehörten Beklagten geht ebenfalls nichts hervor, was für mehr als eine Notfallbehandlung spricht. Insbesondere ist danach nichts dafür ersichtlich, dass ein Hausarztverhältnis begründet werden sollte. Sie sei nicht etwa als Hausärztin der Einrichtung akkreditiert gewesen. Sie sei nur wegen der Lippenbissverletzung und außerhalb ihrer Praxisöffnungszeiten im Rahmen ihrer zwischen den niedergelassenen Ärzten abgestimmten Notfalldienstbereitschaft telefonisch verständigt worden.
Ihre schriftliche Einlassung im Schlichtungsverfahren (K2 = Bl. 24/24R d.A.) ergibt nichts zwingend Anderes. Soweit die Einleitung der Stellungnahme einen dahingehenden Eindruck erwecken könnte („Ich solle ihre Medikamente überprüfen“), steht dem entgegen, dass die Beklagte unwiderlegt persönlich angegeben hat, am Telefon sei ihr nur die Lippenverletzung als Anlass genannt worden. Vor Ort seien ihr vom Pflegepersonal die Grunderkrankung (Tourette-Syndrom) und die Medikamente, die sie deswegen nehmen müsse, genannt worden. Ihr sei auch vom Pflegepersonal mitgeteilt worden, dass bereits ein Termin für die Vorstellung der Klägerin in der Klinik für Jugendpsychiatrie in Hameln für den 24.9.2004 vereinbart sei. Deshalb habe sie – die Beklagte – diese Medikamente bis zu diesem Zeitpunkt weiterverordnet.
Die Aussage der Zeugin K. hat ebenfalls nichts ergeben, was über die Notfallbehandlung hinausgehend für die Begründung eines hausärztlichen Verhältnisses spricht. Die Zeugin war nach eigenem Bekunden seinerzeit Erziehungsleiterin in der Einrichtung, in der die Klägerin aufgenommen worden war. Sie sei selbst weder mit der Beklagten noch mit der Klägerin ab dem 10.9.2004 im Zusammenhang mit der streitgegenständlichen Behandlung in Kontakt gekommen. Erstmals habe sie die Klägerin wiedergesehen, nachdem diese in das Klinikum in Braunschweig aufgenommen worden sei. Auch unter Vorhalt ihres Betreuerberichts hat die Zeugin ausgesagt, die Beklagte sei auch nicht „die Hausärztin“ der Einrichtung gewesen, sondern seinerzeit bei Bedarf, wie auch andere Ärzte, wegen der räumlichen Nähe kontaktiert worden.
bb) Die Beklagte musst vor diesem Hintergrund nicht nachfragen, warum die Klägerin durch den oder die Pfleger gestützt wurde.
Die Sachverständige Frau Prof. Dr. Ku. hat dazu ausgeführt, die Beklagte habe nicht von sich aus nach dem Grund des Stützens der Klägerin fragen müssen, sofern es sich entsprechend dem Beklagtenvortrag um keine hausärztliche Eingangsuntersuchung, sondern um eine – wie nach der (unwiderlegten, s.o.) Darstellung der Beklagten – notfallmäßige Akutbehandlung gehandelt habe. Anders sei das nur, wenn im Rahmen bei einem solchen Einsatz eine andere Symptomatik festgestellt wird, die selbst eine Notfallsituation abbildet bzw. ergeben könnte; dann müsse dem nachgegangen werden. Ein unsicheres Gangbild gehöre aber nicht per se zu einer Notfallindikation, die als solche zu einem aktiven Nachfragen des – in diesem Fall wegen einer akuten Lippenverletzung – hinzugezogenen Allgemeinmediziners Anlass gebe. Etwas Anderes wäre es gewesen, wenn die Betreuer von sich aus z.B. gesagt hätten, dass die Betreute so merkwürdig laufe und deshalb gestützt werden müsse. Dann hätte die Beklagte auch fragen müssen, seit wann das der Fall sei. Von sich aus aber brauche sie in einer Situation, in der das so nicht mitgeteilt wurde, nicht nachzufragen. In der streitgegenständlichen Situation am 10.9.2004 sei auch zu berücksichtigen, dass es sich bei der Klägerin nicht um eine ansonsten völlig gesunde Jugendliche gehandelt habe, die plötzlich eine Gangstörung aufwies, sondern um eine Patientin, die unter dem Tourette-Syndrom litt.
Diese Ausführungen sind nachvollziehbar und überzeugend. Das Gilles de la Tourette-Syndrom (Tourette-Syndrom) ist eine neuro-psychiatrische Erkrankung, die durch das gemeinsame Auftreten von motorischen und vokalen Tics gekennzeichnet ist (https://www.mhh.de/kliniken-und-spezialzentren/klinik-fuer-psychiatrie-sozialpsychiatrie-und-psychotherapie/ambulante-behandlungsangebote/tic-stoerung/was-ist-das-tourette-syndrom-1, Abruf 28.10.2021, 13:03 Uhr.). Es tritt mit sehr unterschiedlichem Schweregrad auf (Ludolph/Roessner/Münch/Mü.-Vahl, Deutsches Ärzteblatt 48/2012, 109 = https://www.aerzteblatt.de/archiv/132918/Tourette-Syndrom-und-andere-Tic-Stoerungen-in-Kindheit-Jugend-und-Erwachsenenalter, Abruf 28.10.2021, 13:05 Uhr). Dass die der Klägerin seinerzeit deswegen verabreichten Medikamente Tavor® und Zyprexa® Bewegungs- und Koordinationsstörungen sowie allgemeine Schwäche verursachen konnten, hat die Sachverständige in ihrem Erstgutachten vom 13.4.2020 (S. 14 = Bl. 534 d.A.) anhand der Beipackzettel nachvollziehbar ausgeführt.
Nach ihrem unwiderlegten Vorbringen sind der Beklagten bei ihrem Hausbesuch am 10.9.2004 die Grunderkrankung, die ohnehin mit motorischen Störungen einhergehen kann, und die der Klägerin verabreichten Medikamente mitgeteilt worden, jedoch ohne die Beklagte über irgendwelche Veränderungen im Gangbild der Klägerin zu informieren; Letzteres behauptet die Klägerin auch nicht und ist auch sonst nicht ersichtlich. Soweit die Zeugin R. in ihrer Vernehmung vor dem Senat bekundet hat, in einem Telefonat vom 11.9.2004 habe ihr die Klägerin nichts von etwaigen Gangschwierigkeiten berichtet, spricht das sogar eher dagegen als dafür, dass die Klägerin nach eigenem Empfinden bereits unter mitteilungswürdigen Gangschwierigkeiten litt.
Es ist mithin insgesamt überzeugend, dass die Sachverständige in ihren schriftlichen Gutachten (GA v. 13.4.2020, a.a.O.; GA v. 9.3.2021, S. 4 = Bl. 625 d.A.) und in der mündlichen Anhörung (Prot. v. 7.10.2021, S. 19f. = Bl. 696f. d.A.) ausgeführt hat, dass die Beklagte als Allgemeinmedizinerin deshalb den Umstand, dass die Klägerin gestützt wurde, sich wegen des Fehlens anderweitiger Anhaltspunkte mit der Grunderkrankung und den Nebenwirkungen der deswegen verabreichten Medikamenten erklären durfte und nicht aktiv nachfragen musste. Ob sie das gleichwohl hätte machen können und sie ggf. Informationen erhalten hätte, die zu einer neurologischen Befunderhebung und Behandlung Anlass gegeben hätten, ist nicht relevant. Denn aus einem nachträglichen Wissen um den tatsächlichen Verlauf kann kein Verhaltensmaßstab für die allein maßgebliche Ex-ante-Beurteilung abgeleitet werden. Aus der Ex-ante-Sicht hatte die Beklagten wegen der von ihr angenommenen Nebenwirkungen auch keinen Anlass, gesondert auf eine fachärztliche Überprüfung der Tourette-Medikamentierung hinzuwirken, da ihr mitgeteilt worden war, dass die Klägerin ohnehin am 24.9.2004 in der jugendpsychiatrischen Klinik vorgestellt werden sollte. Wie die Sachverständige Prof. Dr. Ku. ausgeführt hat, wäre es aus allgemeinmedizinischer Sicht nicht zulässig gewesen, wenn die Beklagte die Medikation bis zu diesem Termin umgestellt hätte, da ihr dafür das erforderliche Wissen eines Facharztes für Psychiatrie fehlte (Prot. v. 7.10.2021, S. 20 = Bl. 697 d.A.).
2. Der Beklagten sind auch am 13.9.2004 keine feststellbaren Fehler unterlaufen.
a) Aus den oben zum 10.9.2004 genannten Gründen war die Beklagte auch am 13.9.2004 nicht veranlasst, eine Antibiose einzuleiten:
aa) Eine Verschlimmerung der Lippenverletzung – insbesondere in Form einer lokalen Entzündung – ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht bewiesen.
Die persönlich angehörte Klägerin hat zwar eine Verschlimmerung bis hin zu einer Entzündung angegeben, welche ihr zunehmend Schmerzen und Sprachschwierigkeiten bereitet habe; sie hat das aber zeitlich nicht einordnen können. Damit ist bereits nicht ausgeschlossen, dass die angegebene Verschlimmerung ggf. zeitlich erst nach den Kontakten mit der Beklagten eingetreten ist. Nach den persönlichen Angaben der Beklagten war der Zustand der Lippenverletzung am 13.9.2004 unverändert. Das deckt sich mit ihrer Stellungnahme im Schlichtungsverfahren („kein Anhalt für eine fortgeleitete Entzündung“, K2 = Bl. 24 d.A.).
Die Zeuginnen R. und K. waren unstreitig bei dem Arztbesuch vom 13.9.2004 nicht anwesend.
Die Aussage der Zeugin R., am 11.9.2004 habe ihr die Klägerin in einem Telefonat mitgeteilt, dass ihre Lippe wehtue, besagt nichts Erhebliches. Zu diesem Zeitpunkt war die Lippenverletzung noch frisch. Dass sie schmerzte, lässt mithin schon denknotwendig nicht den Schluss zu, dass lokale Entzündungsanzeichen vorgelegen haben.
Soweit es in dem mit „Y. K.“ unterzeichneten, undatierten Betreuungsbericht heißt „Am 13. September wurde Ge. erneut bei der Hausärztin vorgestellt, da ihre Lippe war aufgeplatzt war und sich entzündet hatte. Frau Dr. W. entschied, kein Antibiotikum zu verordnen, da wegen der bestehenden Durchfallerkrankungen keine Wirkung zu erwarten war“ (K3 = Bl. 25 d.A.), folgt auch daraus keine hinreichende Überzeugung (§ 286 ZPO) für eine belastbare Anknüpfungstatsache. Die Zeugin K. hatte auf Vorhalt ihres Berichtes an den Inhalt keine Erinnerung. Sie konnte nach eigenem Bekunden nur vermuten, diesen Bericht verfasst zu haben, wobei sie ebenfalls lediglich vermutete, dass sie gegebenenfalls darin zusammengefasst habe, was ihr vom Personal der Einrichtung berichtet worden sei. Mit der Beklagten habe sie jedenfalls nicht gesprochen. Nach seinem Inhalt muss der Bericht denknotwendig auch erst über ein Jahr nach den streitgegenständlichen Ereignissen verfasst worden sein, weil darin auch der Umstand der Verlegung der Klägerin nach Brandenburg am 18.11.2005 erwähnt ist.
Aus der Verordnung von Kamistad®-Gel lässt sich nichts Abweichendes schließen. Kamistad®-Gel hat unstreitig keine antibiotische Wirkung. Dass es schmerzlindernd wirkt, lässt nicht den Schluss zu, dass die Beklagte durch die Verordnung auf eine Verschlimmerung der Wunde reagiert hat. Da die Wunde nach der Darstellung der Beklagten unverändert – also eben auch noch nicht verheilt – war, können insoweit auch noch „primäre“ Wundschmerzen vorhanden gewesen sein, welche mit Kamistad®-Gel gelindert werden sollten. Dass nach den Erläuterungen der Sachverständigen dieses Mittel eher für innere Mundverletzungen bestimmt ist, vermag keinen haftungsrelevanten Behandlungsfehler zu begründen. Die äußere Anwendung des Mittels ist nach den weiteren Ausführungen der Sachverständigen jedenfalls auch nicht schädlich. Die Klägerin behauptet auch nicht, durch die Verordnung von Kamistad®-Gel geschädigt worden zu sein.
Aus dem Umstand, dass als Heilungsergebnis ein Teil der Unterlippe der Klägerin unten rechts nicht mehr wie üblich lippenrot, sondern normal hautfarben ist, kann nach den Ausführungen der Sachverständigen Frau Prof. Dr. Ku. (Prot. v. 7.10.2021, S. 21 = Bl. 698 d.A.) selbst bei Berücksichtigung des unstreitigen Umstands, dass sich die Klägerin insoweit ein Stück des Lippenrots herausgebissen hat, nicht geschlossen werden, dass die Lippenverletzung entgegen der Darstellung der Beklagten chirurgisch versorgungspflichtig war oder sich, wie von der Klägerin behauptet, bereits zum 13.9.2004 und/oder 16.9.2004 Entzündungszeichen gezeigt haben. Das ist nachvollziehbar, weil selbst bei diesem Szenario bei den Kontakten mit der Beklagten keine chirurgisch-versorgungspflichtige Blutungen oder antibiosepflichtigen Entzündungszeichen vorhanden gewesen sein müssen. Unabhängig davon hat die Klägerin selbst nicht einmal angegeben, sich einen größeren Teil aus ihrer Lippe herausgebissen zu haben und auch nicht, dass die Lippenwunde bei einem der Kontakte mit der Beklagten geblutet habe.
Aus der Tatsache, dass die Beklagte den Zustand der Lippenwunde für den 13.9.2004 nicht dokumentiert (vgl. Kartei, K1 = Bl. 23 d.A.) hat, folgt nicht, dass deren Verschlimmerung bzw. Entzündung zu unterstellen ist. Die Nichtdokumentation ist weder eine eigenständige Anspruchsgrundlage noch führt sie zur Beweislastumkehr eines Ursachenzusammenhanges (BGH MedR 2020, 842, 843; Geiß/Greiner, Arzthaftpflichtrecht, 6. und 7. Aufl., Teil B Rn. 206; BGH VersR 1999, 190; OLG Braunschweig, Beschl. v. 11.02.2008 – 1 U 2/08; Giekas MedR 2016, 32, 35f.). Die Beweiserleichterung geht nur dahin, dass eine gegebenenfalls dokumentationspflichtige, indes nicht dokumentierte Maßnahme unterblieben ist, aber nicht soweit, dass ihre Durchführung mit einem bestimmten erkennbaren – vom Arzt aber übersehenen – Ergebnis fingiert werden kann (OLG Braunschweig, Beschl. v. 11.2.2008 – 1 U 2/08; BGH MedR 2020, 842, 843; Gehrlein, Grundriss der Arzthaftpflicht, 2. Aufl., Kap. B, Rn. 125).
bb) Die Beklagte war am 13.9.2004 auch unter dem Gesichtspunkt der kardiologischen Vorbehandlungen (Herz-OP) nicht gehalten, prophylaktisch nunmehr eine Antibiose zu beginnen. Die andernfalls dafür erforderlichen lokalen Entzündungsanzeichen an der Wunde sind nicht festzustellen. Insoweit kann auf die vorstehenden und die Ausführungen zum 10.9.2004 verwiesen werden. Das gilt auch unter isolierter Betrachtung des Umstands, dass sich zwischen den als Kontakten vom 10. und 13.9.2004 – auch ohne Entzündungsanzeichen – der Zustand unwiderlegt unverändert gezeigt hat. Die Sachverständige hat das nachvollziehbar mit dem Heilungsverlauf solcher Verletzungen begründet und ausgeführt, dass in so kurzer Zeit eine signifikante Verbesserung nicht zu erwarten sei. Deshalb müsse ihr Ausbleiben der Allgemeinmediziner nicht zum Anlass nehmen, allein deshalb eine Antibiose einzuleiten, auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Endokarditisprophylaxe. Es kommt nach alldem auch nicht darauf an, ob der Beklagten am 13.9.2004 der Herzpass vorgelegt worden ist.
b) Auch der Umstand, dass die Klägerin erneut durch einen oder zwei Mitarbeiter der M.-L.-Stiftung gestützt wurde, als sie die Beklagte am 13.9.2004 in deren Praxis aufsuchte, erforderte es nach allgemeinmedizinischem Standard nicht, dass die Beklagte hierzu ohne weitere Hinweise der Klägerin oder deren Begleiter von sich aus hierzu nachfragte oder Befunderhebungen veranlasste.
Zwar lag, wie sich auch aus der allgemeinen Logik ergibt, nach den Ausführungen der Sachverständigen an diesem Tag keine Notfallsituation vor; die Tetanusimpfung könne man zwar schon als Beginn eines hausärztlichen Verhältnisses sehen. Daraus allein ergebe sich aber nicht die medizinische Notwendigkeit, einen Gesamtstatus zu erheben oder eine umfassende Anamnese durchzuführen.
Die Sachverständige hat dies nachvollziehbar und überzeugend damit erläutert, dass – unter der der Sachverständigen in diesem Zusammenhang vorgegebenen Darstellung der Beklagten – dies aus Anlass dieses Termins, der noch im Kontext zu der vorangegangenen Notfallbehandlung stand, nicht erforderlich gewesen sei. Es wäre natürlich nicht verboten gewesen oder auch sonst nicht zu beanstanden gewesen, wenn das gemacht worden wäre; aus allgemeinärztlicher Sicht erforderlich sei das zu diesem Zeitpunkt aber nicht gewesen. Anderes folge auch nicht aus dem Umstand, dass die Klägerin abermals gestützt gebracht wurde. Anders wäre es gewesen, wenn man der Beklagten von einem akuten Auftreten von Gangschwierigkeiten oder deren Verschlimmerung berichtet hätte oder wenn es überhaupt darum gegangen wäre, sich generell der Gangschwierigkeiten zuzuwenden, oder wenn es darum gegangen wäre, eine allgemeine Untersuchung zu beauftragen.
Anlass des Termins mit der Klägerin am 13.9.2004 war nach den Angaben der Beklagten die vereinbarte Verabreichung der Tetanus-Impfung. Die Klägerin sei unverändert in gleicher Weise gestützt erschienen. Die Betreuer hätten bei dieser Gelegenheit um „etwas für die Lippe“ gebeten. Obwohl die Lippenwunde sich als unverändert gezeigt habe, habe sie diesem Wunsch entsprochen und das Kamistad®-Gel verordnet. Außerdem hätten die Betreuer nur von aktuell bei der Klägerin aufgetretenen Durchfall berichtet, für den sie sodann Loperamid verschrieben habe. Diese Angaben stehen mit ihrer Dokumentation (K1 = Bl. 23 d.A.) und ihrer Stellungnahme im Schlichtungsverfahren nicht in Widerspruch (K2 = Bl. 24 d.A.).
Dass der Anlass des Arztbesuches am 13.9.2004 darüber hinausging, insbesondere, dass es um eine allgemeine Untersuchung oder um die Klärung der Gangunsicherheit ging oder, dass man der Beklagten von einer hinzugetretenen Inkontinenz – jeglicher Art – berichtete, ist nicht bewiesen.
Die persönlich angehörte Klägerin hatte zu den Gesprächen zwischen ihr bzw. ihren Begleitern und der Beklagten keine Erinnerung. Sie konnte sich zwar an die Reihenfolge ihrer Beschwerden und deren Zunahme erinnern, vermochte das jeweils aber nicht zeitlich zuzuordnen, insbesondere nicht den Kontakten zu der Beklagten. Vielmehr hat sie sogar entgegen dem unstreitigen Vorbringen angegeben, sie sei erstmals an dem Tag gestützt worden, als sie in das Klinikum Braunschweig eingeliefert worden sei (= 23.9.2004).
Aus den Aussagen der Zeuginnen R. und K. folgt jeweils nichts für die Richtigkeit des prozessualen Klagevortrages zum 13.9.2004. Ihre Aussagen sind auch dazu unergiebig geblieben.
Ob es am 13.9.2004 einer Tetanus-/Diphtherieimpfung bedurfte, kann dahinstehen. Sie war nach den Ausführungen der Sachverständigen Prof. Dr. Ku. jedenfalls nicht kontraindiziert. Etwaige, mit der Impfung als solcher verknüpfte Schäden macht die Berufung auch nicht geltend.
Dass am 13.9.2004 aktuell Durchfall aufgetreten war, musste die Beklagte auch nicht zu einem anderen Behandlungsregime veranlassen. Insbesondere war es allgemeinmedizinisch nicht geboten, für den Durchfall neurologische Ursachen in Betracht zu ziehen. Die Sachverständige hat das überzeugend dahingehend erläutert, dass Durchfall kein Symptom einer Querschnittslähmung, sondern ein eigenes Krankheitsbild sei. Jemand mit Querschnittssymptomatik müsse, selbst wenn er stuhlinkontinent ist, keineswegs zwangsläufig unter Durchfall leiden; vielmehr sei das regelmäßig nicht der Fall.
Ob bei der Klägerin bis zum 13.9.2004 nun erstmals Harninkontinenz aufgetreten ist, kann dahinstehen. Retrospektiv wäre das zwar in Kombination mit der Gangstörung eine Indikation gewesen, die Klägerin unverzüglich in eine neurologische Klinik bzw. in eine Kinderklinik einzuweisen, weil es sich insoweit um dringende Warnzeichen für eine beginnende Querschnittssymptomatik handelt (vgl. GA der Sachverständigen Prof. Dr. Ku. vom 9.3.2021, Seite 9 = Bl. 630 d.A.). Die Beklagte war aber ex ante aus allgemeinmedizinischer Sicht aus den bereits zum Umstand des Gestütztwerdens genannten Gründen nicht gehalten, von sich aus die Klägerin und/oder ihre Begleiter danach zu fragen, ob Inkontinenz aufgetreten sei. Vielmehr durfte sie das ggf. der Klägerin bzw. deren Begleitern überlassen. Das ist unmittelbar einleuchtend. Ein Arzt kann bereits nach allgemeiner Lebenserfahrung davon ausgehen, dass für eine 13-jährige Patientin, selbst wenn diese unter dem Tourette-Syndrom leidet, ggf. der Wegfall der selbstverständlichen Fähigkeit Urin und Stuhl halten zu können so einschneidend ist, dass das von ihr, mindestens aber von den – erwartbar informierten – Begleitern ihrer Wohneinrichtung bei einem Arztbesuch auch berichtet wird.
3. Es ist ferner nicht festzustellen, dass der Beklagten am 16.9.2004 ein Behandlungsfehler unterlaufen ist.
Die Klägerin hat nicht bewiesen, dass an diesem Tag eine Untersuchung der Klägerin durch die Beklagte stattgefunden hat und auch nicht, dass eine Untersuchung der Klägerin durch die Beklagte vereinbart gewesen ist. Unstreitig gab es ein neues Akutereignis, das mit den bisherigen Anlässen nichts zu tun hatte, aus denen zuvor Kontakte zwischen der Klägerin und der Beklagten stattgefunden hatten. Denn die Klägerin hatte sich jetzt an der Hand verletzt, als sie damit in einem Tourette-Anfall gegen die Wand geschlagen hatte.
Die Beklagte hat in ihrer persönlichen Anhörung angegeben, deswegen von der Wohneinrichtung der Klägerin angerufen worden zu sein, wobei sie – die Beklagte – erklärt habe, man solle die Klägerin dem Chirurgen Dr. D. vorstellen und sie werde dafür eine Überweisung ausstellen, die abgeholt werden solle. Das sei am 16.9.2004 so auch geschehen. Bei der Gelegenheit des Abholens der Überweisung durch Mitarbeiter der Wohneinrichtung habe sie deshalb die Klägerin nicht anlässlich einer Untersuchung, sondern nur „zwischen Tür und Angel“ gesehen. Sie habe dabei auch ihre Lippe gesehen. Der Zustand der Verletzung habe sich verbessert gezeigt, die Schwellung und die Rötung seien rückläufig gewesen.
Diese Angaben werden durch die Karteidokumentation und die Stellungnahme der Beklagten im Schlichtungsverfahren gestützt; sie stehen damit jedenfalls nicht im Widerspruch.
Die Darstellung der Beklagten ist nicht widerlegt. Die persönliche angehörte Klägerin sowie die vom Senat vernommenen Zeuginnen R. und Mü. hatten auch an den Kontakt zwischen den Parteien vom 16.9.2004 keine weitergehende Erinnerung bzw. keine eigene Wahrnehmung. Auf die obigen Darlegungen zum 10. und 13.9.2004 wird verwiesen. Soweit die Zeugin R. bekundet hat, in einem weiteren Telefonat am 15.9.2004 habe die Klägerin ihr u. a. berichtet, der Rücken und die Lippe täten ihr weh, reicht das nicht aus, um Zweifeln an der klägerischen prozessualen Darstellung zum 16.9.2004 Schweigen gebieten zu können. Dass „die Lippe“ und „der Rücken“ der Klägerin weh getan haben sollen, lässt keinen hinreichenden Schluss auf eine erkennbare Verschlechterung zum 10. bzw. 13.9.2004 zu, insbesondere nicht darauf, dass über das Verletzungstrauma hinausgehend Entzündungsanzeichen hinzugetreten sind oder sich die Gangunsicherheit bereits erheblich verschlechtert hat. Dagegen spricht insbesondere, dass der Mitarbeiter der Wohneinrichtung anschließend im selben Telefonat nach dem Bekunden der Zeugin R. diese dahingehend beruhigt habe, die Lippe sei eben nun einmal noch geschwollen und dass ein Gel und eine Tetanusspritze verabreicht worden seien; von etwaigen Schwierigkeiten in der Motorik der Klägerin oder Inkontinenzprobleme habe der Mitarbeiter nicht berichtet.
Es kann nach alldem nicht festgestellt werden, dass die Beklagte am 16.9.2004 Anderes als geschehen hätte veranlassen müssen. Die Sachverständige hat – was im Kontext ihrer oben bereits erörterten überzeugenden Ausführungen unmittelbar einleuchtet – das damit begründet, dass auch für den 16.9.2004 ein Erfordernis zur Änderung des Vorgehens davon abhängig gewesen wäre, ob sich erkennbar ein Entzündungsgeschehen entwickelt hat oder der Beklagten Ausfallerscheinungen mitgeteilt wurden (Prot. v. 7.10.2021, S. 23 = Bl. 780 d.A.). Entsprechende Anknüpfungstatsachen hat die Klägerin nicht bewiesen.
4. Schließlich ist nicht festzustellen, dass der Beklagten am 20.9.2004 einen Behandlungsfehler, insbesondere in Form unzureichender therapeutischer Aufklärung unterlaufen ist.
Am 20.9.2004 hat unstreitig kein persönlicher Kontakt zwischen den Parteien stattgefunden.
Die persönlich angehörte Beklagte hat angegeben, sie sei von einer, ihr nicht namentlich bekannten Mitarbeiterin der Wohneinrichtung der Klägerin am 20.9.2004 angerufen worden. Diese habe mitgeteilt, die Klägerin könne immer schlechter gehen. Weil sie – die Beklagte – gewusst habe, dass ohnehin eine Aufnahme in der jugendpsychiatrischen Klinik in Hildesheim geplant gewesen sei, habe sie der Anruferin sofort erklärt, dass die Klägerin noch am selben Tag dort vorgestellt werden solle. Sie – die Beklagte – habe zur Bekräftigung sich zusätzlich die Telefondurchwahl der Heimleitung geben lassen, sodann umgehend dort angerufen und einer ihr nicht (mehr) namentlich bekannten Mitarbeiterin gesagt, dass sie die Klägerin wegen der angegebenen Verschlechterung „jetzt endlich noch am selben Tag nach Hildesheim schaffen“ sollten. Sie habe dabei die Mitarbeiterin der Heimleitung darauf hingewiesen, dass diese Beschwerden schnell, und zwar noch am selben Tag geklärt werden müssten. Dass die Medikation für die motorischen Schwächen ursächlich sein könnte, habe sie dabei mit keiner ihrer telefonischen Gesprächspartnerinnen der Wohneinrichtung thematisiert.
Dass die Beklagte am 20.9.2004 den Mitarbeitern der Wohneinrichtung der Klägerin wegen der telefonisch geschilderten zunehmenden Gangbeschwerden überhaupt geraten hat, die Klägerin ohne Zuwarten noch am selben Tag in die Jugendpsychiatrie nach Hildesheim zu bringen, ist unstreitig.
Soweit die Klägerin darüber hinaus in Abweichung von der Schilderung der Beklagten behauptet, diese habe ihre Empfehlung weniger dringlich formuliert, ist das nicht bewiesen. Insbesondere ist nicht festzustellen, dass die Beklagte in dem Telefonat sich (lediglich) dahingehend geäußert hat, die mitgeteilte Verschlechterung liege wohl an der Medikation, weshalb sie – die Beklagte – es deshalb für richtig halte, wenn die Klägerin noch am 20.9.2004 in die Psychiatrie gebracht werde.
Die Angaben der persönlich angehörten Klägerin sowie die Aussagen der Zeuginnen R. und K. sind dazu unergiebig geblieben. Die Zeugin K. hatte an Vorgänge vom 20.9.2004 keine Erinnerung, auch nicht an diesbezügliche etwaige Mitteilungen ihrer damaligen Mitarbeiter. Dass in dem von der Zeugin K. mindestens 14 Monate später verfassten „Betreuungsbericht“ (K25 = Bl. 25R d.A.) ein Telefonat vom 20.9.2004 zwischen der Einrichtung und der Beklagten nicht erwähnt ist, lässt keine Rückschlüsse auf den Inhalt des als solchen unstreitigen Telefonkontakts zu. Auf die Bekundungen der Zeugin R. hinsichtlich eines weiteren Telefonats vom 18. oder 19.9.2004 kommt es nicht an, da die Beklagte unstreitig an keinem dieser Tage vom Verlauf informiert wurde. Soweit die Zeugin R. ein Telefonat vom 20.9.2004 zwischen ihr und einer Betreuerin der Klägerin geschildert hat, in welchem ihr u. a. die starke Zunahme der Tics sowie erstmals mitgeteilt worden sei, dass die Klägerin nun ins Bett eingenässt habe, und man sie – die Zeugin R. – dahingehend beruhigt habe, ein „Termin mit dem Arzt“ sei „bereits gemacht“, ist auch das nicht geeignet, die Angaben der Beklagten zum 20.9.2004 zu widerlegen. Es handelt sich nicht um dasselbe Telefonat. Wer „der Arzt“ – Maskulinum – und welcher „Termin gemacht“ war, lässt sich daraus nicht schließen und auch nicht, ob am 20.9.2004 das von der Zeugin R. bekundete Telefonat vor oder nach dem Telefonat zwischen der Wohneinrichtung der Klägerin und der Beklagten stattgefunden hat. Es ist damit insbesondere möglich, dass in dem von der Zeugin R. geschilderten Telefonat noch der unstreitig für den 24.9.2004 vereinbarte jugendpsychiatrische Termin gemeint war. Abgesehen von der nicht feststellbaren Reihenfolge der genannten Telefonate vom 20.9.2004 ist auch nicht festzustellen, dass die Zeugin R. und die Beklagte in ihren jeweiligen Telefonaten mit derselben Mitarbeiterin der Einrichtung gesprochen haben.
Damit sind hinsichtlich des Telefonats vom 20.9.2004 zwischen einer Mitarbeiterin der Wohneinrichtung und der Beklagten deren unwiderlegte Angaben als Anknüpfungstatsache zugrunde zu legen.
Entsprechend den Ausführungen der Sachverständigen Prof. Dr. Ku. hat danach die Beklagte auf den Anruf vom 20.9.2004 mit der Angabe der Verschlechterung des Gangbildes richtig reagiert.
Die Beklagte hat für die differenzialdiagnostische Abklärung, die in der Zuführung zu entsprechenden Fachärzten besteht, mit dem gewählten Weg zur Psychiatrie nicht behandlungsfehlerhaft gehandelt. Insbesondere musste sie nicht vorrangig eine Vorstellung beim Neurologen anraten. Die Beklagte wusste um die Tourette-Erkrankung, die klar vorlag. Insoweit hat die Sachverständige nachvollziehbar ausgeführt (Prot. v. 7.10.2021, S. 24 = Bl. 701 d.A.), dass unter Zugrundelegung der Schilderung der Beklagten ex ante das psychiatrische Szenario einschließlich deren bisherige Medikation (vgl. GA v. 13.4.2020, S. 18 = Bl. 538 d.A.) die wahrscheinliche Ursache, hingegen eine Diszitis extrem unwahrscheinlich gewesen sei. Eine Diszitis sei ohnehin schon selten und komme bei Patienten in dem Alter wie seinerzeit dem der Klägerin extrem selten vor. Diese Ausführungen lassen keine Widersprüche erkennen und stimmen mit allgemein zugänglichem Wissen aus zuverlässigen Quellen überein (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 268. Aufl., „Diszitis“: Danach ist eine Diszitis die seltene Form der durch Bakterien verursachten isolierten Osteomyelitis der Wirbelsäule, weil hierbei statt der Erstreckung auch auf angrenzende Wirbelkörper – dann: Spondylodiszitis – nur die Bandscheibe betroffen ist; so auch Hufschmidt/Lücking/Rauer/Glocker-Bogdan, Neurologie compact, 8. Aufl., Infektiöse Spondylodiszitis [5501], Inzidenz: 0,4-5/100.000; vgl. Mayatepek, Kinder- und Jugendmedizin, S. 202: Die Inzidenz sogar aller Fälle über Erreger und Pilze im Blut erzeugter Osteomyelitis-Erkrankungen einschließlich der Fälle septischer Arthritis liegt in Europa nur bei 5-10 Fällen je 100.000 Kindern pro Jahr). Auch nach diesen nachvollziehbaren Ausführungen der Sachverständigen ist kein Unterschreiten des allgemeinmedizinischen Standards der Beklagten am 20.9.2004 festzustellen.
Anderes ist auch nicht aus ihrem Karteieintrag vom 20.9.2004 zu schließen. Zwar lässt die Formulierung „m. E. gehört die patientin nicht erst am freitag in die psychiatrie nach hildesheim“ die Möglichkeit offen, dass die Beklagten sich weniger dringlich als geboten gegenüber den Mitarbeitern der Wohneinrichtung der Klägerin geäußert hat, was den Zeitpunkt der Abklärung angeht. Da es sich indes um eine bloße Möglichkeit handelt, folgt daraus auch keine Beweiserleichterung für die Klägerin. Der – allenfalls ambivalenten – Indizwirkung steht zudem der für die Angaben der Beklagten sprechende Eintrag neben „Ü.:“ für „Überweisung“ stehende Eintrag „Psychiatrie“ entgegen. Danach hat die Beklagte die Überweisung in die Psychiatrie unter dem 20.9.2004 erstellt, also für denselben Tag. Auch auf Vorhalt der genannten Karteieinträge ist die Beklagte bei ihren Angaben geblieben und hat ausgeführt, sich zwar nicht mehr an die Diskussion in dem Telefonat im Einzelnen erinnern zu können; wenn sie das so dokumentiert habe, so werde ihre Empfehlung „kein Selbstläufer“ gewesen sein in dem Sinne, dass das sofort angenommen worden wäre. Sie gehe davon aus, dass es schon einer gewissen Diskussion bedurft habe. Sie erinnere sich aber daran und bleibe deshalb auch dabei, dass das Telefonat mit der Einrichtung nicht mit einer Ablehnung ihres – seitens der Beklagten – erteilten Rates geendet habe.
Die Angaben der Beklagten zum 20.9.2004 sind damit insgesamt nicht widerlegt.
Stützt ein Patient einen Arzthaftungsanspruch auf fehlerhafte therapeutische Aufklärung, genügt es nicht, diese zu behaupten oder die Erteilung der richtigen therapeutischen Aufklärung nur zu bestreiten. Er kann insoweit Beweiserleichterungen nicht in Anspruch nehmen. Ihn trifft die volle Beweislast dafür, weil die therapeutische Aufklärung Bestandteil der Behandlung ist (BGH, Urteil vom 15. März 2005 – VI ZR 289/03, Rn. 13, juris; Frahm/Walter, Arzthaftungsrecht, 7. Aufl., Rn. 243; vgl. OLG Hamm, Urteil vom 23. März 2018 – I-26 U 125/17, Rn. 32, juris; OLG München, Beschluss vom 28. Mai 2013 – 1 U 844/13, Rn. 14, juris). Für die Klägerin streitet insoweit auch aus den allgemeinen Grundsätzen zur Dokumentationspflicht keine Beweiserleichterung. Aufzuzeichnen sind nur die für ärztliche Diagnose und die Therapie wesentlichen medizinischen Fakten in einer für den Fall hinreichend klaren Form (BGH NJW 1989, 2330 mwN). Die ärztliche Dokumentation dient vor allem therapeutischen Belangen. Maßnahmen sind nur dann in den Krankenunterlagen zu dokumentieren, wenn dies erforderlich ist, um Ärzte und Pflegepersonal über den Verlauf der Krankheit und die bisherige Behandlung im Hinblick auf medizinische Entscheidungen ausreichend zu informieren (OLG Oldenburg NJW-RR 2009, 32, 33). Inhalt und Umfang der ärztlichen Dokumentationspflicht richten sich indes nicht danach, wie am besten Beweise für einen späteren Arzthaftungsprozess zu sichern sind (BGH a.a.O.; OLG München, Urteil vom 5. Mai 2011 – 1 U 4306/1, Rn. 52; OLG Braunschweig, Beschl. v. 11.02.2008 – 1 U 2/08; OLG Oldenburg a.a.O.). Regelmäßig ist der Arzt auch nicht gehalten, detailgetreu an jeder Stelle festzuhalten, dass er sämtliche in Betracht kommenden Fehler und Versäumnisse vermieden hat (OLG Oldenburg, Urteil vom 30. Januar 2008 – 5 U 92/06, Rn. 20, juris). Danach ist die Dokumentation vorliegend in der Zusammenschau mit der noch am 20.9.2004 ausgestellten Überweisung ausreichend. Unabhängig davon, weil grundsätzlich der Patient das Fehlen eines gebotenen therapeutischen Rates zu einer Untersuchung zu beweisen hat, die aus medizinischer Sicht hätte vorgenommen und deren Ergebnis hätte vermerkt werden müssen, besteht die Pflicht zur Dokumentation der therapeutischen Aufklärung regelmäßig nur dann, wenn der Patient sich für den Arzt erkennbar weigert, dem Rat zu folgen (vgl. OLG München, Urteil vom 19. September 2013 – 1 U 2071/12, Rn. 27, juris). Auch daran fehlt es im vorliegenden Fall. Der Arzt, dessen erteilter Rat vom Patienten nicht erkennbar zurückgewiesen wurde, muss in der Regel nicht davon ausgehen, dass der Patient den erteilten Rat missachtet und sich der medizinisch gebotenen Maßnahme nicht stellt. Vor diesem berechtigten Erwartungshorizont eine Dokumentation des ärztlichen Rats gleichwohl vorzunehmen, wäre ausschließlich an der Interessenlage in einem späteren Prozess orientiert (vgl. OLG München, a.a.O., Rn. 34, juris). Denn für einen Nachbehandler ist es medizinisch bedeutungslos, warum sich der Patient der medizinisch gebotenen Maßnahme unterzieht.
Schließlich ist auch nicht festzustellen, dass die Beklagte nach allgemeinmedizinischem Standard veranlasst war, am 20.9.2004 die Klägerin zusätzlich noch einzubestellen bzw. aufzusuchen und persönlich zu untersuchen, abgesehen davon, dass auch nicht ersichtlich ist, dass sie von der Klägerin bzw. deren Betreuern darum ersucht worden wäre. Mit den auch insoweit plausiblen Ausführungen der Sachverständigen musste die Beklagte ex ante aufgrund der ihr bereits bekannten Tatsache, dass es sich um ein mindestens auch psychiatrisches Krankheitsbild handelte, davon ausgehen, dass sie mit der Beurteilung, selbst wenn sie die Klägerin selbst untersuchen würde, an ihre Grenzen käme, die ohnehin das Hinzuziehen von Fachleuten, unter anderem auch Psychiatern, erforderlich machte. Deshalb durfte sie am 20.9.2004 auch von vornherein auf die Vorstellung bei Fachärzten noch am selben Tage drängen.
Aus den dargelegten Gründen basieren die maßgeblichen, letztlich überzeugenden Ausführungen der gerichtlichen Sachverständigen auf Anknüpfungstatsachen, die gemäß der gerichtlichen Strukturierung aus dem Ergebnis der zweitinstanzlichen Beweisaufnahme folgen, das den Schlichtungsgutachtern nicht zur Verfügung stand. Relevante Widersprüche für den Rechtsstreit ergeben sich aus dem Schlichtungsgutachten daher nicht (mehr).
Ob die Beklagte ex ante über den allgemeinmedizinischen Standard hinausgehend mehr hätte tun können, wie das bei Ärztinnen und Ärzten, die über mehr Empathie für ihre Patienten verfügen, durchaus vorkommt, ist für die Haftung und damit den Ausgang dieses Rechtsstreits nicht entscheidend.
Weitere Ansätze zur Feststellung einer Haftung dem Grunde nach bestehen nicht. Die weiteren von der Klägerin benannten Zeugen sind zu dem Gesundheitszustand der Klägerin vor dem 10.9.2004 und nach dem 20.9.2004 benannt, nicht aber zum Behandlungsgeschehen oder zu den mit der Beklagten über die Klägerin geführten Gesprächen.
Da der Klägerin der ihr obliegenden Beweis zum Haftungsgrund – insbesondere auch zu den Anknüpfungstatsachen – nicht gelungen ist, musste die Berufung insgesamt ohne Erfolg bleiben. Auf eine Klärung der Frage der Schadensursächlichkeit kam es nicht mehr an.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen nicht vor.
Der Streitwert war gem. §§ 47 Abs. 1, 48 Abs. 1 GKG, 3 ZPO entsprechend dem geltend gemachten Interesse an der Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung festzusetzen.