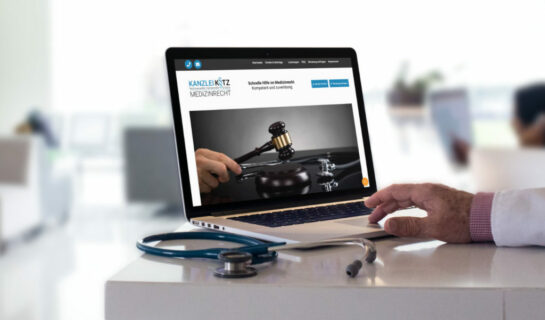LG Neuruppin – Az.: 3b O 25/14 – Urteil vom 07.02.2020
Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin ein Schmerzensgeld von 90.000 EUR nebst 5 % Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz auf 75.000 EUR seit 09.09.2014 und auf weitere 15.000 EUR seit 09.01.2020 zu zahlen.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin den weitergehenden Schaden aus den ärztlichen Behandlungen in der Zeit vom 06.06. bis 21.06.2002 und vom 06.04. bis 14.04.2011 zu erstatten.
Im übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Der Streitwert wird auf 220.000,00 € festgesetzt (hiervon 200.000 EUR für den Schmerzensgeldantrag und 20.000 EUR für den Feststellungsantrag)
Tatbestand
Am 07.06.2002 unterzog sich die damals 44 Jahre alte Klägerin einer Pansinus-Operation. Diese wurde in der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten im Hause der Beklagten zu 1 durch den Beklagten zu 2 als deren Chefarzt ausgeführt. Hierbei kam es zu einer Komplikation, die im Arztbrief vom 21.06.2002 wie folgt beschrieben wird: „Bei der Präparation des linken Siebbeins kam es nach einer Infrakturierung des Siebbeindaches zu einer Duraläsion mit konsekutiver Liquorrhoe, so dass eine sofortige Duraplastik notwendig wurde. Nach Detamponade am 5. postoperativen Tag zeigte sich weiterhin eine geringgradige Rhinoliquorrhoe Nach erfolgter Befundsicherung mittels CT der Nebenhöhlen führten wir am 13.06.02 den Verschluss eines fortbestehenden kleinen Defektes mit autogenen Transplantaten (…) durch.“
Vom 24.12.2010 bis 06.01.2011 befand sich die Klägerin wegen einer akuten bakteriellen Meningoencephalitis in stationärer Behandlung der neurologischen Klinik der Beklagten. Während des nächsten stationären Aufenthaltes vom 06.04. – 14.04.2011 wurde der Schädelbasisdefekt am 07.04.2011 erneut operativ durch eine Duraplastik verschlossen. Vom 02.11. – 18.11.2013 wurde die Klägerin mit einer Durchwanderungsmeningitis im Hause der Beklagten zu 1 konservativ behandelt. Nach der Behandlung einer weiteren Durchwanderungsmeningitis vom 02.11. – 18.11.2013 wurde die Beklagte in die Neurochirurgie im Hause der Beklagten zu 1 überwiesen und dort am 15.01.2014 operiert. Im Operationsbericht wird ein Verschluss des duralen Defektes mittels Tachosil und Periost beschrieben. Schließlich wurde die Klägerin während des laufenden Prozesses im Zeitraum 25.01. – 13.02.2018 unter der Diagnose bakterielle Meningitis durch Pneumokokken in der neurologischen Klinik der Beklagten zu 1 behandelt. Eine Nachuntersuchung am 19.06.2018 im Vivantes Klinikum Berlin ergab eine Pansinusitis mit deutlich rückläufigen Schleimhautschwellungen ohne Nachweis einer Liquorfistel.
Die Klägerin behauptet, die Behandlung im Hause der Beklagten zu 1 sei in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft erfolgt. Bereits die Verletzung des Siebbeindaches bei der 1. Operation am 07.06.2002 stelle einen Behandlungsfehler dar. Hierdurch sei eine Öffnung zum Gehirn verursacht worden.
Die Verletzung sei weder am Operationstag noch in den beiden nachfolgenden Operationen am 13.06.2002 und am 07.04.2011 verschlossen worden. Erst die neurochirurgische Versorgung vom 15.01.2014 habe Abhilfe geschaffen. Ein Neurochirurg hätte schon zu den ersten Operationen, spätestens zu der Operation am 07.04.2011, hinzugezogen werden müssen.

Sie sei auch fehlerhaft aufgeklärt worden. Weder sei darauf hingewiesen worden, dass bei Operationen an den Nasennebenhöhlen die Gefahr einer Hirnverletzung bestehe, noch sei darüber aufgeklärt worden, dass als Folge der fehlgeschlagenen Revisionsoperation eine Hirnhautentzündung entstehen könne. Sie sei auch nicht darauf hingewiesen worden, dass Nasenausflüsse und Kopfschmerzen (die bei ihr immer wieder aufgetreten seien) Symptome einer solchen Hirnhautentzündung sein könnten.
Die immer wiederkehrenden Hirnhautentzündungen seien Folge der fehlerhaften Operation aus dem Jahr 2002 und der anschließenden Versuche, den Defekt zu schließen. Inzwischen sei die Hirnleistungsfähigkeit deutlich gemindert. Es bestehe eine erhebliche Reduzierung der Gedächtnisleistung, mangelhafte Konzentrations- und Merkfähigkeit, eine daraus resultierende Beeinträchtigung des Sozialverhaltens mit bleibender Arbeitsunfähigkeit und notwendige Fürsorge bis ans Lebensende. Arbeiten im Haushalt könne sie nur in geringem Umfange ausführen.
Die Klägerin beantragt, die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie ein Schmerzensgeld von 200.000 EUR nebst 5 % Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz auf 75.000 EUR seit 01.04.2014 und auf weitere 125.000 EUR seit Zustellung des Schriftsatzes vom 10.02.2017 zu zahlen; festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin den weitergehenden Schaden aus den ärztlichen Behandlungen in der Zeit vom 06.06. bis 21.06.2002 und vom 06.04. bis 14.04.2011 zu erstatten.
Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen
Die Beklagten berufen sich zunächst auf Verjährung. Bereits in dem Operationsbericht vom 07.06.2002 sei dargestellt worden, dass es zu einem Bruch der Schädelbasis gekommen war. Die Verletzung sei im Übrigen schicksalhaft eingetreten und nicht auf einen Behandlungsfehler zurückzuführen. Ebenso wenig beruhe es auf einem Behandlungsfehler, dass die Revisionsoperationen nicht den gewünschten Erfolg gezeitigt hätten. Es könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass diese bei Hinzuziehung eines Neurologen nicht fehlgeschlagen wären.
Die Beklagten bestreiten die gesundheitlichen Beeinträchtigungen und wenden sich gegen die Höhe der Schmerzensgeldforderung.
Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
Die Kammer hat zunächst im Rahmen des Prozesskostenhilfeprüfungsverfahrens durch Einholung eines fachärztlichen Sachverständigengutachtens Beweis darüber erhoben, ob die beschriebene Verletzung des Siebbeindaches die medizinische Ursache unabhängig von der Frage der Behandlung Fehlerhaftigkeit für die in den Jahren 2010-2013 erlittenen Mengitiden gewesen war. Diese Frage hat der Sachverständige Dr. … im Gutachten vom 8. 20.09.2015 im Prinzip bejaht.
Im Hauptsacheprozess ist sodann Beweis darüber erhoben worden, ob die beschriebene Komplikation auf einem Behandlungsfehler beruht und ob auf die Komplikation sachgerecht reagiert worden ist, insbesondere ob die Revisionsoperationen fachgerecht ausgeführt worden sind. Diese Fragen hat der Sachverständige Prof. Dr. … im Gutachten vom 13.12.2016 dahingehend beantwortet, es sei allgemein bekannt, dass derartige Komplikationen trotz Sorgfalt beim chirurgischen Vorgehen im Einzelfall eintreten könnten. Der Verschluss des Schädelbasisdefektes habe einem üblichen Verfahren entsprochen. Dasselbe gelte für die Revisionsoperation vom 13.06.2002. Auch die 2. Revisionsoperation vom 07.04.2011 sei nicht grundsätzlich fehlerhaft. Allerdings habe unter Berücksichtigung des langen Krankheitsverlaufes im Vorfeld der Operation ein alternatives Verfahren zur Abdichtung der Schädelbasis stattfinden sollen. Bei der zur Auswahl stehenden Operationstechnik habe eine situation- und patientenorientierte Abwägung der Vor- und Nachteile getroffen werden müssen.
Mit Beschluss vom 16.11.2017 ist der Sachverständige Prof. Dr. … beauftragt worden, zur weiteren Aufklärung dieses Gesichtspunkt u.a. die Frage zu beantworten, ob die aktuellen Gesundheitsschäden der Klägerin auch bei der angesprochenen alternative Operationsmethode eingetreten wären. Dieser hat in seinem neurochirurgischen Zusammenhangsgutachten vom 16.11.2018 ausgeführt, aus den von ihm bewerteten CT-Befunden ergebe sich, dass es bei der Erstoperation nicht nur zu einer Verletzung der harten Hirnhaut, sondern zu einer ausgedehnten Verletzung des Hirngewebes selbst gekommen sei. Der Operateur sei um mindestens 3 cm hinter die topographische Begrenzung des endonasalen Arbeitsgebietes eingetaucht. Dies habe zu einem Abfluss nahezu des gesamten Nervenwassers der inneren Nervenwasserzellen geführt. Spätestens bei der vom Operateur selbst als dringlich eingestuften Revisionsoperation vom 13.06.2002 habe zwingend die Zuziehung der zuständigen Fachrichtung Neurochirurgie erfolgen müssen. Dass bei der erneuten Vorstellung mit einer weiteren, nun lebensbedrohlichen, Verschärfung der Komplikation erneut die bereits zweimal als untauglich erwiesene Behandlungsvariante gewählt wurde, stelle wiederum einen deutlichen ärztlichen Behandlungsfehler dar.
Zum weiteren Ergebnis der Beweisaufnahme wird auf das Ergänzungsgutachten des Sachverständigen vom 08.08.2018 und auf die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 09.01.2020, in welcher der Sachverständige seine gutachtlichen Ausführungen mündlich erläutert hat, verwiesen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung unter Berücksichtigung der mehreren Sachverständigengutachten in dem ausgeurteilten Umfang begründet. Die Klägerin hat aus Vertrag und Delikt einen Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes i.H.v. 90.000 EUR. Darüber hinaus war die Verpflichtung zum Ersatz weiterer, insbesondere künftiger Schäden festzustellen.
Auf den zu Grunde liegenden Sachverhalt ist die vor Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften zum 01.08.2002 geltende Rechtslage anzuwenden (Art. 229 § 8 Abs. 1 EGBGB), da das schädigende Ereignis vor diesem Zeitpunkt eingetreten ist. Damit haften im Falle eines Behandlungsfehlers der Träger des Krankenhauses und der behandelnde Arzt gesamtschuldnerisch aus §§ 823 Abs. 1, 831 Abs. 1, 847 Abs. 1 BGB alte Fassung auf Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes, darüber hinaus der Träger des Krankenhauses aus positiver Vertragsverletzung des abgeschlossenen Behandlungsvertrages auf Schadensersatz.
Nach dem Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme ist dem Beklagten zu 2 bei Durchführung der Operation am 07.06.2002 ein (grober) Behandlungsfehler vorzuwerfen. Der Sachverständige Prof. Dr. … kommt in seinem detaillierten, ausführlich begründeten und auch für die Kammer nachvollziehbaren Gutachten zu dem Ergebnis, dass es bei der Operation nicht nur zu einer Verletzung der harten Hirnhaut, sondern zu einer ausgedehnten Verletzung des Hirngewebes selbst gekommen ist. Der Abstand zwischen der knöchernen Begrenzung des Naseninnenraumes und der inneren Begrenzung des Ventrikels der Nervenwasserkammern lasse sich in der Bildgebung exakt nachvollziehen und habe mehr als 3 cm betragen. Dies bedeute, dass intraoperativ ein Eintauchen des rasch rotierenden Werkzeugs um mindestens 3 cm hinter die topographische Begrenzung des endonasalen Arbeitsgebietes erfolgt sein müsse. Der Weg vom Naseneingang bis zur Schädelbasis betrage bei der Klägerin ca. 6 cm. Es sei äußerst unwahrscheinlich, dass dem Operateur ein Eintauchen seines Instrumentes in die bekanntermaßen heikle Materie oberhalb der Schädelbasis um mehr als 50 % der zuvor in die Nase eingeführten Instrumentenlänge entgangen sein sollte.
Diese Ausführungen stehen nicht im Widerspruch zu den Angaben des zuvor beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. … in dessen Gutachten vom 11.12.2016, sondern stellen eine Ergänzung hierzu dar. Prof. Dr. … hatte auf Basis des OP-Berichtes (knöcherne Verletzung des Siebbeindaches und Duraverletzung mit konsekutiver Rhinoliquorrhoe) und des gerichtlichen Beweisbeschlusses (beruht die Komplikation – Bruch des Siebbeins, Duraläsion – auf einem Behandlungsfehler) ausgeführt, dass Schädelbasisverletzungen mit Eröffnung der Dura zu den typischen Risiken einer Nasennebenhöhlenoperation gehörten; typische Ursachen seien individuelle Besonderheiten der Anatomie, mangelnde Erfahrung des Operateurs oder eine Maskierung der Anatomie durch Blutungen; im vorliegenden Fall sei eine schwierige anatomische Situation mit tief stehender Schädelbasis beschrieben worden. Auf Basis dieser Befunde hat der Sachverständige einen Behandlungsfehler verneint.
Im Termin vom 09.01.2020 hat der Sachverständige Prof. Dr. … die vorstehenden Schlussfolgerungen zunächst dahingehend bestätigt, dass bei Operationen der streitgegenständlichen Art durchaus ein Schaden der harten Hirnhaut eintreten könne. Im vorliegenden Fall seien aber bisher alle Beteiligten unzutreffenderweise davon ausgegangen, dass lediglich ein solcher Schaden gegeben sei. Als Facharzt für Neuroradiologie sei ihm bei Auswertung des CT jedoch aufgefallen, dass weitergehend eine deutliche Hirnverletzung vorgelegen habe. Es sei ein Kanal sichtbar gewesen, der konisch verlaufen sei, also an seinem Ende größer gewesen sei als an seinem Anfang. Dies bedeute, dass das verwendete Instrument nicht lediglich abgerutscht sei (und hierbei einen Stichkanal verursacht habe) sondern dass es in dem Kanal bewegt worden sei mit der Folge, dass am Ende des Kanals Gewebe entfernt worden sei. Infolgedessen sei die Hirnwasserkammer eröffnet worden und Hirnwasser abgelaufen.
Aufgrund der weitergehenden Erkenntnisse, die der Sachverständige aus der eigenständigen Auswertung der ihm vorliegenden Unterlagen hatte, steht für die Kammer fest, dass dem Beklagten zu 2 ein Behandlungsfehler vorzuwerfen ist.
Nicht zu beanstanden ist insoweit zunächst, dass der Sachverständige auch ungefragt diese ihm ins Auge fallenden Befundergebnisse gutachtlich verwertet hat. Es entspricht jedenfalls in Arzthaftungssachen der allgemein anerkannten Aufgabenteilung zwischen Gericht und Sachverständigen, dass der medizinische Sachverständige den gesamten Behandlungsfall im Hinblick auf die therapeutische Qualität bewertet. Die vom Gericht in einem Beweisbeschluss vorgegebenen Einzelfragen können diese Bewertung erleichtern. Wenn dies sachlich geboten ist, wird allerdings eine über diese Einzelfragen hinausgehende Sachverhaltswürdigung erwartet.
Die Feststellungen des Sachverständigen begründen eine Abweichung vom medizinischen Standard. Im Termin hat der Sachverständige angegeben, eine Verletzung dieses Ausmaßes (Länge des Verletzungskanals 4 cm, Breite 1,5 cm an der breitesten Stelle, dem Ende des konischen Verlaufs) habe er in der Zeit, in der er Gutachten für Gerichte schreibe (seit etwa 20 Jahren jährlich 10 bis12 Gutachten) noch nicht gesehen. Für ihn sei unverständlich, dass es zu einer solchen Verletzung gekommen ist.
Auch die weitere Behandlung der Klägerin war fehlerhaft. Im Gutachten hat der Sachverständige hierzu ausgeführt
„Im Rahmen dieser schwerwiegenden Komplikationen traten bereits etliche Hinweise auf, die die sofortige Hinzuziehung eines neurochirurgischen Fachkollegen rechtfertigten und mit Einschränkung notwendig gemacht hätten. Im Anschluss an den Eingriff wurde behandlungsfehlerhaft eine bildgebende Kontrolle des Behandlungsergebnisses bei schwerster intraoperativer Komplikationen unterlassen. Nachdem diese bildgebend am 7. postoperativen Tag aus für den Gutachter nicht ganz nachvollziehbaren Gründen eilig nachgeholt wurde, wurde aus dem Ergebnis dieser Kontrolle eine dringliche Operationsindikation abgeleitet und behandlungsfehlerhaft wiederum kein Facharzt, der für die Betroffene Körperregion zuständig war, hinzugezogen. Dies war fehlerhaft, da es von endonasal für einen Kollegen der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde nicht möglich ist, die im intraparenchymatösen und im CT vom 13.06.2002 zweifelsfrei nachgewiesenen, schweren Hirndefekt, der eine Verbindung zwischen inneren und äußeren Liquorräumen geschaffen hatte, tauglich zu behandeln. Darüber hinaus musste von der Verschleppung von Schleimhautanteilen in das Hirnparenchym ausgegangen werden, die zwingend als Infektquelle zu betrachten sind, da die naturgemäß bakterienbesiedelte Nasenschleimhaut ein völlig anderes Milieu als das naturgemäß vollkommen keimfreie Gehirn darstellt. Im Anschluss an den Eingriff wurde behandlungsfehlerhaft keinerlei Nachsorgekonzept festgelegt. Beim nächsten Aufenthalt (8 Jahre später) wurde behandlungsfehlerhaft wiederum kein Neurochirurg zu Rate gezogen. Dies erfolgte erst 2014. Zu diesem Zeitpunkt wurde ausweislich der Unterlagen ein suffizienter Verschluss des Defektes erzielt.“
Aufgrund der nachvollziehbaren Erläuterungen dieser Ausführungen im Verhandlungstermin vom 09.01.2020 ist die Kammer davon überzeugt, dass die vorstehenden Ausführungen zutreffend sind. Der Sachverständige hat im einzelnen dargelegt, dass man aus dem CT vom 13.06.2002 ersehen kann, dass die Hirnwasserkammern zu 2/3 mit Luft gefüllt sind. Luft und Hirnwasser hätten eine unterschiedliche Dichte und könnten deshalb genau unterschieden werden. Allein aufgrund der Menge des ausgetretenen Hirnwassers habe man zu dem Schluss kommen müssen, dass eine Hirnverletzung vorgelegen habe. Alles dies habe man feststellen können und müssen, wenn man nach der notfallmäßigen Abdichtung am Operationstag eine CT Kontrolle gemacht hätte. Dass dann schließlich am 13.06.2002 angefertigte CD sei falsch ausgewertet worden. Man habe den erkennbaren Verletzungskanal überprüfen, reinigen, säubern und verschließen müssen. Dies habe nicht auf dem eingeschlagenen Weg, sondern auf neurochirurgischen Weg erfolgen müssen. Die Operation habe nicht unbedingt ein Neurochirurg, aber ein neurochirurgischen ausgebildeter Hals – Nasen – Ohren Arzt machen müssen. Dadurch, dass der Verletzungskanal nicht behandelt worden sei, also verschmutzt geblieben sei, habe sich das Infektionsrisiko verfünffacht oder versechsfacht. Eine Nachbehandlung zum Zeitpunkt der Operation im Jahr 2011 sei nicht mehr möglich gewesen. Das Hirn verquille. Die Fremdkörper würden abgekapselt. Eine denkbare Folge, die bisher nicht eingetreten sei aber noch eintreten könne, sei die Bildung eines Hirnabszesses. Ein solcher habe lebensbedrohliche Auswirkungen. Man sage, bei einem Drittel sei die Behandlung erfolgreich, bei einem Drittel verbliebenen Schäden, bei einem Drittel könne die Behandlung zu spät kommen.
Auf Basis der vorstehend zitierten Ausführungen des Sachverständigen, denen sich die Kammer voll inhaltlich anschließt, erweist sich zunächst der Feststellungsantrag als begründet. Die nachgewiesenen Behandlungsfehler begründen die Verpflichtung beider Beklagten, der Klägerin jedweden Schaden aus den ärztlichen Behandlungen in der Zeit vom 06.06. bis 21.06.2002 und vom 06.04. bis 14.04.2011 zu erstatten. Inwieweit Gesundheitsschäden der Klägerin tatsächlich auf einen Behandlungsfehler zurückzuführen sind, war im Rahmen dieses Prozesses nur insoweit aufzuklären, als das geltend gemachte Schmerzensgeld betroffen ist. Weitergehende Schäden sind nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreites. Insbesondere hat die Klägerin davon abgesehen, ihre Klage um (einen Teil des) Haushaltsführungsschadens zu erweitern.
Für die nachgewiesenen, insbesondere im Verhandlungstermin vom 09.01.2020 durch den Gutachter Prof. Dr. … drastisch geschilderten, Folgen der am 07.06.2002 eingetretenen Verletzung des Hirns hält die Kammer ein Schmerzensgeld i.H.v. 90.000 EUR für erforderlich, aber auch ausreichend.
Wie das OLG Köln in der von Klägerseite zitierten Entscheidung vom 13.04.2016 (Az. 5 U 107/15) ausgeführt hat, soll das Schmerzensgeld dem Geschädigten einen angemessenen Ausgleich für die Beeinträchtigungen bieten, die nichtvermögensrechtlichen Natur sind. In erster Linie bilden die Schwere der Verletzungen, das hierdurch bedingte Leiden, dessen Dauer und das Ausmaß der Beeinträchtigung der Lebensführung im privaten und beruflichen Bereich die wesentliche Grundlage für die Bemessung der Entschädigung.
Nach Maßgabe dieser Grundzüge ist zunächst die Operation vom 13.06.2002 zu berücksichtigen. Diese Operation hatte grundsätzlich, nicht zuletzt im Hinblick auf die erforderliche Vollnarkose, erhebliche Risiken. Vorliegend kommt hinzu, dass es eine Notoperation war.
Ab Dezember 2010 sind mehrfach Meningitiserkrankungen festgestellt worden, die unter Berücksichtigung des Inhalts aller vom Gericht eingeholten Sachverständigengutachten auf die Hirnverletzung zurückzuführen sind. Bereits der Sachverständige Dr. … hat – noch auf der Basis, dass lediglich eine nur Verletzung der vorderen Schädelbasis vorlag – den kausalen Zusammenhang für wahrscheinlich gehalten. Der sodann eingeschaltete Sachverständige Prof. Dr. … hat ausgeführt, es könne mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eingeschätzt werden, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen der Nasennebenhöhlenoperation im Jahr 2002 mit Verletzung der Schädelbasis und den folgenden Meningitiden in den Jahren 2010 bis 2013 bestehe. Der zuletzt beauftragte Prof. Dr. … hat im einzelnen ausgeführt dass und warum ein ausreichender Verschluss des Defektes vor 2014 nicht erzielt worden ist. Es müsse nämlich von der Verschleppung von Schleimhautanteilen in das Hirnparenchym ausgegangen werden, die zwingend als Infektquelle zu betrachten seien. Diese Hirnhautentzündungen sind gravierende Erkrankungen, die insbesondere dann, wenn sie aus welchen Gründen auch immer unbehandelt bleiben, zu ganz schwerwiegenden Folgen führen können.
Auf Grund dieser Erkrankungen hat es zwei weitere Operation gegeben. Zunächst ist am 07.04.2011 der Schädelbasisdefekt erneut operativ durch eine Duraplastik verschlossen worden. Sodann hat am 15.01.2014 eine neurochirurgische Operation stattgefunden.
Im Termin hat der Sachverständige ergänzt, dass weiterhin das Risiko bestehe, dass die Klägerin an einer Meningitis erkrankt. Außerdem könne sich als Spätkomplikation an Hirn-Abszess bilden. Dieser könne lebensbedrohliche Auswirkungen haben (wie bereits ausgeführt: bei einem Drittel sei die Behandlung erfolgreich, bei einem Drittel verbliebenen Schäden, bei einem Drittel könne die Behandlung zu spät kommen).
Die Beweisaufnahme hat schließlich die Darstellung der Klägerin bestätigt, ihre Hirnleistungsfähigkeit sei deutlich gemindert; es bestehe eine erhebliche Reduzierung der Gedächtnisleistung, sowie eine mangelhafte Konzentrations- und Merkfähigkeit. Prof. Dr. … hat in seinem Gutachten die Ergebnisse aus den Krankenunterlagen und einer persönlichen Untersuchung der Klägerin vom 12.10.2016 im Sankt Gertrauden Krankenhaus wie folgt zusammengefasst: Depressive Anpassungsstörung; deutliche Minderung der Hirnleistungsfähigkeit nach schwerer bakterielle Meningo-Enzephalitis; chronisches Kopfschmerzsyndrom mit somatischen psychischen Folgen. Prof. Dr. … hat unter dem Vorbehalt, dass er die Klägerin nicht selbst untersucht hat, im Termin ergänzt, es sei daher wahrscheinlich, dass die von Klägerseite geltend machten Beschwerden (Störung der Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit und ähnliches) auf eine Hirnverletzung zuzuführen sind und vorliegen, weil das Frontalhirn sei hierfür zuständig sei.
Die Kammer folgt den Ausführungen der Sachverständigen. Sie hält diese für ausreichend zur Überzeugungsbildung. Die Einholung eines neurologischen Zusatzgutachtens zur Erhaltung der Angaben wird nicht für erforderlich gehalten.
Da sämtliche Folgen ihre Ursache in der Hirnverletzung anlässlich der Operation vom 07.06.2002 haben, kann eine Einzelbewertung der Folgen der weiteren Behandlungsfehler (unzureichende Nachoperationen vom 13.02.2002 und 07.04.2011) unterbleiben. Die tatsächlich eingetretenen Folgen sind hierdurch jedenfalls nicht verhindert worden. Ob sie nachweisbar hätten verhindert werden können, bedarf keiner abschließenden Aufklärung.
Die vorstehend beschriebenen Folgen rechtfertigen ein Schmerzensgeld von 90.000 EUR. Zu berücksichtigen sind nicht lediglich die bereits eingetretenen Schäden, namentlich die 3 Operationen im Bereich des Frontalhirns, sondern drohende weitere Erkrankungen bis hin zu einem möglicherweise nicht mehr behandelbaren Hirnabszess. Dieser Umstand, der in dieser Deutlichkeit erst durch die Ausführungen des Sachverständigen Prof. … im letzten Verhandlungstermin deutlich geworden ist, rechtfertigen insbesondere eine Erhöhung des zuletzt von der Kammer unterbreiteten Vergleichsvorschlags (60.000 EUR). Klarzustellen ist, dass mit der Bemessung des Schmerzensgeldes derzeit „nur“ die Gefahr einer Spätfolge und die damit für die Klägerin verbundenen psychischen Auswirkungen abgegolten sind während ein etwaiger tatsächlicher Eintritt einer Spätkomplikation von dem Feststellungsantrag erfasst wird.
Entgegen der Ansicht der Klägerin ist ein höheres Schmerzensgeld nicht gerechtfertigt, insbesondere kann sich die Klägerin insoweit nicht auf die weiteren Ausführungen des OLG Köln in der zitierten Entscheidung berufen. Grundsätzlich können Ausführungen anderer Gerichte zu anderen Fällen nur unter Vorbehalt übernommen werden, da jeder Fall für sich beurteilt werden muss. Das Leiden der jeweils klagenden Partei kann nicht miteinander verglichen werden und ist auch vorliegend nicht vergleichbar. So führt das OLG Köln in den Urteilsgründen aus, der Kläger könne in ihm unbekannter Gegend nur in Begleitung spazieren gehen; Arbeiten im Haushalt könne er nur unter Anleitung ausführen; mit Lesen und Fernsehen beschäftige er sich nur selten und dann lediglich kurz und in der Regel ohne Interesse. Eine derart massive Einschränkung in den allereinfachsten täglichen Verrichtungen und damit grundlegende Veränderung der Persönlichkeit als solcher ist vorliegend im Falle der Klägerin nicht vorgetragen oder ersichtlich. Die von der Klägerin vorgetragenen Einschränkungen der Konzentration- und Merkfähigkeit sollen durch diese Abgrenzung nicht als unbedeutend eingestuft werden. Sie sind jedoch in dem Gesamtschmerzensgeldbetrag für sämtliche Folgen von 90.000 EUR bereits hinreichend berücksichtigt.
Die Ansprüche der Klägerin sind auch nicht verjährt. Nach § 199 Abs. 2 BGB (eine Vorschrift, die im übrigen seit dem 01.01.2020 in Kraft ist und daher zum Zeitpunkt der schadenstiftenden Operation bereits galt) verjähren Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an. Diese Frist ist offensichtlich nicht abgelaufen.
Eine kürzere Verjährungsfrist von 3 Jahren läuft ab dem Ende des Jahres, in dem der Anspruchsberechtigte Kenntnis von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen (§ 199 Abs. 1 BGB). Die hierfür erforderliche Kenntnis der Klägerin hat nicht bereits im Jahr 2002 vorgelegen. Insoweit können sich die Beklagten nicht auf den Entlassungsbericht vom 21.06.2002 berufen. Selbst wenn dieser Bericht zur Kenntnis der Klägerin gelangt sein sollte, was diese bestritten hat, ergäbe sich hieraus nicht die für einen Verjährungsbeginn notwendige Kenntnis von Schädigung und Schädiger. In diesem Bericht wird lediglich ein Schädelbasisdefekt mit Duraläsion als Komplikation, nicht aber als vermeidbarer Behandlungsfehler beschrieben. Eine bloße Komplikation rechtfertigt indes nicht einen Schadensersatzanspruch. In Arzthaftungsfällen beginnt die Verjährung daher nicht bereits mit der Kenntnis eines Schadens, sondern erst mit der Kenntnis (oder grobfahrlässigen Unkenntnis) davon, dass dieser Gesundheitsschaden auf einer von dem medizinischen Standard abweichenden Handlung beruht. Diese Kenntnis musste sich für die Klägerin allerdings frühestens im Zeitpunkt der Revisionsoperation vom 07.04.2011 aufdrängen, möglicherweise aber auch erst aus den Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. … ergeben.
Der Zinsanspruch folgt aus hinsichtlich eines Teilbetrags von 75.000 EUR aus § 286 ZPO (Ablehnung der entsprechenden Zahlung durch anwaltliches Schreiben vom 09.09.2014), im übrigen aus § 291 ZPO Rechtshängigkeit erst durch Antragstellung im Termin vom 09.01.2020. Vor diesem Termin und nach Bewilligung der Prozesskostenhilfe ist ein klageerweiternder Schriftsatz nicht eingegangen).
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 ZPO. Die Klägerin hat angesichts eines Streitwertes von 220.000 € (Schmerzensgeld 200.000 EUR und Feststellungsantrag 20.000 EUR) zur Hälfte obsiegt.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 ZPO.