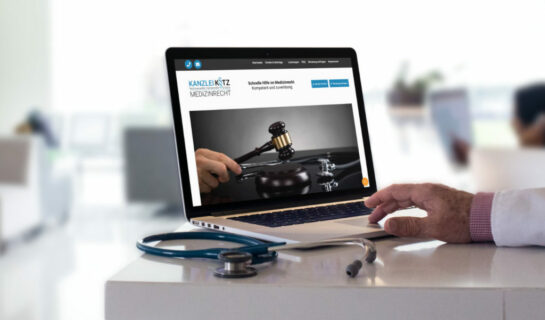Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Benötigen Sie Hilfe?
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wann kann ich einen medizinischen Sachverständigen wegen Befangenheit ablehnen?
- Welche Rolle spielt ein Privatgutachten bei der Beurteilung der Befangenheit eines gerichtlich bestellten Sachverständigen?
- Wie läuft ein Befangenheitsantrag gegen einen Sachverständigen ab und welche Fristen muss ich beachten?
- Was kann ich tun, wenn mein Befangenheitsantrag gegen einen medizinischen Sachverständigen abgelehnt wurde?
- Welche Konsequenzen hat es, wenn ein Sachverständiger tatsächlich befangen ist?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Hinweise und Tipps
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 17 W 24/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: OLG Frankfurt
- Datum: 06.03.2025
- Aktenzeichen: 17 W 24/24
- Verfahrensart: sofortige Beschwerde
- Rechtsbereiche: Arzthaftungsrecht, Sozialrecht, Zivilprozessrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Die Klägerin (Beschwerdeführerin in diesem Verfahren) macht Schadensersatzansprüche geltend, die ursprünglich einer Patientin zustanden und aufgrund gesetzlicher Regelungen (§ 116 SGB X) auf sie übergegangen sind. Sie beantragte, den gerichtlich bestellten Sachverständigen wegen Befangenheit abzulehnen und legte Beschwerde ein, nachdem dieser Antrag vom vorherigen Gericht zurückgewiesen wurde.
- Beklagte: Die Beklagte (aus dem ursprünglichen Verfahren), gegen die sich die Schadensersatzansprüche wegen mutmaßlicher Behandlungsfehler richten.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Eine Patientin erhielt 2015 eine Knieprothese und musste sich danach mehreren Folgebehandlungen unterziehen. Die Klägerin (als Rechtsnachfolgerin der Patientin, vermutlich eine Krankenkasse) verklagte die Beklagte (vermutlich das Krankenhaus oder den behandelnden Arzt) auf Schadensersatz. Das Gericht beauftragte einen Sachverständigen (A) mit einem Gutachten. Nach Vorlage des Gutachtens kam es in einer mündlichen Verhandlung zu einer kontroversen Diskussion zwischen dem Anwalt der Klägerin und dem Sachverständigen. Daraufhin stellte die Klägerin einen Antrag, den Sachverständigen wegen Befangenheit abzulehnen. Dieser Antrag wurde vom Gericht erster Instanz zurückgewiesen. Mit der sofortigen Beschwerde wendet sich die Klägerin nun an das OLG Frankfurt und verfolgt den Befangenheitsantrag weiter.
- Kern des Rechtsstreits: Das OLG Frankfurt musste prüfen, ob die Zurückweisung des Befangenheitsantrags gegen den Sachverständigen durch die Vorinstanz korrekt war. Es ging also um die Frage, ob Gründe vorlagen, die aus Sicht der Klägerin ein berechtigtes Misstrauen an der Unparteilichkeit des Sachverständigen rechtfertigen könnten.
Der Fall vor Gericht
OLG Frankfurt: Keine Befangenheit des medizinischen Sachverständigen trotz Streitgespräch

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat die Beschwerde einer Klägerin zurückgewiesen. Diese hatte versucht, einen gerichtlich bestellten medizinischen Sachverständigen wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Das Gericht sah keine ausreichenden Gründe, an der Unparteilichkeit des Experten zu zweifeln, obwohl es zu einer hitzigen Auseinandersetzung im Gerichtssaal kam.
Hintergrund des komplexen Arzthaftungsfalls
Die Klägerin, vermutlich eine Krankenversicherung, macht Ansprüche aus übergegangenem Recht geltend (§ 116 SGB X, cessio legis). Das bedeutet, sie fordert Schadensersatz für Behandlungskosten, die sie für ihre Versicherte übernommen hat. Die Versicherte wurde am 25. November 2015 in der Klinik der Beklagten am Knie operiert und erhielt eine Schlittenprothese.
Es folgten mehrere komplizierte Nachbehandlungen. Bereits im Februar 2016 musste in der Klinik der Beklagten ein Teil der Prothese ausgetauscht werden. Spätere Operationen fanden in anderen Kliniken statt, darunter eine Innenbandrekonstruktion im November 2016 und ein kompletter Prothesenwechsel im März 2017. Zusätzlich trat eine Nervenschädigung auf.
Die geschädigte Patientin hatte bereits selbst vor dem Landgericht Gießen geklagt. Dieses Verfahren endete mit einem Vergleich. In jenem Prozess wurden bereits ein gerichtliches Sachverständigengutachten und ein Gutachten des Medizinischen Dienstes (MDK) erstellt. Diese Dokumente liegen auch im aktuellen Verfahren vor.
Streit um das neue Sachverständigengutachten
Im laufenden Verfahren vor dem Landgericht beauftragte das Gericht im März 2023 einen neuen Sachverständigen, Herrn A, mit der Begutachtung des Falls. Dieser legte sein Gutachten im Oktober 2023 vor. Die Klägerin war mit dem Inhalt nicht einverstanden und beantragte, den Sachverständigen zur mündlichen Erläuterung zu laden.
Eskalation im Gerichtstermin
Während der mündlichen Verhandlung am 9. Juli 2024 konfrontierte der Anwalt der Klägerin den Sachverständigen A mit den Ergebnissen eines von der Klägerin beauftragten Privatgutachtens. Laut Protokoll entwickelte sich daraus eine kontroverse Diskussion, die in einem regelrechten Streitgespräch mündete.
In diesem Wortgefecht warf der Sachverständige dem Anwalt vor, ihm fehle die Fähigkeit zur Selbstkritik. Daraufhin stellte der Anwalt sofort einen Befangenheitsantrag gegen den Sachverständigen. Die Auseinandersetzung ging jedoch weiter, und der Sachverständige äußerte gegenüber dem Anwalt: „Jedes Wort, dass Sie sagen, ist nicht richtig“.
Der Klägervertreter sah darin eine Bestätigung seiner Befangenheitsrüge. Er argumentierte, der Sachverständige weigere sich schlicht, sich mit abweichenden Meinungen auseinanderzusetzen. Dies zeige eine unangemessene Voreingenommenheit zulasten der Klägerin. Die beklagte Klinik trat dem Antrag entgegen.
Entscheidung des Landgerichts
Das Landgericht wies den Befangenheitsantrag zurück. Es bewertete die Reaktion des Sachverständigen als „nachvollziehbar“. Grund dafür sei das „insistierende Verhalten“ des Klägeranwalts und die Tatsache, dass dieser das Streitgespräch fortgesetzt habe, nachdem der Sachverständige bereits emotional reagiert hatte.
Die Beschwerde vor dem OLG Frankfurt
Die Klägerin legte gegen diese Entscheidung sofortige Beschwerde beim OLG Frankfurt ein. Sie wiederholte ihre Argumente, dass die Äußerungen des Sachverständigen Zweifel an seiner Neutralität begründeten. Die Beklagte hielt die Beschwerde für unbegründet.
Die Entscheidung des OLG Frankfurt
Das OLG Frankfurt schloss sich der Auffassung des Landgerichts an und wies die Beschwerde zurück (Az.: 17 W 24/24). Es bestätigte, dass keine Umstände vorlägen, die aus Sicht einer vernünftigen Partei die Besorgnis der Befangenheit gemäß § 406 Abs. 1 in Verbindung mit § 42 Abs. 2 der Zivilprozessordnung (ZPO) rechtfertigen könnten.
Maßstab für die Befangenheit eines Sachverständigen
Das Gericht erläuterte den rechtlichen Maßstab: Ein Sachverständiger kann abgelehnt werden, wenn Gründe vorliegen, die aus der Sicht einer vernünftigen, besonnenen Partei geeignet sind, Zweifel an seiner Unparteilichkeit zu wecken. Entscheidend ist nicht, ob der Sachverständige tatsächlich parteiisch ist oder ob das Gericht selbst Zweifel hegt.
Maßgeblich ist allein der objektive Anschein einer möglichen Voreingenommenheit für die Partei, die den Antrag stellt. Dabei können auch mehrere kleinere Vorfälle, die für sich genommen nicht ausreichen, in ihrer Gesamtheit die Besorgnis der Befangenheit begründen.
Keine ausreichenden Gründe im konkreten Fall
Im vorliegenden Fall sah das OLG Frankfurt diesen Maßstab nicht erfüllt. Obwohl die Äußerungen des Sachverständigen im Streitgespräch als unglücklich oder sogar unprofessionell gewertet werden könnten, reichten sie im Kontext der hitzigen Auseinandersetzung nicht aus, um eine Befangenheit zu begründen. Die Gerichte werteten die Reaktion offenbar als emotionale Entgleisung im Eifer des Gefechts, nicht als Ausdruck grundsätzlicher Voreingenommenheit.
Die Entscheidung betont, dass nicht jede scharfe oder ungeschickte Äußerung eines Sachverständigen automatisch dessen Ablehnung rechtfertigt. Die Gerichte berücksichtigen dabei auch das Verhalten der Prozessbeteiligten, das zu der Situation beigetragen haben könnte. Hier wurde das „insistierende“ Nachfragen des Anwalts als Mitauslöser der Reaktion gesehen.
Bedeutung für Betroffene
Was bedeutet das Urteil für Kläger und Beklagte?
Für Parteien in Zivilprozessen, insbesondere in komplexen Arzthaftungssachen, unterstreicht das Urteil: Die Hürden für die erfolgreiche Ablehnung eines Sachverständigen wegen Befangenheit sind hoch. Emotionale oder scharfe Reaktionen eines Experten in einer mündlichen Verhandlung reichen oft nicht aus, wenn sie als Reaktion auf eine hitzige Debatte oder insistierendes Nachfragen verstanden werden können.
Kläger müssen stichhaltige, objektive Gründe darlegen, die aus Sicht einer vernünftigen Person Zweifel an der Neutralität wecken. Ein bloßes Unbehagen oder die Tatsache, dass das Gutachten ungünstig ausfällt, genügt nicht. Auch heftige Auseinandersetzungen im Gerichtssaal führen nicht zwangsläufig zum Erfolg eines Befangenheitsantrags.
Für Beklagte bedeutet die Entscheidung eine Stärkung der Position des gerichtlich bestellten Sachverständigen. Dessen Expertise soll nicht leichtfertig durch Befangenheitsanträge infrage gestellt werden können, nur weil es zu Meinungsverschiedenheiten oder verbalen Auseinandersetzungen kommt.
Konsequenzen für Anwälte und Sachverständige
Anwälte müssen abwägen, wie intensiv sie einen Sachverständigen konfrontieren. Während eine kritische Befragung notwendig ist, kann ein zu aggressives oder insistierendes Vorgehen unter Umständen Reaktionen provozieren, die zwar unangenehm sind, aber von Gerichten nicht als Befangenheitsgrund gewertet werden.
Sachverständige wiederum werden daran erinnert, auch unter Druck professionell und sachlich zu bleiben. Auch wenn in diesem Fall keine Befangenheit festgestellt wurde, können unbedachte Äußerungen den Anschein der Voreingenommenheit erwecken und das Verfahren unnötig belasten und verzögern. Die Grenze zwischen zulässiger Deutlichkeit und Befangenheit begründendem Verhalten kann schmal sein.
Letztlich zeigt der Fall, dass Gerichte den Kontext einer Auseinandersetzung stark berücksichtigen und nicht allein auf den Wortlaut einzelner Äußerungen abstellen, wenn sie über die Befangenheit eines Sachverständigen entscheiden.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil verdeutlicht, dass bei Befangenheitsanträgen gegen Sachverständige ein objektiver Maßstab angelegt wird und emotionale Auseinandersetzungen während einer Verhandlung nicht automatisch Befangenheit begründen. Die Quintessenz liegt darin, dass selbst scharfe Äußerungen eines Sachverständigen im Rahmen einer fachlichen Kontroverse nicht als Befangenheit gewertet werden, solange sie im Kontext einer sachbezogenen Auseinandersetzung erfolgen. Für Betroffene bedeutet dies, dass bei Befangenheitsanträgen die Gesamtumstände berücksichtigt werden und nicht einzelne zugespitzte Formulierungen entscheidend sind.
Benötigen Sie Hilfe?
Befangenheitsanträge in Arzthaftungsfällen: Strategische Unterstützung durch unsere Kanzlei
In komplexen Arzthaftungsprozessen kann die Auseinandersetzung mit gerichtlich bestellten Sachverständigen eine entscheidende Rolle spielen. Wenn ein Sachverständiger in einem Streitgespräch während der mündlichen Verhandlung emotional oder unsachlich reagiert, stellt sich die Frage, ob dies die Besorgnis der Befangenheit rechtfertigen kann. Unsere Kanzlei unterstützt Sie dabei, die Erfolgsaussichten eines Befangenheitsantrags realistisch einzuschätzen und die geeignete Strategie für Ihr Verfahren zu entwickeln.
Wir beraten Sie kompetent und zielorientiert, sowohl bei der Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit Sachverständigen als auch bei der Bewertung von Reaktionen und Äußerungen im Kontext des Prozesses. Dabei berücksichtigen wir den spezifischen Kontext und die Rechtsprechung zur Befangenheit von Sachverständigen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wann kann ich einen medizinischen Sachverständigen wegen Befangenheit ablehnen?
Ein medizinischer Sachverständiger in einem Gerichtsverfahren oder einem Verwaltungsverfahren muss unparteiisch und neutral sein. Wenn Sie triftige Gründe haben anzunehmen, dass der Sachverständige nicht objektiv ist, können Sie ihn wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen.
Was bedeutet „Besorgnis der Befangenheit“?
Die Regeln für die Ablehnung von Richtern wegen Befangenheit (§ 42 Zivilprozessordnung – ZPO) werden entsprechend auch auf Sachverständige angewendet (§ 406 ZPO). Eine Ablehnung ist möglich, wenn ein Grund vorliegt, der aus der Sicht einer vernünftigen, am Verfahren beteiligten Person Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Sachverständigen rechtfertigen kann.
Es kommt also nicht darauf an, ob der Sachverständige tatsächlich parteiisch ist oder ob Sie persönlich davon überzeugt sind. Entscheidend ist, ob objektiv nachvollziehbare Umstände vorliegen, die bei einer vernünftigen Person Zweifel an der Neutralität des Sachverständigen wecken könnten. Das Gericht prüft, ob solche Zweifel aus objektiver Sicht begründet sind.
Typische Gründe für die Besorgnis der Befangenheit
Es gibt verschiedene Situationen, die Zweifel an der Unparteilichkeit eines medizinischen Sachverständigen begründen können. Hier einige Beispiele:
- Persönliche Beziehungen: Der Sachverständige ist mit einer beteiligten Person (z.B. Ihnen, der Gegenseite, deren Anwälten) eng befreundet, verwandt oder verfeindet.
- Wirtschaftliche Abhängigkeit: Der Sachverständige wird regelmäßig und in erheblichem Umfang von der Gegenseite (z.B. einer Versicherung) beauftragt, was den Anschein einer wirtschaftlichen Abhängigkeit erwecken könnte.
- Vorherige Behandlungen: Der Sachverständige hat Sie oder die gegnerische Partei früher selbst ärztlich behandelt. Dies kann zu Interessenkonflikten führen.
- Unsachliche oder abfällige Äußerungen: Der Sachverständige äußert sich während der Untersuchung oder im Gutachten unsachlich, herabwürdigend oder voreingenommen über Sie oder den Fall.
- Einseitige Festlegungen: Der Sachverständige hat sich bereits in früheren Gutachten oder Veröffentlichungen sehr einseitig zu der strittigen medizinischen Frage positioniert und lässt keine andere Sichtweise zu.
- Äußerungen zum Ergebnis: Der Sachverständige äußert sich vor Abschluss der Begutachtung bereits zum erwarteten Ergebnis oder lässt eine klare Tendenz erkennen.
- Enge Kontakte zur Gegenseite: Es bestehen enge berufliche oder private Kontakte zur gegnerischen Partei oder deren Bevollmächtigten, die über das übliche Maß hinausgehen.
Was ist bei der Begründung wichtig?
Für eine erfolgreiche Ablehnung reicht es nicht aus, nur ein ungutes Gefühl oder allgemeines Misstrauen zu äußern. Sie müssen konkrete Tatsachen vortragen, die die Besorgnis der Befangenheit stützen. Diese Tatsachen müssen für das Gericht nachprüfbar sein.
Der Antrag auf Ablehnung muss in der Regel unverzüglich gestellt werden, sobald Sie von dem Grund erfahren haben, der die Befangenheit begründen könnte.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Ein Sachverständiger kann abgelehnt werden, wenn Umstände vorliegen, die aus Sicht einer vernünftigen Person berechtigte Zweifel an seiner Unvoreingenommenheit aufkommen lassen. Es geht um die objektive Wahrung des Anscheins der Neutralität.
Welche Rolle spielt ein Privatgutachten bei der Beurteilung der Befangenheit eines gerichtlich bestellten Sachverständigen?
Ein von Ihnen privat in Auftrag gegebenes Gutachten führt nicht automatisch dazu, dass der vom Gericht bestellte Sachverständige als befangen gilt, auch wenn es zu anderen Ergebnissen kommt als das Gerichtsgutachten. Unterschiedliche fachliche Einschätzungen sind in vielen Bereichen normal und begründen für sich genommen noch keine Voreingenommenheit des gerichtlichen Sachverständigen.
Wie ein Privatgutachten dennoch relevant werden kann
Obwohl das Privatgutachten den gerichtlich bestellten Sachverständigen nicht direkt „widerlegt“ oder als befangen entlarvt, können sein Inhalt und insbesondere die Reaktion des Gerichtssachverständigen darauf wichtige Hinweise für eine mögliche Befangenheit liefern.
Stellen Sie sich vor, Sie legen dem Gericht ein fundiertes Privatgutachten vor, das wesentliche Kritikpunkte am Gutachten des Gerichtssachverständigen aufwirft. Relevant für die Frage der Befangenheit wird dann, wie der Gerichtssachverständige mit dieser Kritik umgeht:
- Ignoriert er die Argumente des Privatgutachtens vollständig, ohne darauf einzugehen?
- Setzt er sich unsachlich oder herablassend mit dem Privatgutachten oder dessen Verfasser auseinander?
- Beharrt er auf seiner Meinung, ohne auf die neuen Argumente oder Befunde einzugehen, obwohl diese stichhaltig erscheinen?
Ein solches Verhalten kann ein Indiz dafür sein, dass der Sachverständige nicht mehr unvoreingenommen prüft, sondern möglicherweise an seinem ursprünglichen Ergebnis festhält, ohne offen für andere Perspektiven zu sein. Dies könnte Misstrauen in seine Unparteilichkeit rechtfertigen. Entscheidend ist also nicht allein die Existenz eines abweichenden Privatgutachtens, sondern wie der gerichtlich bestellte Sachverständige damit umgeht.
Muss das Gericht das Privatgutachten berücksichtigen?
Ein Privatgutachten hat vor Gericht nicht den gleichen Stellenwert wie das Gutachten des gerichtlich bestellten Sachverständigen. Es ist kein formelles Beweismittel im gleichen Sinne, sondern wird als sogenannter substantiierter Parteivortrag gewertet. Das bedeutet, es ist eine fundierte Darstellung Ihrer Sichtweise.
Das Gericht ist verpflichtet, sich mit diesem substantiierten Vortrag auseinanderzusetzen. Es muss prüfen, ob die Einwände im Privatgutachten berechtigt sind und ob sie Zweifel an der Richtigkeit des Gerichtsgutachtens oder eben an der Neutralität des Sachverständigen wecken.
Im Rahmen eines Befangenheitsantrags muss das Gericht also prüfen, ob die im Privatgutachten dargelegten Punkte und/oder die Reaktion des Sachverständigen darauf objektiv betrachtet Anlass geben, an seiner Unparteilichkeit zu zweifeln. Das Gericht muss seine Entscheidung hierzu begründen. Es kann das Privatgutachten nicht einfach ignorieren, wenn es inhaltlich relevant und gut begründet ist.
Wie läuft ein Befangenheitsantrag gegen einen Sachverständigen ab und welche Fristen muss ich beachten?
Wenn Sie Zweifel an der Unparteilichkeit eines vom Gericht beauftragten Sachverständigen haben, beispielsweise eines medizinischen Gutachters, können Sie einen Befangenheitsantrag stellen. Ziel ist es, den Sachverständigen vom Verfahren auszuschließen, wenn Gründe vorliegen, die Misstrauen gegen seine Unvoreingenommenheit rechtfertigen.
Wie und wo stelle ich den Antrag?
Ein Befangenheitsantrag muss bei dem Gericht gestellt werden, das den Sachverständigen beauftragt hat. Sie können den Antrag schriftlich einreichen oder ihn mündlich bei der Geschäftsstelle des Gerichts zu Protokoll geben.
In Ihrem Antrag müssen Sie Folgendes tun:
- Den Sachverständigen benennen, gegen den sich der Antrag richtet.
- Die Gründe darlegen, warum Sie den Sachverständigen für befangen halten. Das können zum Beispiel enge persönliche oder geschäftliche Beziehungen zu einer Partei sein oder Äußerungen des Sachverständigen, die auf eine Voreingenommenheit schließen lassen.
- Die Gründe glaubhaft machen. Das bedeutet, Sie müssen dem Gericht nicht den vollen Beweis für die Befangenheit liefern, aber Tatsachen vortragen und ggf. belegen (z.B. durch Dokumente, E-Mails oder eine eidesstattliche Versicherung), die die Befangenheit als wahrscheinlich erscheinen lassen.
Welche Fristen sind entscheidend?
Die Einhaltung der Fristen ist sehr wichtig, da ein verspäteter Antrag vom Gericht zurückgewiesen wird.
- Grundsätzlich gilt: Sie müssen den Befangenheitsantrag unverzüglich stellen, sobald Sie von dem Grund erfahren haben, der die Befangenheit begründen soll. „Unverzüglich“ bedeutet ohne schuldhaftes Zögern.
- Besondere Frist nach Kenntnis des Gutachtens: Wenn sich der Befangenheitsgrund erst aus dem Inhalt des schriftlichen Gutachtens ergibt oder wenn Sie erst durch das Gutachten von einem Befangenheitsgrund erfahren, gilt oft eine spezielle Frist. In vielen Verfahren (z.B. Zivilprozess nach § 406 Zivilprozessordnung, Sozialgerichtsverfahren nach § 75 Sozialgerichtsgesetz) müssen Sie den Antrag spätestens zwei Wochen nach Zustellung des Gutachtens stellen. Haben Sie den Grund schon vorher gekannt, gilt die unverzügliche Pflicht.
- Mündliche Anhörung: Soll der Sachverständige sein Gutachten mündlich vor Gericht erläutern, muss der Antrag in der Regel vor Beginn seiner Anhörung gestellt werden, wenn der Grund zu diesem Zeitpunkt bekannt ist.
Es ist entscheidend, die für Ihr Verfahren geltende Frist genau zu beachten.
Was passiert nach der Antragstellung?
- Stellungnahme: Das Gericht gibt dem betroffenen Sachverständigen und der Gegenseite im Prozess die Möglichkeit, sich zu dem Antrag zu äußern. Der Sachverständige muss sich zu den Vorwürfen erklären.
- Entscheidung: Das Gericht entscheidet über den Antrag durch einen Beschluss. Es prüft, ob die dargelegten Gründe ausreichen, um eine Besorgnis der Befangenheit zu rechtfertigen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Sachverständige tatsächlich parteiisch ist, sondern ob aus Sicht einer vernünftigen Partei Zweifel an seiner Unvoreingenommenheit bestehen können.
- Folgen der Entscheidung:
- Erfolgreicher Antrag: Wird der Antrag für begründet erklärt, darf der Sachverständige nicht weiter tätig werden. Sein bisheriges Gutachten ist in der Regel nicht mehr verwertbar. Das Gericht muss dann entscheiden, ob und wie ein neuer Sachverständiger beauftragt wird.
- Erfolgloser Antrag: Weist das Gericht den Antrag zurück, bleibt der Sachverständige im Amt und sein Gutachten kann im Verfahren verwendet werden. Das Verfahren wird mit diesem Sachverständigen fortgesetzt.
Was kann ich tun, wenn mein Befangenheitsantrag gegen einen medizinischen Sachverständigen abgelehnt wurde?
Wenn das Gericht Ihren Antrag, einen medizinischen Sachverständigen wegen Befangenheit abzulehnen, zurückgewiesen hat, bedeutet das nicht automatisch, dass Sie keine weiteren Möglichkeiten mehr haben. Es gibt verschiedene Wege, wie Sie auf diese Entscheidung reagieren können, auch wenn die direkte Anfechtung der Ablehnung selbst oft eingeschränkt ist.
Überprüfung der Ablehnung im weiteren Verfahren
Die Entscheidung des Gerichts, Ihren Befangenheitsantrag abzulehnen, kann in den meisten Fällen nicht sofort mit einer Beschwerde angefochten werden. Das besagt zum Beispiel § 46 Absatz 2 der Zivilprozessordnung (ZPO), der über § 406 ZPO auch für Sachverständige gilt und in vielen Verfahrensarten (wie auch im Sozialgerichtsverfahren über § 118 SGG) zur Anwendung kommt.
Wichtig ist jedoch: Sie können die Ablehnung des Befangenheitsantrags später zusammen mit der gerichtlichen Endentscheidung (also dem Urteil oder Beschluss) anfechten. Wenn Sie also zum Beispiel Berufung oder Revision gegen das Urteil einlegen, können Sie dort argumentieren, dass der Befangenheitsantrag zu Unrecht abgelehnt wurde. Stellt das höhere Gericht fest, dass der Sachverständige tatsächlich befangen war und die Entscheidung auf dessen fehlerhaftem Gutachten beruht, kann dies zur Aufhebung des Urteils führen. Bewahren Sie daher alle Gründe und Belege für die Befangenheit sorgfältig auf.
Alternative Strategien im laufenden Verfahren
Auch wenn der Sachverständige vorerst nicht abgelehnt wurde, können Sie weiterhin versuchen, Zweifel an seiner Objektivität oder an der Richtigkeit seines Gutachtens zu äußern:
- Kritische Befragung des Sachverständigen: Nutzen Sie die Möglichkeit, den Sachverständigen gezielt zu seinem Gutachten zu befragen. Dies kann schriftlich geschehen oder mündlich in einer Gerichtsverhandlung. Stellen Sie präzise Fragen zu den Methoden, den Schlussfolgerungen und zu möglichen Widersprüchen. Sie können auch Fragen stellen, die auf die von Ihnen vermuteten Befangenheitsgründe abzielen, um diese im Protokoll festzuhalten.
- Einholung eines Privatgutachtens: Sie haben die Möglichkeit, auf eigene Kosten einen anderen, unabhängigen Sachverständigen mit der Erstellung eines Privatgutachtens zu beauftragen. Dieses Gutachten können Sie dem Gericht vorlegen. Es kann dazu dienen, Fehler oder Schwachstellen im Gutachten des gerichtlich bestellten Sachverständigen aufzuzeigen und das Gericht von Ihrer Sichtweise zu überzeugen. Das Gericht ist an ein Privatgutachten zwar nicht gebunden, muss es aber zur Kenntnis nehmen und sich damit auseinandersetzen, insbesondere wenn es fundierte Zweifel am Gerichtsgutachten weckt.
- Weitere Beweisanträge stellen: Prüfen Sie, ob es weitere Beweismittel gibt, die Ihre Position stützen oder das Gutachten des Sachverständigen in Frage stellen. Das könnten zum Beispiel andere ärztliche Berichte, Zeugenaussagen oder Urkunden sein. Sie können beim Gericht beantragen, diese Beweise zu erheben.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Ablehnung eines Befangenheitsantrags beendet nicht Ihre Möglichkeiten, die Objektivität des Sachverständigen oder die Qualität seines Gutachtens in Frage zu stellen. Die eigentliche Überprüfung der Ablehnung erfolgt oft erst im Rahmen eines Rechtsmittels gegen die Endentscheidung, während Sie im laufenden Verfahren andere Strategien nutzen können, um Ihre Argumente vorzubringen.
Welche Konsequenzen hat es, wenn ein Sachverständiger tatsächlich befangen ist?
Wenn ein Gericht feststellt, dass ein Sachverständiger tatsächlich befangen ist, hat das gravierende Folgen. Das von diesem Sachverständigen erstellte Gutachten gilt dann als grundsätzlich unverwertbar. Es darf für die gerichtliche Entscheidung nicht mehr verwendet werden.
Stellen Sie sich das wie bei einem Schiedsrichter vor, der heimlich Fan einer der spielenden Mannschaften ist: Seine Entscheidungen wären nicht neutral und daher im Ergebnis nicht fair. Ähnlich ist es bei einem befangenen Gutachter – seine Expertise kann nicht als objektive Grundlage für ein Urteil dienen.
Folgen für das Gerichtsverfahren
- Das befangene Gutachten wird bei der Entscheidung des Gerichts nicht berücksichtigt. Es ist so, als hätte es dieses Gutachten nicht gegeben.
- Das Gericht muss in der Regel einen neuen, unparteiischen Sachverständigen beauftragen. Dieser wird den Sachverhalt (z.B. eine medizinische Untersuchung) erneut prüfen und ein eigenständiges, unabhängiges Gutachten erstellen.
- Dadurch verzögert sich das Gerichtsverfahren, da die neue Begutachtung und die Erstellung des neuen Gutachtens Zeit benötigen. Für die beteiligten Parteien bedeutet das eine längere Wartezeit auf eine gerichtliche Entscheidung. Ziel ist es jedoch, ein faires und auf objektiven Grundlagen beruhendes Urteil sicherzustellen.
Mögliche Konsequenzen für den Sachverständigen selbst
Ein Sachverständiger, der seine Aufgabe nicht neutral und unparteiisch erfüllt, muss unter Umständen auch mit persönlichen Konsequenzen rechnen:
- Zivilrechtliche Haftung: Wenn einer Partei durch ein nachweislich fehlerhaftes oder parteiisches Gutachten ein finanzieller Schaden entsteht, könnte der Sachverständige unter Umständen auf Schadensersatz verklagt werden.
- Strafrechtliche Folgen: Erstattet ein Sachverständiger vor Gericht vorsätzlich (also bewusst und gewollt) ein falsches Gutachten, kann dies strafbar sein. Je nach Einzelfall kommen hier verschiedene Straftatbestände in Betracht (z.B. Falschaussage oder spezifische Delikte bei Gesundheitszeugnissen), die zu Geld- oder sogar Freiheitsstrafen führen können.
Die Feststellung der Befangenheit dient also dem Schutz eines fairen Verfahrens und stellt sicher, dass gerichtliche Entscheidungen auf einer objektiven und unparteiischen Tatsachengrundlage getroffen werden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Besorgnis der Befangenheit
Dies beschreibt die Sorge einer Prozesspartei, dass ein Richter oder – wie hier im Fall – ein Sachverständiger nicht unparteiisch ist und deshalb eine Entscheidung oder ein Gutachten negativ beeinflussen könnte. Entscheidend ist nicht, ob die Person tatsächlich parteiisch ist, sondern ob aus Sicht einer vernünftigen, besonnenen Partei genügend objektive Gründe für solche Zweifel bestehen (§ 406 i.V.m. § 42 Zivilprozessordnung – ZPO). Bereits der Anschein der Voreingenommenheit kann ausreichen, um die Person vom Verfahren auszuschließen. Im vorliegenden Fall bezweifelte die Klägerin die Unparteilichkeit des medizinischen Sachverständigen wegen dessen heftiger Äußerungen im Streitgespräch, was das Gericht jedoch nicht als ausreichenden Grund ansah.
Beispiel: Ein Gutachter, der kurz vor der Verhandlung öffentlich äußert, dass er die Argumente einer Partei generell für „Unsinn“ hält, könnte wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden, da dies Zweifel an seiner Neutralität weckt.
übergegangenes Recht / cessio legis (§ 116 SGB X)
Hierbei handelt es sich um einen gesetzlichen Anspruchsübergang, auch Legalzession (cessio legis) genannt. Wenn eine Sozialversicherung (wie hier vermutlich die Krankenversicherung der Klägerin) für einen Schaden aufkommt, den ein Dritter (hier die Klinik) verursacht hat, gehen die Schadensersatzansprüche des Geschädigten (des Versicherten) automatisch per Gesetz auf die Versicherung über (§ 116 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch – SGB X). Die Versicherung kann dann diesen Anspruch im eigenen Namen gegen den Schädiger geltend machen, um die von ihr geleisteten Zahlungen (z. B. Behandlungskosten) zurückzufordern. Im Text macht die Klägerin (Versicherung) also die Ansprüche geltend, die ursprünglich der behandelten Patientin gegen die Klinik zustanden.
Beispiel: Ihre Krankenkasse bezahlt Ihre Behandlungskosten nach einem Verkehrsunfall, den ein anderer verschuldet hat. Nach § 116 SGB X geht Ihr Anspruch auf Erstattung dieser Kosten gegen den Unfallverursacher auf Ihre Krankenkasse über, die das Geld dann direkt vom Verursacher (bzw. dessen Versicherung) fordern kann.
sofortige Beschwerde
Die sofortige Beschwerde ist ein Rechtsmittel im Zivilprozess, das sich gegen bestimmte gerichtliche Entscheidungen richtet, die nicht das endgültige Urteil in der Hauptsache sind (geregelt z.B. in § 567 ff. ZPO). Sie muss – wie der Name sagt – in einer kurzen Frist nach Bekanntgabe der Entscheidung eingelegt werden. Typischerweise wird sie gegen prozessleitende Verfügungen oder Beschlüsse verwendet, wie hier gegen die Entscheidung des Landgerichts, den Befangenheitsantrag gegen den Sachverständigen zurückzuweisen. Sie ermöglicht eine schnelle Überprüfung durch die nächsthöhere Instanz (hier das OLG Frankfurt), ohne das Ende des Hauptverfahrens abwarten zu müssen.
Beispiel: Das Gericht lehnt Ihren Antrag ab, einen wichtigen Zeugen zu hören. Sie halten diese Entscheidung für falsch und möchten sie schnell überprüfen lassen. Sie können dagegen sofortige Beschwerde einlegen, über die dann das nächsthöhere Gericht entscheidet.
Vergleich
Ein Vergleich ist ein Vertrag, durch den ein Rechtsstreit oder eine Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis durch gegenseitiges Nachgeben beigelegt wird (geregelt z. B. in § 779 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Im gerichtlichen Kontext einigen sich die Parteien oft auf einen Kompromiss, um das Verfahren zu beenden, anstatt ein Urteil abzuwarten. Dieser gerichtliche Vergleich beendet den Rechtsstreit zwischen den beteiligten Parteien endgültig. Im Text wird erwähnt, dass die geschädigte Patientin selbst bereits einen Prozess gegen die Klinik führte, der mit einem Vergleich endete; dies betraf jedoch nur ihren eigenen Anspruch, nicht den hier relevanten, auf die Versicherung übergegangenen Anspruch.
Beispiel: Zwei Nachbarn streiten vor Gericht über den genauen Grenzverlauf ihrer Grundstücke. Um den teuren und langen Prozess zu beenden, schließen sie einen Vergleich: Sie einigen sich auf eine neue Grenzlinie in der Mitte des umstrittenen Bereichs, und beide verzichten auf weitere Forderungen.
Privatgutachten
Ein Privatgutachten ist ein Gutachten, das von einer der Prozessparteien selbst in Auftrag gegeben und bezahlt wird, im Gegensatz zum Gutachten eines gerichtlich bestellten Sachverständigen. Es dient dazu, die eigene Position im Prozess zu untermauern, Argumente zu finden oder das Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen anzugreifen. Im Gerichtsprozess hat ein Privatgutachten nicht den gleichen Stellenwert wie ein gerichtliches Gutachten, es wird rechtlich als qualifizierter Parteivortrag gewertet. Im vorliegenden Fall nutzte der Anwalt der Klägerin ein solches Privatgutachten, um den gerichtlich bestellten Sachverständigen A in der mündlichen Verhandlung zu konfrontieren.
Beispiel: Sie sind in einen Autounfall verwickelt. Das vom Gericht bestellte Gutachten kommt zu einem für Sie ungünstigen Ergebnis bezüglich der Schuldfrage. Sie beauftragen auf eigene Kosten einen anderen Sachverständigen mit einem Privatgutachten, um die Ergebnisse des Gerichts-Gutachters zu widerlegen oder zumindest Zweifel daran zu säen.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 406 Abs. 1 ZPO: Ein Sachverständiger kann aus denselben Gründen abgelehnt werden wie ein Richter. Dies bedeutet, dass eine Partei einen Sachverständigen ablehnen kann, wenn Umstände vorliegen, die Zweifel an dessen Unparteilichkeit oder Neutralität begründen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Klägerin hat den Sachverständigen A wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt, da sie aufgrund seiner Äußerungen im Rahmen der mündlichen Verhandlung Zweifel an seiner Unvoreingenommenheit hatte.
- § 42 Abs. 2 ZPO: Ein Richter (und somit auch ein Sachverständiger) kann wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Besorgnis der Befangenheit ist gegeben, wenn aus der Sicht einer vernünftigen Partei Gründe vorliegen, die Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters rechtfertigen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht musste prüfen, ob die Äußerungen des Sachverständigen A aus objektiver Sicht einer Partei Anlass geben konnten, an seiner Unvoreingenommenheit zu zweifeln.
- § 407a ZPO: Das Gericht kann anordnen, dass der Sachverständige sein schriftliches Gutachten mündlich erläutert. Dies dient der Aufklärung des Sachverhalts und ermöglicht den Parteien, Fragen zum Gutachten zu stellen und die Expertise des Sachverständigen zu hinterfragen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Situation, die zur Ablehnung des Sachverständigen führte, entstand während einer solchen mündlichen Erläuterung, als der Prozessbevollmächtigte der Klägerin kritische Fragen zum Gutachten stellte und eine kontroverse Diskussion entstand.
Hinweise und Tipps
Praxistipps für Patienten im Arzthaftungsprozess bei Befangenheit eines gerichtlichen Gutachters
Sie befinden sich in einem Rechtsstreit wegen eines möglichen Behandlungsfehlers und das Gericht hat einen medizinischen Gutachter bestellt. Vielleicht sind Sie mit dem Gutachter unzufrieden oder haben nach einem Gespräch Zweifel an seiner Neutralität. Es ist wichtig zu wissen, wann und wie Sie Bedenken gegen einen Gutachter äußern können.
Hinweis: Diese Praxistipps stellen keine Rechtsberatung dar. Sie ersetzen keine individuelle Prüfung durch eine qualifizierte Kanzlei. Jeder Einzelfall kann Besonderheiten aufweisen, die eine abweichende Einschätzung erfordern.
Tipp 1: Objektive Gründe für Befangenheit sind entscheidend
Ein reines Gefühl der Ungerechtigkeit oder ein hitziges Wortgefecht während einer Verhandlung reicht in der Regel nicht aus, um einen Gutachter wegen Befangenheit abzulehnen. Sie benötigen konkrete, nachvollziehbare Gründe, die bei einem vernünftigen Betrachter Zweifel an der Unparteilichkeit des Gutachters wecken.
Beispiel: Ein nachweisbares enges persönliches oder wirtschaftliches Verhältnis des Gutachters zur Gegenseite, frühere eindeutig negative Äußerungen über Sie oder eine nachweislich unsachliche Vorgehensweise bei der Begutachtung könnten solche Gründe sein.
⚠️ ACHTUNG: Bloße Kritik am Inhalt des Gutachtens oder eine für Sie negative Schlussfolgerung begründet für sich allein noch keine Befangenheit.
Tipp 2: Hohe Anforderungen an den Nachweis der Befangenheit
Gerichte setzen die Hürden für die Ablehnung eines Sachverständigen wegen Befangenheit bewusst hoch. Der Grundsatz ist, dass bestellte Gutachter als neutral gelten. Sie müssen daher stichhaltige Argumente vorbringen, warum dieser Grundsatz im konkreten Fall durchbrochen sein sollte.
⚠️ ACHTUNG: Eine Auseinandersetzung zwischen Ihrem Anwalt und dem Gutachter in der mündlichen Verhandlung führt nicht automatisch zur Annahme von Befangenheit, wie der geschilderte Fall zeigt.
Tipp 3: Befangenheitsantrag formal korrekt und zeitnah stellen
Wenn Sie ernsthafte Zweifel an der Unparteilichkeit des Gutachters haben, müssen diese Bedenken formal korrekt über Ihren Anwalt bei Gericht geltend gemacht werden. Dies geschieht durch einen sogenannten Befangenheitsantrag.
⚠️ ACHTUNG: Ein solcher Antrag muss in der Regel unverzüglich gestellt werden, nachdem Sie von dem Ablehnungsgrund Kenntnis erlangt haben. Zögern Sie nicht, Bedenken sofort mit Ihrem Anwalt zu besprechen, um keine Fristen zu versäumen.
Tipp 4: Unterscheiden Sie zwischen ungünstigem Gutachten und Befangenheit
Es ist menschlich, von einem Gutachten enttäuscht zu sein, das die eigenen Ansprüche nicht stützt. Wichtig ist jedoch die Unterscheidung: Ist das Gutachten nur inhaltlich für Sie ungünstig, weil der Gutachter die Fakten anders bewertet? Oder gibt es Anzeichen dafür, dass der Gutachter aus unsachlichen Motiven parteiisch ist? Nur letzteres rechtfertigt einen Befangenheitsantrag.
Weitere Fallstricke oder Besonderheiten?
Ein häufiger Irrtum ist die Annahme, jede Form von Kritik oder hartnäckigem Nachfragen durch den Gutachter sei bereits ein Zeichen von Voreingenommenheit. Gutachter sind verpflichtet, den Sachverhalt kritisch zu prüfen und auch unangenehme Fragen zu stellen. Entscheidend ist, ob die Grenze zur Unsachlichkeit oder persönlichen Abneigung überschritten wird. Beachten Sie auch, dass die Kosten für ein neues Gutachten erheblich sein können und die Prozessdauer verlängern.
✅ Checkliste: Vorgehen bei möglicher Gutachter-Befangenheit
- Gibt es konkrete, beweisbare Fakten für die Befangenheit (nicht nur ein Gefühl oder eine Meinungsverschiedenheit)?
- Liegen die Gründe außerhalb des reinen Gutachteninhalts (z. B. persönl. Beziehung, unsachliches Verhalten)?
- Wurden die Bedenken dem Anwalt unverzüglich nach Kenntniserlangung mitgeteilt?
- Kann der formale Antrag auf Ablehnung (Befangenheitsantrag) fristgerecht gestellt werden?
- Wurden die (geringen) Erfolgsaussichten und Konsequenzen eines solchen Antrags realistisch mit dem Anwalt besprochen?
Das vorliegende Urteil
OLG Frankfurt – Az.: 17 W 24/24 – Beschluss vom 06.03.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.